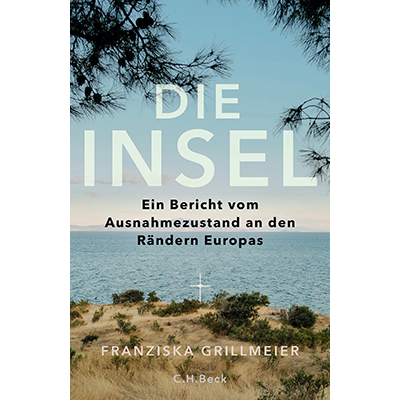Da gibt es die Anekdote von Salah Aram, einem geflüchteten Ingenieur aus dem Sudan, der am Tag des Fastenbrechens, dem höchsten Festtag der Muslime, mit einer Gruppe von Freunden grillen wollte. Als sie einen Platz am Rande des Lagers Moria, dem damals größten und verelendetsten Flüchtlingslager Europas, suchen, stellen sich Polizisten in ihren Weg. „Zurück“, sagen sie, und: „Dies ist nicht dein Land.“ Der Einwand, dass die Flüchtlinge immer an diese Stelle kamen und sie sich noch auf dem Gelände des Lagers bewegten, bringt Aram nur die Drohung ein, mit auf die Wache genommen zu werden. Schließlich gibt die Gruppe auf. „Ich bin nicht zum Kämpfen nach Europa gekommen“, sagt Aram resigniert, und sie müssen ihr Grillfest weiter unten am Hang feiern – inmittten von Müll und Fäkalien des Lagers Moria.
Es ist ein kleines Schlaglicht auf die Lage auf der Insel Lesbos, jenem Ort, der wie wenige andere für die Entwicklungen an der Außengrenze Europas steht. Schon das rechtfertigt, der Insel ein Buch zu widmen, wie es die Journalistin Franziska Grillmeier getan hat. Sie kann von dem, was dort geschieht, in ganz anderer Weise berichten als die meisten anderen Journalist:innen. Denn sie zog 2018 nach Lesbos und blieb dort.
Auf 200 Seiten berichtet Grillmeier in Die Insel von Menschen wie Salah Aram, ihren Nöten, ihren Hoffnungen, ihrer Geschichte, wie sie sich wiederfinden in einer Maschinerie der Abschottung, die meist chaotisch ist, belastend, bisweilen tödlich, aber immer wieder auch Lücken lässt, Raum für Hoffnung, Wege hinaus, in ein neues Leben. Seit vielen Jahren ist die Ägäisinsel nahe der türkischen Küste ein Tor für Menschen auf dem Weg nach Europa. Die Inselbevölkerung war lange sehr solidarisch, bis 2020 die Stimmung kippte. Heute steht Lesbos für einen atemberaubenden moralischen Verfall, der die Entrechtung Ankommender zum Normalzustand werden ließ – zum Beispiel in Moria, jenem Lager, das mit EU-Millionen 2014 eröffnet wurde und schon nach kurzer Zeit einer Mischung aus Gefängnis und Slum glich.
In Die Insel, darauf ist der Verlag stolz, sind es vor allem die Geflüchteten, die zu Wort kommen. Grillmeier zeichnet die Überlebensstrategien der Gestrandeten nach, ihren Kampf um Würde, gegen die Verzweiflung, für eine Zukunft. Sie ist bei ihnen, im Alltag, der schlimm genug ist, während der quälend langen Asylwartezeit, der ewigen Corona-Lagerlockdowns, und sie ist da, wenn die Katastrophen über sie hereinbrechen, wie die immer wiederkehrenden Feuer. Sie beschreibt Panikattacken, Selbstverbrennungen – und Siege: Wenn eine Weiterreise an einen sicheren Ort für manche doch möglich wird. Solche Nähe gewinnt nur, wem Vertrauen geschenkt wird. Und nur so ist möglich, den Menschen, die allzu oft nur als Zahlen, als abstrakte Größe, in unsere Wahrnehmung gelangen, in ihrer Subjekthaftigkeit ernsthaft gerecht zu werden: durch Nähe und Zeit. So gelingt es Grillmeier auch, die Repression gegen die Helfer:innen aus einer Innenperspektive so plastisch zu schildern, wie es nirgendwo sonst zu lesen war.
Das Lager Moria, so schreibt Grillmeier treffend, sei „eine Bühne von Rechteverletzungen“ geworden, die „fotografiert werden sollte“, damit die Abschreckung wirklich griff. Die Menschen seien „unfreiwillig zu Protagonistinnen des Spektakels“ gemacht worden. So erklärt sich auch, und das wäre zu ergänzen, dass Griechenland lange enorme Summen der EU zur Flüchtlingsversorgung einfach nicht abrief, um das Elend künstlich aufrechtzuerhalten. Das Elend der Flüchtlinge an Europas Grenzen ist zu jenem Normalzustand geworden, der es niemals sein darf. Gewöhnung und Abstumpfung tragen dazu bei. Franziska Grillmeiers Buch ist ein Beitrag, dies zu durchbrechen: Durch eine Authentizität und Detailgetreue der Beobachtung, die nur jenen glückt, die sich viele Jahre Zeit dafür nehmen.
Christian Jakob
Christian Jakob ist Redakteur bei der taz in Berlin.