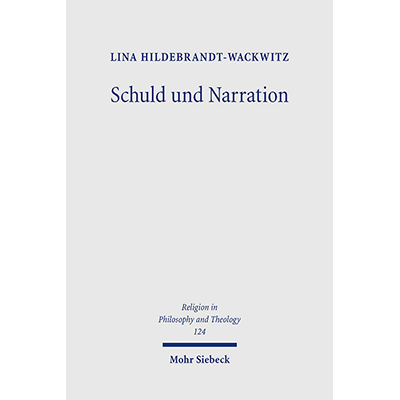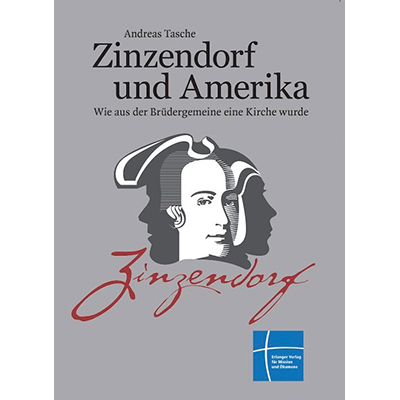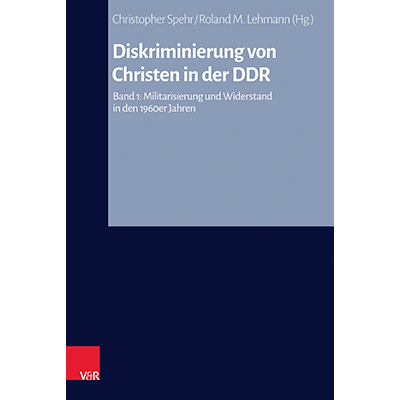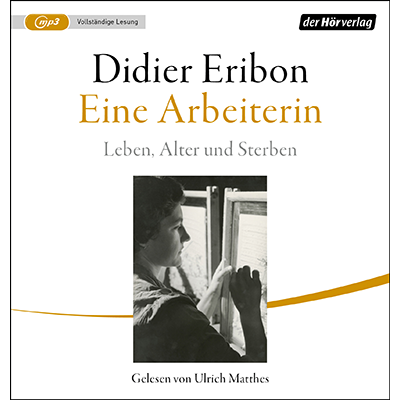Angesichts der Missbrauchsskandale in beiden Großkirchen ist Schuld in neuer Form und Dringlichkeit ein Thema – nicht nur – der Theologie geworden. Vor diesem Hintergrund liest sich die Studie von Lina Hildebrandt-Wackwitz als ein Buch zur Stunde. Dabei haftet ihm – so wichtig es hier und jetzt ist – nichts Gewollt-Aktuelles an, sodass seine Relevanz für den Fachdiskurs (aber auch für darüber hinausgehende Gesprächszusammenhänge) über eine recht hohe Halbwertzeit verfügen dürfte.
Die – sowohl hinsichtlich des Umfangs des Referenzmaterials als auch aufgrund der Präzision im analytischen Zugriff auf dieses wie in seiner reflexiven Auswertung – beeindruckende Arbeit setzt sich nämlich in ganz grundsätzlicher Art und Weise mit Schuld auseinander. Dies tut sie mit einer doppelten Schwerpunktsetzung, indem sie die Frage nach den anthropologischen Voraussetzungen von Schuld mit derjenigen nach narrativen Formen ihrer Aufarbeitung verknüpft.
Die Gesprächspartner der Autorin – Hannah Arendt, Søren Kierkegaard und Paul Ricœur – sind zwar grundsätzlich als Gegenstand einer theologischen Arbeit nicht überraschend, jedoch erbringen zum einen sowohl die Gruppierung der drei als auch die Anwendung der spezifischen Fragestellung einen enormen Erkenntnisgewinn. Zum anderen trägt Hildebrandt-Wackwitz mit Bravour die Bürde, drei Autoren komparativ zu untersuchen, die sämtlich über eine umfangreiche Rezeptionsgeschichte verfügen und die sich je zum Gegenstand einer eigenen Monografie zur Schuld-Thematik eignen würden.
Der Autorin ist zu danken, dass sie die geistesgeschichtlichen wie biografischen Kontexte der Schlüsseltexte, sowie die werkgeschichtlichen Prolegomena nicht stillschweigend voraussetzt und in medias res geht, sondern jedem der ersten drei Kapitel eine kundige wie – was für das gesamte Buch gilt – wirklich lesbare Einführung voranstellt. Diese befähigen den Leser, Hildebrandt-Wackwitz zu folgen, wenn sie das „Schuldbewusstsein als Weg existenzieller Selbsterschließung“ bei Kierkegaard, die „Schuld als Weigerung des Menschen, ein Jemand zu sein“, bei Arendt sowie das „Schuldbekenntnis als Anerkennung des Selbst“ bei Ricœur durchdringt.
Dabei ist der Zugang der Autorin zu den drei untersuchten Entwürfen kein rein affirmativer. Vielmehr profiliert sie wiederholt – und erkenntnisfördernd – die drei Positionen gegeneinander und gelangt zu kritischen Anfragen, wenn sie etwa in der „Verhältnisbestimmung von Selbstannahme durch Gottesannahme, wie sie in Kierkegaards Formel für den Glauben zum Ausdruck kommt“, die Gefahr markiert, „die Bedingungen des Glaubens zu stark auf der Ebene der Selbsterkenntnis zu verorten und damit das Gottesverhältnis nur als ‚sekundäre Konsequenz‘ zu würdigen“.
Momente wie dieser bringen sowohl das dogmatische Profil der Autorin als auch das – stets mitschwingende – systematisch-theologische Interesse zum Strahlen, das die philosophiegeschichtliche Studie leitet, die den ersten und umfangreichsten Teil des Buches darstellt. In diesem ist bereits der Brückenschlag zwischen Philosophie und Theologie präsent, den die Autorin dann im zweiten Teil nochmals forciert, indem sie Perspektiven beider Disziplinen miteinander verknüpft.
Dies tut sie, indem sie in den letzten drei Kapiteln zunächst in Anknüpfung an die vorangegangenen Untersuchungen eine eigenständige Phänomenologie der Schuld entwickelt, hierauf aufbauend die Bedeutung von „[n]arrative[r] Selbstauslegung als Form der Schuldverarbeitung“ ergründet und abschließend einen Ausblick bietet auf die Vergebung als sich im Idealfall ereignendes Korrelat der Schuldverarbeitung. Dabei akzentuiert Hildebrandt-Wackwitz freilich den „Wundercharakter der Vergebung“, der „wesentlich darin begründet [liegt], dass das Zustandekommen der Vergebung für die beteiligten Akteure unverfügbar ist“.
Tilman Asmus Fischer
Tilman Asmus Fischer ist wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Theologischen Fakultät der Humboldt-Universität zu Berlin und schreibt als Journalist über Theologie, Politik und Gesellschaft