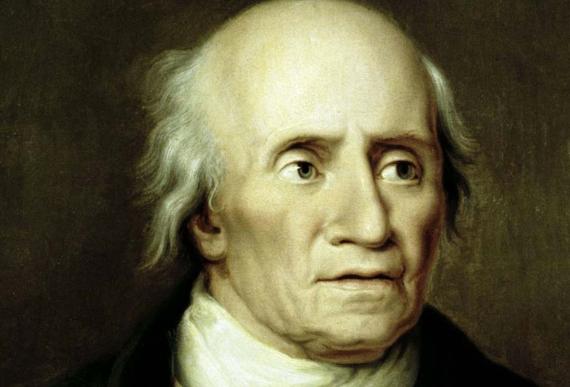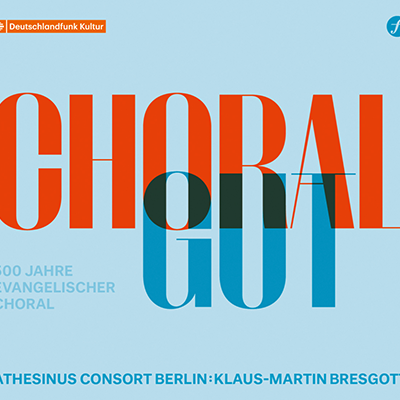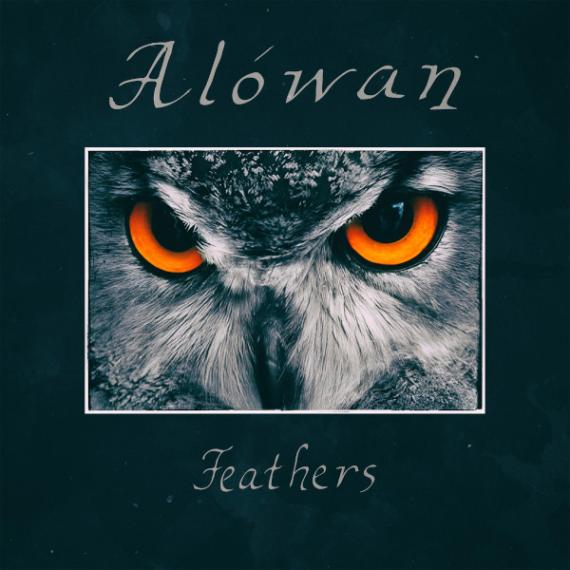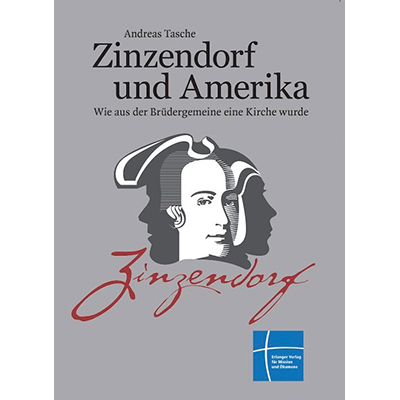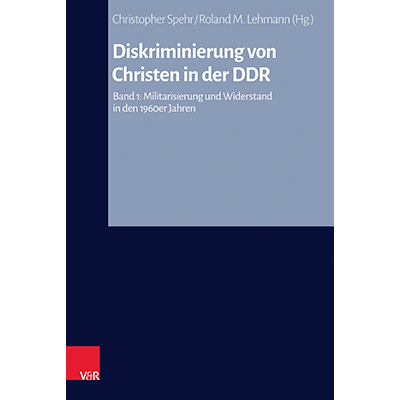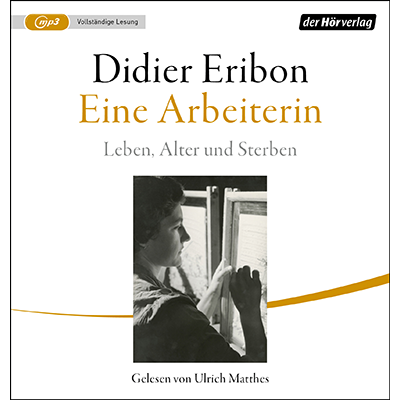Ratgeberliteratur sagte man heute: Alexander Spoerls Taschenbuch Teste selbst galt jenen, die ein Auto kaufen wollten. Paul Celan erhielt es ungefragt, las es, wie Anmerkungen zeigen, und notierte darin Gedichtentwürfe. Zwar fiel der mit der Todesfuge berühmt Gewordene („wir schaufeln ein Grab in den Lüften da liegt man nicht eng“) nie als Autofahrer auf, fand aber Material bei Spoerl, etwa das Adverb „koppheister“ (kopfüber), das mit „gehen“ kaputt- und zugrunde gehen meint. Im Gedicht „Unverwahrt“ aus dem Band Fadensonnen taucht es dann auf: „Mit ausgebeulten Gedanken / fuhrwerkt der Schmerz. / Die koppheistergegangene Trauer. / Die Schwermut, aufs neue geduldet, / pendelt sich ein.“
Es ist in Bertrand Badious üppiger Bildbiografie eines der Beispiele für Lesefrüchte. Badiou, der in Paris die Paul-Celan-Arbeitsstelle leitet und mit dessen Sohn den Nachlass betreut, widmet ihm eine Doppelseite des großformatigen, schwergewichtigen Bandes – mit Faksimiles, Coverfoto und konzisen Erläuterungen. Für die Gestalt des chronologisch angelegten Projekts (von der Geburt in Czernowitz 1920 über die Stationen Bukarest/1945–47, Wien/1947–48 und Paris bis zum Suizid 1970) ist der Ausschnitt bezeichnend.
Badiou reiht gründlich, stark bebildert sowie mit Unveröffentlichtem aus seinen Tagebüchern ergänzt, Stücke aus Celans Leben auf: „eine zersprungene Biografie aus Splittern“, wie er im Vorwort schreibt.
Gut, geradezu berauschend lesbar, doch mit großem Vorbehalt, den Badiou überging. Denn Celan stand der Fotografie höchst skeptisch gegenüber. Und er lehnte die Biografie als Mittel zur Deutung seiner Texte geradezu kategorisch ab: „Echte Dichtung ist antibiografisch“, schrieb er. Sie entstehe zwar aus der Erfahrung des Schreibenden, von ihr aufgeladen und beglaubigt (für Celan war zeitlebens das Trauma des Holocausts prägend: Während er Zwangsarbeit im Lager leistete, ging sein Vater in einem andern zugrunde, die Mutter haben deutsche SS-Leute mit Genickschuss ermordet), sei darauf jedoch keinesfalls zu reduzieren. Ein Gedicht gehe darüber hinaus, spalte sich ab, sei nicht autobiografisch, sondern existenziell – und so auch jedem anderen zugehörig. „Im Gedicht ereignet sich etwas; passiert etwas, die Sprache als Dasein passiert die Enge dessen, der das Gedicht schreibt; sie geht hindurch und vorbei“, notierte er zur Rede „Von der Dunkelheit des Gedichtes“, die er 1959 in Wuppertal hielt: „Die Dunkelheit des Gedichtes = die Dunkelheit des Todes. Die Menschen = die Sterblichen. Darum zählt das Gedicht, als das des Todes eingedenk bleibende, zum Menschlichsten am Menschen.“
Splitter, die faszinieren und unmittelbar ins Denken wie Hören ziehen. Parallel zur inspirierenden Badiou-Lektüre erfolgt der Griff zu Celans Gedichtbänden denn auch fast unwillkürlich. Schon dies ist ein Gewinn. Genau deshalb stellt sich allerdings auch die Frage, ob man all dies fesselnd Viele über den Dichter überhaupt wissen will. Die Probe aufs Antibiografische bestehen seine Gedichte schließlich famos. Zur Seite legen mag man den Band aber nicht, vielleicht aus Lust am Tratsch oder wegen der Faszination seines Schicksals: zu Hause eigentlich nur in der Sprache – und dann ausgerechnet in jener der Täter.
Badiou schöpft gelungen aus dem Vollen und hat sogar Fachleuten noch Neues zu bieten, etwa aus Gesprächen mit Freunden der Bukarester Zeit, die er in Paris wiedertraf.
Störend sind indes Ton und Stil der Darstellung der Amouren. Vom erotomanen Lebenshunger des Shoa-Überlebenden und seiner Freunde zu reden ist offenbar unter Celanografen beliebt, auch in Rezensionen scheint es durch. Aber ist es angemessen? Das Bild vom drängenden Eroberer reduziert die kaum weniger leidenschaftlich beteiligten Frauen zu bloßer Beute. Es nähme auch der prallen Erotik mancher Gedichte ihre hinreißende Tiefe, hielten wir uns da nicht strikt ans Antibiografische. Wie Celan hier sichtbar wird, das trägt angesichts der hagiografischen Grundstimmung vielleicht unabsichtlich, aber wohltuend zur Entmythologisierung bei, etwa wenn Badiou nebenher erwähnt, wie eifersüchtig er seiner Frau gegenüber war.
Dass er zum Ende hin, als Celan mutmaßlich vom Pont Mirabeau in die Seine und so aus dem Leben ging, das Koppheister-Motiv erneut aufnimmt, unterstreicht, wie souverän er in seinem fesselnden Splitter-Werk alle Fäden in der Hand hält.
Udo Feist
Udo Feist lebt in Dortmund, ist Autor, Theologe und stellt regelmäßig neue Musik vor.