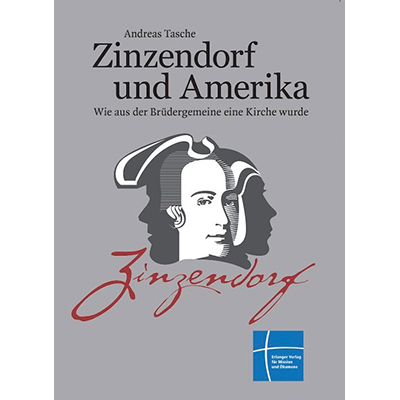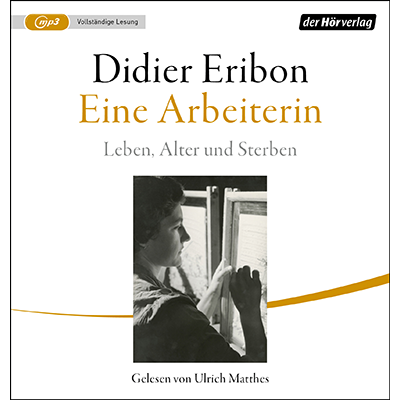Kann man „An Wasserflüssen Babylon(s)“ Zionslieder singen? Wäre solcher Gesang, ohne Zion und Tempel, fern von Heimat und Tradition, dafür unter der Fuchtel spottender Schergen, mehr als Demütigung, Folter und Qual, am Ende gar Bekenntnis und Gebet?
Man kann, wie Psalm 137 beweist. Ja, man kann sogar mit vorher nie vernommener Eindringlichkeit, weil ohne verfassten Rahmen, ganz ohne Ordnung und deren Hüter, nur bleibt, was unverlierbar in Herz, Hirn und Haut eingeprägt ist: Wie viel biblische poiesis hat sich im Exil, in der Wüste, im institutionellen Niemandsland zu Wort gemeldet! Ganz ohne das hütende Gewölbe einer Kathedrale und die gnädige Geste eines Bischofs! Ohne solche Schriften keine Bibel. Auch der Choral von 1525 hatte, als er seinen Siegeszug durch alle protestantischen Gesangbücher antrat, noch kein institutionell gesichertes Dach über dem Kopf.
Ähnlich ergeht es der afroamerikanisch entstandenen und mittlerweile weltweit vernetzten Musiksprache des Jazz. Dass sie oft auch spirituell geleitet ist, zuweilen gar individuelle Glaubenssprache, weist der Berliner Saxophonist und Komponist Uwe Steinmetz eindringlich und mit hörbaren Beispielen nach: Was 2021 in seiner Göteborger Dissertation Jazz in Worship and Worship in Jazz akademischen Regeln folgen musste (vergleiche zeitzeichen 1/2023), ist nun, lesbar in Sprache und Umfang, allen erreichbar, die Jazz als inspirierte und Klang werdende Sehnsucht nach dem ganz Anderen hören wollen. Fünfzig QR-Codes (und das eigene Smartphone) ermöglichen nahezu unmittelbar ein Hineinhören ins soeben Gelesene.
Die Architektur der 167 Seiten folgt barocker Spiegelsymmetrie: Tord Gustavsens anfänglichem Pädoyer für die Rolle des Jazzmusikers als eines Mitgestaltenden an einem Stück des Himmelreichs korrespondieren am Schluss hilfreiche Listen mit sehr vielen Einspielungen derart Mitgestaltender. Der euphorischen Einstimmung von Steinmetz antwortet der Ausklang mit seiner Variante des Soli Deo Gloria. Zum Auftakt meditiert er die Kunst des Hörens als Bedingung, das Andere zu vernehmen, und im Nachklang die Realität einer Musiksprache, die überall und nirgends zu Hause ist.
Drei große Kapitel mit den Titeln Fire, Truth, Prayer bilden das Zentrum mit einer Geschichte des Sehnsucht formulierenden Jazz von etwa 1850-2020. In der Mitte steht also Truth, die Wahrheit: Gottes, des Menschen und der musikalischen Kommunikation über sie.
Vor wenigen Wochen stand ich in Venedig, ohne sie eigentlich gesucht zu haben, plötzlich vor zwei Gräbern: in Santa Maria Gloriosa dei Frari an dem Claudio Monteverdis, eines Vaters europäischer Tonsprache, und in Madonna dell‘Orto an dem Jacopo Tintorettos, eines Vaters europäischer Bildsprache. Frische Schnittblumen lagen auf ihren Grabplatten. Zweifellos haben sie das verdient. Ihr Zion war ihr Auftraggeber, und ihr Tempel wurde ihr bleibendes Gewölbe. Und doch, warum nur tun sich die Kirchen europäischer Weißer, deren Herkunft gewaltige Migrationshintergründe aufweist und die einst wussten, wie man in kritischen Zeiten „By the rivers of Babylon“ singt, so schwer damit, die Musiksprache des Jazz ehrlich zu integrieren, wo es Menschen mit Ohren für sie gibt?
Mit einem Jazzgottesdienst im Monat, einer Jazzkirche in jeder Großstadt, einem Lehrstuhl an einer Fakultät? Woran liegt es? Der Praktiker und Theoretiker mit dem besten Wissen davon ist, wie figura zeigt, ja vorhanden. Erfahrungen dazu sind an vielen Orten gesammelt. Kongresse darüber dokumentiert. Netzwerke geknüpft. Monteverdi würde begeistert auf seiner Gambe improvisieren und Tintoretto seinem auferstehenden Christus in der Accademia ein Saxophon in die Hand malen …
Möge dieses Buch Studierenden weltoffener Kirchenmusik und Theologie zum Standardwerk werden und mit seinen fünfzig QR-Codes allen Verantwortlichen für Zion und Tempel in den Ohren liegen, ohne Unterlass.
Matthias Krieg
Matthias Krieg ist Theologe und Autor. Er lebt in Zürich.