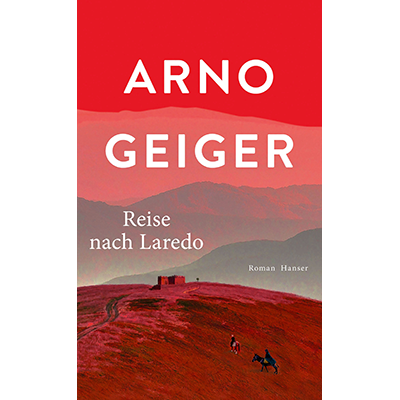"Der Tod könnte schön sein, wenn man gelebt hat“, denkt sich Karl, „der Privatmann“, zu Beginn von Arno Geigers neuem Roman Reise nach Laredo. Er sei „gut darin, Dinge nicht zu beachten“, heißt es von ihm außerdem. Karl war die längste Zeit eine öffentliche Person, denn diese Hauptfigur ist niemand anderes als Karl V., habsburgischer Kaiser des Heiligen Römischen Reiches, zudem König von Spanien und damit auch der neuen Kolonien in Amerika. Nun ist der im Jahr 1500 geborene Karl 58 Jahre alt, schwer krank und sieht seinem Ende entgegen. Vor zwei Jahren hat er abgedankt und sein Reich aufgeteilt zwischen seinem Sohn Philipp und dem Bruder Ferdinand. Er lebt im Kloster Yuste in Spanien, hat noch Bedienstete, aber keinen Hofstaat mehr. Und er hat Zeit zum Nachdenken und zum Träumen, wozu ihm das Opiat Laudanum verhilft. Er verstehe sich nicht und begreife sich nicht, schreibt Geiger. Und er ist mürrisch – was sein Beichtvater einmal so eingeordnet hat: „In jedem Menschen stecke ein zurückgetretener König (…), deshalb seien die Menschen so mürrisch.“
Ist Karl nicht nur ein ehemaliger König, sondern auch ein ganz normaler Mensch? Das ist die Ausgangsfrage des historische Fakten und Fiktionen munter kombinierenden Buches, und es ist die Leitfrage für Karl, der noch einmal wirklich leben oder überhaupt erstmals erfahren will, wie sich Leben eigentlich anfühlt – und der womöglich erst dadurch wirklich majestätisch würde. Man mag sich durch diesen Kontext an eines von Geigers schönsten und erfolgreichsten Büchern erinnern, Der alte König in seinem Exil, in dem der Autor von seinem dementen, jedoch noch vitalen Vater erzählte. Aber Geiger versucht im Grunde ja immer, das Besondere des Daseins in Worte zu fassen und buchstäblich erfahrbar zu machen.
Karl, der immer herrschte und verfügte und der nun ratlos ist – er wird bei Geiger zum exemplarischen Menschen; außergewöhnlich sind schließlich alle. Den zeitlichen Horizont hüllt Geiger in historischen Nebel. Namen und Ereignisse werden erwähnt, die verbürgt sind, aber auch für Allgemeines stehen. Seine verstorbene Frau Isabel ist für Karl die Gattin, die er vermisst und mit der er im Geiste spricht. Der Maler Tizian hat ihn porträtiert und ist auch ein exemplarischer Künstler. Und die Fragen um Gott und die Welt, die Karl in Gedanken aufwirft, rühren zwar von der Schwellenzeit zwischen Mittelalter und Neuzeit her, sind aber überzeitlich.
Karl wünscht sich, nach Laredo an die Nordküste zu reisen. Und eines Nachts, am Beginn eines neuen Kapitels, scheint er wirklich aufzubrechen, in Begleitung des elfjährigen Geronimo, der ein illegitimer Sohn von ihm ist. Führen lassen sich die beiden, die einen an Don Quijote und Sancho Pansa erinnern können, dann vom Geschwisterpaar Honza und Angelita, zwei Angehörige einer diskriminierten Bevölkerungsgruppe. Gemeinsam kommen die vier unterschiedlichen Personen gut voran. „Das also ist das Leben“, denkt sich Karl unterwegs und lernt, den Augenblick zu schätzen, das einfache, unverstellte Dasein. Vielleicht träumt er das alles aber auch nur. So oder so: Das Ganze ist eine Erzählung, ein Roman. Und die Geschichte der Reise wird nicht umsonst in der geläufigen Erzählzeit des Imperfekts geschildert, während Anfang und Ende des Romans im Präsens stehen.
Der Schriftsteller hat einmal mehr ein fesselndes und bewegendes Buch geschrieben. Die Sprache ist treffend, gewandt, wirkt dabei aber fast schlicht. Geiger spiegelt in seiner Geschichte aus der frühen Neuzeit die Gegenwart und hebt alles ins Überzeitliche. Eine Ermunterung ist das Buch ohnedies: Man sollte leben wie ein zurückgetretener König, allerdings ohne mürrisch zu sein.
Thomas Groß
Thomas Groß ist Kulturredakteur des Mannheimer Morgen.