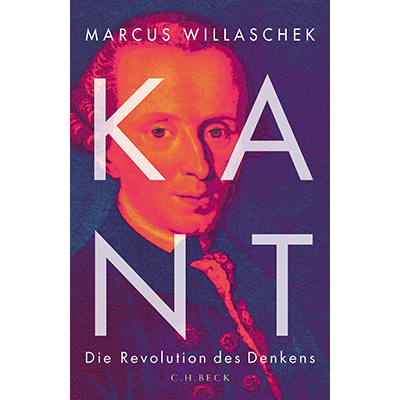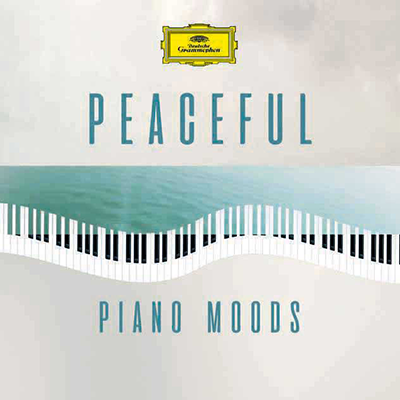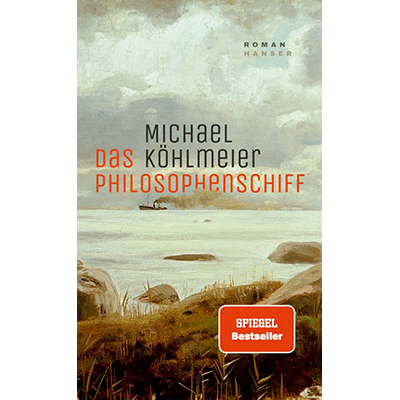"Wie sind synthetische Urteile a priori möglich?“ – das ist die Kardinalfrage der Kritik der reinen Vernunft Immanuel Kants. Den Meisten dürfte die Frage unverständlich sein – schon ihre Bedeutung klar zu machen, ist eine nicht geringe Herausforderung für einen, der sich heute auf den Weg macht, die Grundzüge des kantschen Denkens zu vermitteln. Martin Willaschek hat das Wagnis unternommen, und natürlich hat er sehr viel mehr zu erläutern als jene Frage. Sie ist übrigens gar nicht so kompliziert: Können wir Urteile ohne jede Anschauung (Erfahrung) als gültig annehmen? Ja, sagt Kant, und verweist zum Beispiel auf die Mathematik und die Newtonsche Mechanik. – Aber ach! Die ganze Theologie der Zeit beruhte auf der Annahme, dass man Gott, die Unsterblichkeit, die Seele als begründbare Fakten ansehen dürfe und müsse. Aber nach Kant handelt es sich bei allen Aussagen darüber um jene synthetischen Urteile a priori – nur, dass diese in metaphysischen Dingen mangels Anschauung nicht möglich sind. Allerdings: An Gott zu glauben sei ein Gebot der praktischen Vernunft, so Kant – wohl um das, was die neueren Philosophen den „regressus ad infinitum“ – das ewige Noch-einmal-Zurückfragen – nannten, abzuschließen.
Aber Willaschek steigt anders ein: „Das höchste politische Gut. Der ‚ewige‘ Frieden“. Eine Überraschung, weil die Schrift Zum ewigen Frieden eine von Kants kleineren Schriften jenseits des Riesenmassivs der Kritik der reinen Vernunft ist. Zudem ist sie recht spät entstanden, 1795. Auch hebt Kant in einem auch vom Autor nicht überhörten ironischen Ton an, der wohl eine Spitze gegen die preußische Zensur war: Der Titel dieser Schrift, so Kant, nimmt auf eine Gastwirtschaft Bezug, die ihren Namen – eben „Zum ewigen Frieden“ – ihrer Nähe zum Friedhof verdankte.
Aber diese Schrift, irgendeine Schrift zur politischen Zeitlage, wurde seit der Französischen Revolution vom Königsberger Starphilosophen erwartet. Nun also war sie da und erläuterte nichts weniger als die Bedingungen zu einem (relativ) ewigen Frieden. Wie immer argumentierte der Philosoph akribisch und logisch, aber allein die von ihm angeführte Bedingung eines Weltstaates, nebst der ironischen Eröffnung, lässt zumindest den Verdacht aufkommen, dass er selbst wenig an das Kommen dieses Friedens in irgendeiner absehbaren Zukunft glaubte – zumal bei der von ihm angenommenen „Boshaftigkeit des Menschengeschlechts“, eine Überzeugung, die ihn von dem von ihm verehrten Rousseau unterschied.
Doch immerhin hat Kant immer wieder von der prinzipiellen Unabschließbarkeit des Projektes Aufklärung gesprochen – und daran hält auch Willaschek nachdrücklich fest, denn schließlich bedeutet das, dass zumindest die Kundigen in der Gegenwart aufklärungsmäßig weiter sind als Kant und seine Zeitgenossen – und daher natürlich vieles besser wissen. Es fällt auf, dass der renommierte Kantforscher Willaschek überall da, wo die Nichtübereinstimmung Kants mit gegenwärtigen Meinungen oder Erkenntnissen nicht mehr zu leugnen ist, sie dahingestellt sein lässt oder sie auf die Zeitgebundenheit schiebt, der natürlich auch Kant nicht entkommen sei.
Aber wie dem auch sei: Diese Einführung führt zuverlässig und – soweit das möglich ist (es ist dies nicht immer) – leichtverständlich in das Werk Immanuel Kants (1724–1804) ein; die drei Revolutionen, die Willaschek in Kants Entwicklung ausmacht (die der Gesinnung, die der Denkungsart und die Französische Revolution) befördern bis auf den heutigen Tag – trotz aller Bedrohungen, die die gegenwärtigen Zeitläufte so nachdrücklich vor Augen führen und die auch Willaschek nicht verschweigt – die Zuversicht, dass die Vernunft auch zukünftig den Weg in eine allmählich bessere Welt weist.
Helmut Kremers
war bis 2014 Chefredakteur der "Zeitzeichen". Er lebt in Düsseldorf. Weitere Informationen unter www.helmut-kremers.de .