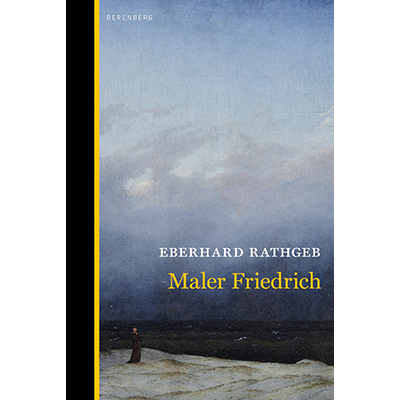Die Gedanken zu den Sonntagspredigten für die nächsten Wochen stammen von Jürgen Kasiser. Er ist Pfarrer i.R. in Stuttgart.
Wie die Liebe
19. Sonntag nach Trinitatis, 15. Oktober
Des Gerechten Gebet vermag viel, wenn es ernstlich ist. (Jakobus 5,16)
Die Anfänge des Christentums sind eine Erfolgsgeschichte. Von Jerusalem aus entstanden rund ums Mittelmeer in Europa und Afrika kleine christliche Gemeinden. Sie fußten auf unterschiedlichen Traditionen, hatten jüdische, jüdisch-hellenistische, paulinische, petrinische und johanneische Wurzeln – um nur die Haupttraditionen zu nennen. Dazu traten jede Menge Sonderentwicklungen durch ständig neue geistige und geistliche Einflüsse.
Der Verfasser des Jakobusbriefes setzte sich mit Entwicklungen in judenchristlichen Gemeinden Europas um die Jahrhundertwende auseinander, die ihm missfielen: In den Gemeinden kam es zum Streit zwischen Armen und Reichen. Offensichtlich hoben viele Gemeindeglieder geistlich ab und vernachlässigten die praktische Barmherzigkeit. Deshalb betont der Verfasser des Jakobusbriefes, dass zum Glauben gute Werke gehören. Aber gerade deshalb missfiel Martin Luther der Jakobusbrief, und er nannte ihn eine „stroherne Epistel“.
Doch wenn der persönliche Glaube keine praktischen Auswirkungen im Alltag hat, taugt er nicht viel. Nur geistlich wären gute Werke zu wenig. Aber für den Jakobusbrief ist das Gebet die Klammer, die alles zusammenhält. Deshalb fordert er, für die Kranken, die Sünder und die Irrenden zu beten.
„Das Gebet ist das Reden des Herzens mit Gott!“, lernte ich im Konfirmandenunterricht. Und das leuchtete mir ein. Es drückt eine Liebesbeziehung aus – zwischen Gott und mir und daraus folgend zwischen mir und Gott. Das Bild der Liebenden illustriert also gut den Charakter des Gebets. In ihm lässt sich alles sagen, bekennen, gestehen, vergeben und vertrauen. Und darauf lässt sich ein Leben aufbauen. Zum Anfassen gibt es da zwar nichts, aber gerade deshalb ist das Gebet so mächtig wie die Freundschaft, die Liebe, das Vertrauen, der Glaube. Dem Wort eines Freundes vertraue ich und treffe daraufhin eigene Lebensentscheidungen. Und so mächtig wie das Phänomen Freundschaft ist auch das Gebet.
Nichts verstanden
20. Sonntag nach Trinitatis, 22. Oktober
Jesus … sprach zu ihnen: Lasset die Kinder zu mir kommen und wehret ihnen nicht, denn solchen gehört das Reich Gottes. Wahrlich, ich sage euch: wer das Reich Gottes nicht empfängt wie ein Kind, der wird nicht hineinkommen. (Markus 10,14–15)
Viele Geschichten um Jesus haben eine Botschaft: Da wollen Menschen zu Jesus, die ihn brauchen, weil er ein Kümmerer, der Lichtblick, ihr Heiler ist. Und dazwischen stehen – wie eine Barriere – diejenigen, die meinen, dass sie Pulver und Rad zugleich erfunden haben, die genau wissen, was richtig ist und wie es zu gehen hat.
In der Überlieferung des Matthäusevangeliums sind es die Pharisäer und Schriftgelehrten und bei Markus die Jünger. Sie benehmen sich wie die Bodyguards des Herrn und verjagen Frauen und Kinder. Die haben in der Öffentlichkeit nichts zu melden und nach Überzeugung der Jünger bei Jesus nichts zu suchen, erst recht nicht, wenn dieser sich mit bedeutenden Männern unterhält.
Aber weit gefehlt: Sie bekommen den Ärger ihres Herrn ab – und zugleich noch eine Lektion fürs Leben. Kinder bringen zunächst einmal ihren Eltern ein Grundvertrauen entgegen. Nur so können sie leben. Und um dasselbe Grundvertrauen geht es auch im Verhältnis zu Gott.
Gott hat Vertrauen zu uns Menschen. Sonst wäre er nicht als hilfloses Baby in einem dreckigen Stall in der Fremde auf die Welt gekommen. Aber die Jünger haben nichts verstanden. Das zeigt das Markusevangelium immer wieder in seinen Geschichten.
Aber auch wir Christen in Deutschland haben nichts kapiert. Während unser Herr Jesus Christus den Wert der Kinder hochhält und sie wichtig nimmt, stehen wir blamiert da. Wo haben wir Christen aufgeschrien, als während der Coronazeit die Lebensbedürfnisse von Kindern und Jugendlichen keine Rolle spielten? Schule, Kindergärten, Kinderkrippen – alle wurden dichtgemacht und die Eltern mit ihren Problemen allein gelassen.
Kinder kommen auch im Grundgesetz nur als Teil der Familie vor. Sie haben keine eigenen Rechte. Und dafür gibt es auch keine Mehrheiten. Drei Millionen Kinder sind in unserem Land aktuell von Armut betroffen. Mit der Kindergrundsicherung würde ein wichtiger Schritt getan werden, um ihnen zu helfen. Reiche Eltern haben beim Elterngeld eine Lobby. Arme Kinder dagegen nicht.
Jesus herzt die Kinder. Das zeigen viele kitschige Bilder. Dabei könnte der Text, der da illustriert wird, Christen veranlassen, den Mund aufzumachen. Für die Kinder. Und das wäre im Sinn des Herrn.
Mobiler Glaube
21. Sonntag nach Trinitatis, 29. Oktober
Denn all das Land, das du siehst, will ich dir geben und deinen Nachkommen ewiglich. Und ich will deine Nachkommen machen wie den Staub auf Erden. Kann ein Mensch den Staub auf Erden zählen, der wird auch deine Nachkommen zählen.(1. Mose 13,15–16)
Entweder nimmt man die Bibel wörtlich – oder ernst“. Diese Erkenntnis wird dem jüdischen Theologen Pinchas Lapide (1922–1997) zugeschrieben. Der Abschnitt aus dem Ersten Mosebuch ist durchaus aktuell. Denn auf ihn berufen sich nicht wenige jüdische Siedler im von Israel besetzten Westjordanland.
In der „Babylonischen Gefangenschaft“ standen jüdische Theologen vor einem gewaltigen Problem. Denn die Gefangenschaft war eigentlich keine. Die Mittel- und Oberschicht der Israeliten waren zwar aus ihrem Land verschleppt worden und mussten sich zwischen Euphrat und Tigris aufhalten. Aber ihnen stand dort sogar der Staatsdienst offen. Vor ein paar Jahren wurde das Grab eines jüdischen Generals der babylonischen Armee gefunden.
In diesem Umfeld gaben viele Juden ihre Identität auf. Sie vermischten sich mit den Babyloniern. Und als die sogenannte Gefangenschaft vorbei war, blieben deshalb viele im Land, kehrten also nicht in das „Gelobte Land“ zurück.
Diese Zeit gilt als Geburtsstunde der jüdischen Theologie. Sie wollte einen Identitätsverlust der Israeliten verhindern. Also wurden die alten Berichte gesammelt und – das Alte Testament entstand. Der Tempel in Jerusalem war zerstört, aber es entstanden Synagogen.
Weil die Rückbesinnung auf die eigenen Wurzeln überlebenswichtig wurde, wurden die mündlichen Überlieferungen gesammelt und verschriftlicht. Die fünf Bücher Mose entstanden, die Tora, der Pentateuch. Der Stammvater Abraham spielte dabei eine überragende Rolle. Denn die Geschichten über ihn eröffneten einen Blick auf die Zukunft. Das Land Israel war verloren gegangen. Aber Abraham war die Landnahme versprochen worden. Schiedlich-friedlich geteilt, wie in unserem Predigttext von Abraham und Lot. Kleiner Gag am Rande: Lot suchte den optisch besseren Teil, den einfacheren Weg, der nach Sodom und Gomorrha führte. Der schwerere Weg, Abrahams Weg, war hingegen ein Versprechen auf die Zukunft.
Das Volk Israel war in seinem Bestand gefährdet, es fehlten die Menschen. Aber Abraham erhielt das Versprechen auf zahlreiche Nachkommen. Mit dem Tempel war das Heiligtum verschwunden, es gab keine kultischen Orte mehr. Aber der umherwandernde Nomade Abraham war das Beispiel dafür, dass die Gegenwart Gottes nicht im Kult liegt, sondern im Glauben.
So entstand eine Theologie des Glaubens, nicht des Kultes und – eine Hoffnung, die man, wie den Glauben, überall hin mitnehmen kann. Religionen, die auf Kulte aufbauen, verschwinden, wenn die Orte zerstört werden. Das Phänomen Glaube kann dagegen selbst durch (militärische) Gewalt nicht besiegt werden.
Gott zum Anfassen
22. Sonntag nach Trinitatis, 5. November
Liebe Kinder, ich schreibe euch, dass euch die Sünden vergeben sind um seines Namens willen. Ich schreibe euch Vätern; denn ihr habt den erkannt, der von Anfang an ist. Ich schreibe euch jungen Männern; denn ihr habt den Bösen überwunden. Ich habe euch Kindern geschrieben; denn ihr habt den Vater erkannt, der von Anfang an ist. Ich habe euch jungen Männern geschrieben; denn ihr seid stark, und das Wort Gottes bleibt in euch, und ihr habt den Bösen überwunden. (1. Johannes 2,12–14)
Und wer schreibt den Frauen und Mädchen? Jedenfalls nicht der Verfasser des Ersten Johannesbriefes. Denn wir befinden uns bereits im Frühkatholizismus, also um 100 bis 110 nach Christus. Vorbei die Berufung allein durch den Geist, auch von Frauen, wie es noch Paulus verkündet hatte. Vorbei die Rolle der ersten Christinnen in Europa, wie der Purpurhändlerin Lydia (Apostelgeschichte 16). Es ist bereits eingetroffen, was ein römisch-katholischer Weihbischof einmal so formulierte: „Jesus hat uns das Dienen gelernt. Wir Männer haben es erfolgreich an die Frauen weiter delegiert!“
Der Verfasser des Johannesbriefes kommt und lebt aus der johanneischen Tradition. Und in den christlichen Gemeinden, die sich an Johannes orientierten, nicht an Paulus oder Petrus, wurde schon immer der Geist betont. Hier war der logos wichtig, das Wort, das Fleisch wurde. Und dieser logos war das Einfallstor für die gesamte hellenistische Philosophie in das Christentum. Hier konnte der christliche Glaube andocken und wurde hellenisiert. Das ermöglichte einerseits den Missionserfolg in der Welt um das Mittelmeer. Aber zugleich entstand eine große Herausforderung. Denn je mehr das Geistige betont wurde, umso mehr geriet in Vergessenheit, dass dieser logos ja Fleisch wurde und unter den Menschen als Gott zum Anfassen gelebt hatte. Sprich: die Menschwerdung Gottes und der Tod des Jesus von Nazareth spielten immer weniger eine Rolle. Mit anderen Worten: Es ging nicht mehr um einen in der Welt praktizierten Glauben, sondern nur noch um Geisterfülltheit.
Aus dieser Geisteswelt kommt der Verfasser des Johannesbriefs. Und er hat sichtlich Mühe, sich mit den Radikalen in seinen Gemeinden auseinanderzusetzen. Denn ihnen geht es nur noch um Geisteserfülltheit, nicht mehr um das Umsetzen des Glaubens im Alltag der Gemeinde und in der Welt. Pointiert gesagt: Ab einem gewissen Grad von Geisterfülltheit wird das irdische Leben belanglos und die christliche Ethik bedeutungslos. Anders gesagt: Wer das Richtige glaubt, kann leben, wie er will.
Der Verfasser des Johannesbriefes schreibt seinen eigenen Leuten. Und er kommt dabei ziemlich ins Rudern. Vielleicht hätte er die Frauen seiner Gemeinde fragen und ihnen zuhören sollen. Dann hätte er vielleicht etwas gehört vom geistigen Leben in irdischen Banden.