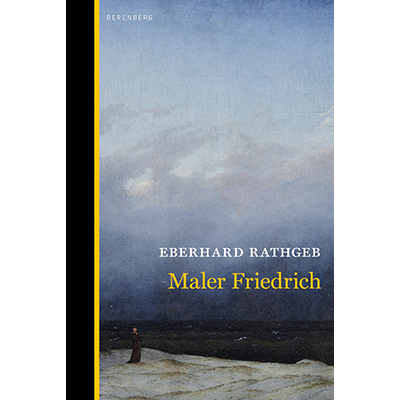Steinerne Propheten
Die Reaktionen auf zwei öffentliche Zurschaustellungen von Religion in den vergangenen Tagen geben mir zu denken. Da wäre zunächst einmal die Re-Installation von acht Prophetenfiguren auf der Balustrade der „Schlossattrappe“ im Zentrum der Hauptstadt. Die alttestamentlichen Propheten Jesaja, Hosea, Zephania, Zacharias, Jonas, Daniel, Jeremias und Hesekiel sind dort wieder zum Stehen gekommen, in „originalgetreuer“ Façon, zumindest teilweise ermöglicht durch die Spenden von Preußen-Fans, erzkonservativen und rechtsradikalen Spender:innen.
Die Wiederaufstellung der Prophetenfiguren wird von antifaschistischen Aktivist:innen scharf kritisiert. Die neuerliche Debatte um das Hohenzollernschloss angestoßen hat Philipp Oswalt, Professor für Architekturtheorie in Kassel, mit einem lesenswerten Gastbeitrag in der ZEIT (€), einem Ausschnitt aus seinem neuen Buch „Bauen am nationalen Haus. Architektur als Identitätspolitik“ (Berenberg Verlag). In die – in meinen Augen sehr berechtigte – Kritik an der Schlosswiederherstellung samt Kuppel und Statuenrepliken mischt sich auf Seiten der linken Kritiker:innen aber auch eine seltsame Missachtung der Religion und religiösen Geschichte der Prophetengestalten.
Ohrfeige für die Propheten
So war – zumindest zeitweise – von „alttestamentarischen“ Propheten die Rede, bevor u.a. die Redaktion der taz diesen Lapsus linguae auswetzte. Den Hinweis darauf, dass es sich bei Jesaja & Co. zunächst und auch weiterhin um jüdische Propheten handelt, wies z.B. Max Czollek empört zurück, als ob mit ihm automatisch eine Legitimation des eindeutig identitär preußisch-christlichen Projektes intendiert sein muss. Wer heute über Hosea, Jona, Daniel spricht, ohne auch eine jüdische Perspektive geltend zu machen, der wiederholt die christliche Enteignungsgeschichte. Das gilt für die einfallslosen steinernen Repliken ebenso wie für ihre Kritiker:innen, wenn sie simplifizierend von „christlichen Propheten“ schreiben oder reden.
Jenseits ihrer spezifischen Religionszugehörigkeit ist die Wiederaufstellung ohnehin eine Ohrfeige für die Herren Propheten. Ein Prophet, dem man ein Denkmal auf einem Schloss baut, ist gescheitert. Jeremia und Jesaja auf den Zinnen einer Zitadelle der Macht? Glückwunsch an diejenigen, die ihre prophetischen Worte auch heute noch tatkräftig überhören, ihre Machtkritik und nicht zuletzt auch ihre Kritik an der institutionalisierten Religion!
Große Langeweile
Den Propheten hätte man wohl einzig dadurch Ehre erwiesen, wenn man es gewagt hätte, statt möglichst „orginalgetreuer“ Repliken Neukreationen auf das Schloss zu stellen. Was hätten wohl acht lebendige Bildhauer:innen zustande gebracht, die man ohne weitere Vorgaben an den Propheten-Plastiken hätte arbeiten lassen können? Stattdessen wurde nach Fotovorlage gemeißelt.
Der ganze Vorgang ist würdig einer Schlossrekonstruktion, die als ganzes unkreativ, uninspiriert, eben restaurativ ist. Man muss ja dankbar sein für die schlichte (auch ziemlich geistlose) Ostflanke des Gebäudes, die als einziges Element der Fassade die Inszenierung von dumpf dröhnendem Historismus bricht. Das ganze Ensemble kommt so phantasielos daher, dass ich mich – wann immer ich Berlin bereisend der U-Bahnstation Museumsinsel entsteige und am Westportal empor gucken muss – von Besuch zu Besuch immer weniger empören kann. Stattdessen große Langeweile.
Doch zurück zu den Propheten. Sie sollen ein Mahnmal der christlichen Geschichte des Ortes. Damit sind sie ein trauriges Überbleibsel. Im Sprichwort gesprochen: Nichts anderes als Asche, der jeder Funkenschlag abgeht. Die eigentlich religiösen Deutungsebenen bleiben unter dem restaurativen Anliegen ihrer Reinstallation und dem areligiösen und tendenziell anti-religiösen Protest gegen dieselbe verschüttet.
Rüdigers Geste
Quicklebendig hingegen ist Antonio Rüdiger, Fußballspieler bei Real Madrid und in der Deutschen Nationalmannschaft. Er ließ sich anlässlich des Ramadan beim Gebet ablichten. Auf dem Foto erhebt er die rechte Hand mit ausgestrecktem Zeigefinger zur Tauhīd-Geste. Der rechtsradikale Medienschaffende Julian Reichelt (ehem. Chefredakteur der BILD) nahm das Foto zum Anlass, Rüdiger als „Islamisten“ zu beschimpfen. Die Geste sei ein allseits bekannter „Islamistengruß“, vor dem der Verfassungschutz als „IS-Finger“ warne. Alles daran ist falsch. Die rechten Trolle auf X (ehem. Twitter) und in anderen Schmuddelecken des Netzes drehten natürlich trotzdem frei.
Andere Medien sprangen selbstverständlich auf den fahrenden Zug auf: Vorgeblich berichteten sie über die entstandene Aufregung, breiteten Reichelts Hetze aus. Später gab es dann Erklärstücke, die in die Gebetstraditionen der Muslime einführten. Wir kennen die Mechanik solcher Empörungsdebatten ja zur Genüge. Und ein bisschen Schmutz wird an Rüdiger schon hängen geblieben sein, wie es bei muslimischen Nationalspielern in Deutschland Tradition hat.
Dass stramm-rechte Hetzer eher nicht zu den Liebhabern der gediegenen Hermeneutik religiöser Artefakte gehören, ist wenig überraschend. Man darf sich da von den Abendland-Gesängen nicht täuschen lassen. Interessanter ist gleichwohl, dass durch solche „Debatten“ Vorurteile gegenüber Muslimen und ihren religiösen Praktiken ventiliert und damit aktualisiert werden. „Die Muslime“ sollen nicht dazugehören, ihre Traditionen werden als „fremd“ markiert. Und in irgendeinem stillen Kämmerlein bekreuzigen sich ein paar fromme Katholiken und Berneuchener, weil es ihnen langsam dämmert, dass ganz vielleicht nicht nur die Muslime gemeint sind, wenn gegen Gebetsgesten Front gemacht wird.
Der Mehrheit wumpe
Der großen Mehrheit der Menschen in Deutschland sind sowohl die Tauhīd-Geste Antonio Rüdigers als auch die Propheten-Statuen auf dem Berliner Schloss wumpe. Wie schön wäre es, wenn wir es doch alle wie Rüdigers Familie halten würden, von der er – ausgerechnet der BILD – sagt: „Viele meiner Familienmitglieder gehören unterschiedlichen Religionen an. Dennoch respektieren wir einander und feiern gemeinsam religiöse Feste. Respekt und Toleranz sind grundlegende Prinzipien, die wir alle vertreten in unserer Familie.“
Üblicherweise aber wird man wohl auf Familien treffen, die nicht (mehr) religiös sind, die folglich auch keine (verschiedenen) religiösen Feste begehen, zu denen sie einander einladen können, und die vor Propheten-Statuen ratlos herumstehen. Wenn das mit der Säkularisierung so weiter geht, feiern bald nur noch ein paar wenige Moschee-Besucher:innen mit den evangelischen Würdenträger:innen Fastenbrechen, die sich alljährlich während des Ramadan so demonstrativ über die Einladungen ihre Nachbarn freuen. Wie weit her wird es dann noch mit „Respekt und Toleranz“ sein?
So jedenfalls die Dystopie derjenigen, die Religion allgemein im Verschwinden begriffen sehen. Diese Kolumne will sich aber überhaupt nicht in die laufenden Debatten um die 6. Kirchenmitgliedschaftsuntersuchung der EKD einmischen, in denen es ja u.a. darum geht, ob es messbare Religiosität ohne Kirche (ohne Religionsinstitution) wirklich gibt. Ich will die beiden Momente demonstrativer Religionsdarstellung stattdessen ganz optimistisch positiv verstehen. Nämlich als Zeichen dafür, dass religiöse Praktiken nur dann auf Verständnis hoffen dürfen, wenn auch jemand da ist, der sie glaubwürdig verkörpert und erklären kann.
Eigentümliche Ehrfurcht
Ich glaube, Max Weber hat sich selbst als religiös unmusikalisch bezeichnet, weil er sich der Religion nicht von „innen“ her, sondern nur von „außen“ zu nähern können glaubte. Umgangssprachlich werden mit dem Attribut solche Zeitgenoss:innen beschrieben, die in die Melodien des Glaubens nicht einstimmen können, weil sie ihnen unvertraut sind. Wo ich wohne, im Osten der Republik, geht es den meisten Menschen so. Einige von ihnen stehen der Musik, so sie ihnen denn zu Gehör gebracht wird, trotzdem nicht gleichgültig, sondern durchaus neugierig gegenüber. Manchmal mit einer eigentümlichen Ehrfurcht, die den Geübten fremd ist. Jedenfalls kann ich dem Diktum von Wolf Krötke nicht zustimmen, nach dem „die Menschen auch schon zu vergessen beginnen, dass sie Gott vergessen haben“.
Wirksam für Andere wird Religiosität aber dann, wenn sie sich zumindest gelegentlich mal explizit macht, wenn wir versuchen auszudrücken, was unsere Herzen rührt. Und damit zurück zum Propheten Hesekiel. Durch ihn richtet Gott seinem Volk, das er unter die Heiden zerstreut hat, aus, dass er es wieder aus den Völkern zusammenbringen und aus den Ländern sammeln will, um ihnen das Land Israel zu geben. Und noch mehr: „Ich will ihnen ein anderes Herz geben und einen neuen Geist in sie geben und will das steinerne Herz wegnehmen aus ihrem Leibe und ihnen ein fleischernes Herz geben.“ (Hesekiel 11, 19)
Sollten tatsächlich ein paar steinerne Statuetten Zeichen der Christ:innen in unserem Land sein? Oder müssten nicht gerade jene Widerspruch gegen eine solche hohle Geste einlegen, die doch ein „Brief Christi“ sein sollen, wie es Paulus in Anspielung an Hesekiel schreibt, „geschrieben nicht mit Tinte, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes, nicht auf steinerne Tafeln, sondern auf fleischerne Tafeln der Herzen“? (2. Kor 3, 3) Aber vielleicht ist es auch nur mein frommer Wunsch, dass ein paar Christ:innen ihre Hände erheben und den Statuen und ihrem versteinerten Christentum eine kreative Intervention angedeihen lassen.
Philipp Greifenstein
Philipp Greifenstein ist freier Journalist sowie Gründer und Redakteur des Magazins für Kirche, Politik und Kultur „Die Eule“: https://eulemagazin.de