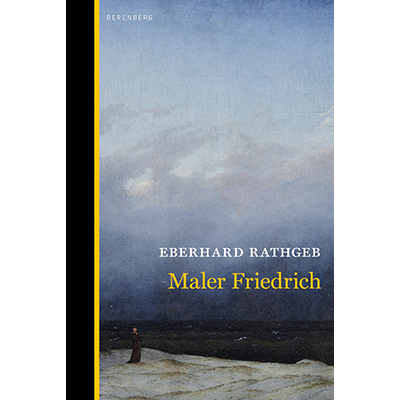„Als wären wir Gäste im eigenen Haus“

Für Christen in Israel und Palästina hat sich die Situation deutlich verschlechtert. Friedhöfe werden geschändet, Geistliche auf offener Straße angespuckt und viele sind mit Einschränkungen in ihrer Glaubenspraxis konfrontiert. Die Religionswissenschaftlerin Katja Dorothea Buck berichtet aus Jerusalem.
Die Pilger im Heiligen Land sind zurück. Das freut nicht nur die Tourismusbranche. Auch die Christen vor Ort sind froh, dass die Zeiten der coronabedingt leeren Gassen und Kirchen endlich vorbei sind. Mit 4,5 Millionen Touristen rechnet man in diesem Jahr in Israel. Schätzungsweise zwanzig Prozent werden christliche Pilger sein. Das entspricht in etwa dem Vor-Corona-Niveau.
Verschlechtert hat sich allerdings die Gesamtsituation der Christen vor Ort. Nur bekommen davon Pilgerinnen und Pilger in der Regel nichts mit. Wer sich auf den Weg macht, um die historischen Stätten des eigenen Glaubens zu besuchen, hat kaum offene Ohren für die Klagen der arabischen Glaubensgeschwister. Denn wer ihnen zuhört, muss sich mit so heiklen Themen wie Besatzung, Zionismus oder Antisemitismus auseinandersetzen.
Ganz abgesehen davon ist es alles andere als einfach, den Argumentationen von lokalen Kirchenleitenden bei undurchsichtigen Immobiliendeals zu folgen, bei denen sie selbst mit von der Partie waren. Auch ihre Deutungsmuster zu behördlichen Einschränkungen sind nicht leicht nachvollziehbar, haben diese vordergründig doch Sinn, wie zum Beispiel die neuen Brandschutzverordnungen in der Grabeskirche an Ostern. Wer wirklich verstehen will, an welchen Stellen der Schuh drückt und warum er mittlerweile so stark drückt, muss viel und immer wieder nachfragen. Aus ökumenischer Perspektive jedenfalls sollten die Klagen der Christen in Israel und Palästina nicht einfach als lästiges Hintergrundrauschen bei einem Jerusalembesuch abgetan werden.
Immerhin ist es ihnen und ihren Vorfahren zu verdanken, dass das Evangelium im Heiligen Land auch nach 2000 Jahren noch gepredigt und gelebt wird. Würde es sie nicht geben, würden nur noch Steine daran erinnern, dass Jesus und seine Jünger in diesem Landstrich einst Weltgeschichte geschrieben haben. Palästinensische Christen verstehen sich als Hüter der christlichen Tradition im Heiligen Land und ziehen daraus ihr Selbstbewusstsein. Doch genau dieses Erbe sehen sie zunehmend in Gefahr: Allein in den ersten drei Monaten dieses Jahres kam es zu mehreren Vorfällen gegen Christen. Erst die Schändung des evangelischen Friedhofs auf dem Zionsberg, bei dem am Neujahrstag dreißig Grabsteine und Steinkreuze zertrümmert wurden. Dann ein randalierender Mob von jungen Siedlern, die in der Jerusalemer Altstadt ein armenisch-christliches Restaurant auseinandernahmen. Oder der gewaltsame Überfall auf eine Gottesdienstgemeinde in der Gethsemane-Kirche Mitte März. Insgesamt zählen die Kirchenoberhäupter von Jerusalem sieben solche antichristlichen Angriffe seit Beginn des Jahres. Hinzu kommen Schmierereien auf Hauswänden wie „Tod den Christen“ oder „Tod den Arabern“.
Was ebenfalls in den vergangenen zwei bis drei Jahren stark zugenommen hat, ist das Bespucken von Geistlichen. Vor allem armenische Priester bekommen das zu spüren. Ihr Patriarchat liegt auf dem Weg vom Jaffa-Tor zur Klagemauer. „Früher ist mir das ab und zu passiert. Aber heute vergeht kein Tag mehr, an dem ich nicht bespuckt werde“, sagt Pater Aghan von der armenischen Kirche. In den sozialen Medien kursieren Videos, wie Siedler vor der Pforte des armenischen Patriarchats auf den Boden spucken, selbst wenn da gerade kein Geistlicher steht. „Wenn ich sie zur Rede stelle, ob sie sich nicht schämen, krieg ich zu hören, dass sie sogar stolz darauf seien, mich zu bespucken.“ Anzeigen bringe nicht viel. „Im Zweifelsfall sucht die Polizei die Schuld bei uns“, sagt Pater Aghan und erinnert an einen Vorfall Anfang des Jahres, als junge Siedler versuchten, die armenische Fahne vom Dach des Patriarchats zu reißen. Als es zu einem Gerangel mit armenischen Jugendlichen kam, nahmen die Polizisten am Ende diese in Haft, während sie die anderen laufen ließen. „Wir fühlen uns nicht mehr sicher“, sagt eine junge Armenierin, die an der Hebrew University studiert. „Diejenigen, die uns angreifen, meinen, sie würden etwas Bedeutendes für ihre Gemeinschaft tun. Sie haben eine Gehirnwäsche bekommen.“ An der Universität habe sie niemand auf die antichristlichen Vorfälle in der Altstadt angesprochen. Auch habe keiner ihrer israelischen Freunde auf ihre Instagram-Posts reagiert, als sie von dem Angriff auf das Patriarchat oder das armenische Restaurant berichtet habe.
Geschacher um Zutritt
Was die Christen in Israel und Palästina aber außerdem mit Sorge wahrnehmen, sind die zunehmenden Einschränkungen, die ihnen israelische Behörden bei der Ausübung ihres Glaubens auferlegen. Von den tausend Christen, die noch im Gaza-Streifen leben, hat dieses Jahr kein einziger einen Passierschein bekommen, um zum Beispiel an der großen Palmsonntagsprozession vom Ölberg in die Jerusalemer Altstadt teilzunehmen oder am Ostergottesdienst in der Grabeskirche. Auch die gut 40 000 Christen, die noch in der Westbank leben, müssen bei der israelischen Militärverwaltung einen sogenannten Permit beantragen, um die Checkpoints bei Bethlehem oder Ramallah an hohen Feiertagen passieren zu dürfen. Nicht wenige Christen hinter der Mauer waren noch nie in Jerusalem. Kein Wunder also, dass bei der großen Palmsonntagsprozession und auch bei den vielen anderen Prozessionen in der Karwoche der Großteil der Gläubigen Pilgerinnen und Pilger aus aller Welt sind und nicht einheimische Christen.
Zunehmend frustrierend ist auch das Geschacher um Zutrittszahlen zur Grabeskirche an Ostern, wenn die orthodoxe Christenheit zur Feier des Heiligen Feuers zusammenkommt. Es ist ein mehr als 1500 Jahre alter Ritus, bei dem am Samstag vor Ostern im sogenannten leeren Grab in der Grabeskirche, also dort, wo Jesu Leichnam nach der Kreuzigung gebettet worden sein soll, eine Flamme entsteht, die dann über tausende von Kerzenbündel als Osterlicht aus der Kirche und damit symbolisch in alle Welt getragen wird. „Das ist schon immer ein Fest aller Einwohner von Jerusalem gewesen“, sagt der griechisch-orthodoxe Patriarch Theophilos III. Auch Muslime seien immer dabei. „Für die Menschen ist es ein Segen, das Osterlicht weiterzugeben und in die Häuser zu bringen.“
Doch seit zwei Jahren beschränkt die Jerusalemer Polizeibehörde die Zahl derjenigen drastisch, die an dieser Feier teilnehmen dürfen. Zu gefährlich sei das Hantieren mit offenem Feuer in einem Gedränge von zehntausend Gläubigen. Ein durchaus einleuchtendes Argument, zumal die Grabeskirche nur über einen Ein- und Ausgang verfügt. Eine Massenpanik könnte hier verheerende Folgen haben. Die Kirchenführer wollen diese Vorgaben aber nicht akzeptieren, weil es den israelischen Behörden nicht zustünde, sich in Kirchenbelange in Jerusalem einzumischen. Sie verweisen auf den Status quo, also jenes Abkommen, das seit Jahrhunderten in Jerusalem gilt und das friedliche Zusammenleben der drei Weltreligionen garantieren soll. Offiziell ist das jordanische Herrscherhaus Hüter des Status quo. Doch das Recht, in der Altstadt Jerusalems bestimmen zu dürfen, was geht und was nicht, reklamiert Israel seit dem Sechstagekrieg 1967 für sich. „Mittlerweile gilt nur noch das Recht des Stärkeren“, fasst der lateinische Patriarch Pierbattista Pizzaballa die Situation zusammen. „Wir werden nur noch wie Gäste im eigenen Haus behandelt.“
Wer im Zweifelsfall der Stärkere ist, war dieses Jahr am orthodoxen Osterfest in der Altstadt mehr als augenfällig. Zahlreiche Checkpoints waren in den engen Gassen aufgebaut. Wer einen der 1500 Permits ergattert hatte, wurde auf dem Weg zur Grabeskirche mehrfach kontrolliert. Videos von Journalisten vor Ort zeigen, wie es dabei immer wieder zu Schlägereien kam. Keine gute Einstimmung auf einen Ostergottesdienst. Und palästinensische Christen fürchten nicht zu Unrecht, dass sie ihren Kindern die Freude an der Feier zum Heiligen Feuer nicht mehr weitergeben können. „Es ist absurd. Wir müssen jetzt eine Erlaubnis beantragen, damit wir an einem Gottesdienst teilnehmen können, an dem wir und unsere Vorfahren seit Jahrhunderten teilgenommen haben“, sagt Omar Haramy, griechisch-orthodoxer Christ, dessen Familie nachweislich seit den ersten Jahrhunderten zur Gemeinde in der Grabeskirche gehört.
Was vielen Christen in Israel und Palästina außerdem den Glauben an eine Zukunft im Heiligen Land nimmt, ist der Aufkauf von christlichem Grundbesitz durch Siedlerorganisationen, welche die „vollständige Judaisierung der Altstadt anstreben“, wie es Munib Younan, Altbischof der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Jordanien und im Heiligen Land, formuliert. Siebzig Prozent der Grundstücke in Jerusalem gehörten den Kirchen oder Christen. Israelisch-jüdische Organisationen wie Ateret Kohanim, die es als ihren Auftrag verstünden, Jerusalem in jüdische Hände zu bringen, böten seit Jahrzehnten große Summen selbst für die schäbigsten Häuschen, sagt Younan.
Aufkauf von Grundbesitz
Zwar gilt ein Christ, der mit dem Verkauf seiner Immobilie ein kleines oder auch großes Vermögen macht, nach wie vor als Verräter in den eigenen Reihen. Solche Deals kommen aber immer wieder vor und sind schließlich nicht illegal. Je mehr die Christen in Jerusalem aber unter Druck geraten, desto häufiger wird es zu solchen Verkäufen kommen. „Das wird auf lange Sicht die Identität Jerusalems verändern“, sagt Younan.
Wer diesen Satz verstehen will, muss wissen, dass in Jerusalem wie auch im ganzen Nahen Osten an jedem Landbesitz auch kollektive Identität hängt. Über die Jahrhunderte hat sich gezeigt, dass keine Religionsgemeinschaft eine Zukunft hat, die in diesem ethnischen, religiösen und kulturellen Flickenteppich ohne Land ist. Wird ein „christliches“ Grundstück verkauft, ist es für die gesamte Religionsgemeinschaft verloren.
Das Zentrum Jerusalem
Es ist kein Geheimnis, dass auch die Kirchen selbst immer wieder Grundbesitz verkaufen. So hat die griechisch-orthodoxe Kirche vor 18 Jahren zwei Hotels am Jaffa-Tor an Ateret Kohanim verkauft. Der damalige Finanzdezernent der Kirche sei bestochen worden, heißt es zwar aus dem Patriarchat. Und man habe dafür auch Beweise. Doch die israelischen Richter wollten diesen zweifelhaften Deal bisher trotzdem nicht annullieren. Vertrag sei Vertrag. In den Kirchen führt dies zu Palastrevolten. So musste der damalige griechisch-orthodoxe Patriarch Irenäus I. den Hut nehmen. Und unlängst wurde der Finanzchef der armenisch-apostolischen Kirche unter Schimpf und Schande aus Jerusalem gejagt und ins Exil geschickt, weil er Grund und Boden seiner Kirche an eine jüdische Siedlerorganisation verscherbelt haben soll.
Die Hände in Unschuld waschen können die Kirchen bei solchen Deals also nicht. Aber vielleicht ist die Frage nach Schuld und Verantwortung auch gar nicht so maßgeblich. Eine viel wichtigere Frage drängt sich angesichts der Gesamtsituation auf. Was wäre eigentlich, wenn eines Tages tatsächlich keine Christen mehr in Jerusalem lebten? Könnten Pilgerinnen und Pilger dann noch genauso selbstverständlich in Jerusalem Gottesdienste feiern und in Prozessionen durch die Altstadt ziehen? Der lateinische Patriarch Pizzaballa hat darauf eine klare Antwort. „Ohne Jerusalem könnt ihr auch in München, London oder Rom nicht mehr Kirche sein. Hier sind die Wurzeln Eures Glaubens. Wir gehören zusammen, weil Jerusalem für uns alle das Zentrum ist.“
Katja Dorothea Buck
Katja Dorothea Buck ist Religionswissenschaftlerin und Politologin und arbeitet seit mehr als 20 Jahren zum Thema Christen im Nahen Osten, Ökumene und Dialog.