Wissenschaft auf dem Kornmarkt
Seit längerem beschäftigt mich, dass bei vielen Menschen das Vertrauen in die Wissenschaft sinkt – das dokumentieren jedenfalls verschiedene repräsentative Umfragen für einzelne Gegenden und Gruppen unseres Landes. Diejenigen Menschen, die sich schwere Sorgen um die Zukunft machen, glauben meist auch nicht, dass Wissenschaft Lösungen für die Probleme der Welt entwickeln könnte. Meist sind diese Sorgen sehr elementar: Kann ich meine Heizung noch bezahlen? Macht die rasante Entwicklung der Künstlichen Intelligenz bald meinen Arbeitsplatz überflüssig? Drohen neue epidemisch verlaufende schwere Krankheiten und muss ein neuer Weltkrieg befürchtet werden?
Früher wurde Wissenschaft ein gewisses Grundvertrauen entgegengebracht, einzelne Wissenschaftler wurden in der Öffentlichkeit regelrecht verehrt und als weise Ratgeber nicht nur von Politikern geschätzt. Diese institutionelle wie persönliche Autorität von Wissenschaft ist in der Mediengesellschaft der Gegenwart erkennbar geschrumpft (wie übrigens bei vielen anderen gesellschaftlichen Autoritäten, beispielsweise Lehrern oder Pfarrern). Nicht zuletzt der erhebliche mediale Einfluss von populistischer Wissenschaftskritik etwa in der Corona-Pandemie hat das Vertrauen in die Wissenschaft beispielsweise in Sachsen und Thüringen noch einmal deutlich weiter erschöpft. Offenbar denken nicht wenige, dass vom öffentlichen Mainstream abweichende Positionen in der Wissenschaft unterdrückt werden, die Politik einen zu starken Einfluss auf die Wissenschaft hat und die Wissenschaft der Politik zu wenig widerspricht.
Wie bei Päpsten
Lange Zeit bestand die Kommunikationsform, mit der Wissenschaft auf diese Erosion des Vertrauens und der Autorität reagierte, aus einer relativ einseitigen Sender-Empfänger-Konstellation. Ich vergleiche sie gern, weil das Bild so einprägsam ist, mit den Ansprachen, die seit dem Mittelalter die Päpste von Balkonen an eine darunter stehende Menge richteten. Um den Balkon als Ort einer solchen Rede auszuzeichnen, wurde gern ein Teppich über das Balkongeländer geworfen und wird auch heute noch bei der zentralen Mittelloggia des Petersdoms über das Geländer geworfen, wenn der Papst redet, segnet oder sonstwie liturgisch handelt. Diskussion im Sinne einer wirklichen Aussprache ist in solchen Formaten, die alle kennen, die in der Wissenschaft arbeiten, nicht vorgesehen, sondern Information: Die, die noch nichts oder zu wenig wissen, werden informiert, die, die etwas wissen, informieren.
Aber selbst der bei uns übliche Vortrag mit Aussprache oder die inzwischen weiter verbreitete Podiumsdiskussion ist ja kein Dialog auf Augenhöhe. Ein Gespräch auf Augenhöhe entsteht dann, wenn man es nicht mit der Agenda beginnt, etwas mitzuteilen, sondern den Ausgang bei den Sorgen, Befürchtungen und Erwartungen der Gesprächspartner nimmt. Dazu gehört auch, sie an den Orten aufzusuchen, an denen sie sich gerade aufhalten und nicht zu erwarten, dass alle in die Tempel der Wissenschaft kommen. Diese Veränderung der Kommunikation von Wissenschaft hin zu Gesprächen auf Augenhöhe wird seit längerem propagiert, ist der Theorie nach Standard, aber selbstverständlich nicht ganz leicht umzusetzen. Ich habe, wenn ich ehrlich bin, im Alltag auch kaum Kontakt zu denen, die das Vertrauen in die Wissenschaft vollkommen verloren haben; man lebt als Wissenschaftler eben doch stark in den Milieus, die ähnliche Interessen pflegen.
Auf die Marktplätze
Um so mehr beschäftigt mich spätestens seit der Wahl in die Leitung der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften die Idee, mit Kolleginnen und Kollegen auf Marktplätze zu gehen und dort einfach in Gespräche auf Augenhöhe über Wissenschaft einzutreten. Ich dachte dabei nie an eine Art Evangelisationseinsatz, bei der eine Botschaft an den Mann und die Frau gebracht werden soll, und natürlich auch nicht an einen Stand einer politischen Partei vor den Wahlen, bei den Flyer und Aufkleber verteilt werden und Zustimmung zu Personen erreicht werden soll, die gewählt werden wollen.
Mir ging es, noch einmal sei es festgehalten, um Gespräche auf Augenhöhe, die ihren Ausgang bei den Sorgen und Nöten von den Menschen nehmen, von deren Steuergeldern unser Wissenschaftssystem finanziert wird. Realisiert wurde dieser mein Wunschtraum einer Wissenschaft auf den Marktplätzen ansatzweise schon einmal, als die Humboldt-Universität vor über fünfzehn Jahren einen großen Bus geschenkt bekam, der in Berliner Stadtviertel fuhr und auf Plätzen hielt, um im Gefährt vor allem naturwissenschaftliche Experimente durchzuführen. Beispielsweise konnte man durch Analyse von Bodenproben sehen, dass ein Stadtviertel wie Berlin-Neukölln auf einer riesigen Schuttschicht errichtet wurde, mit der die Unebenheiten der Landschaft ausgeglichen wurden, um bessere Baufelder für die Mietskasernen zu haben.
Beglückend und bereichernd
Aber das Universitätsmobil war natürlich noch der klassischen Idee einer Sender-Empfänger-Kommunikation verpflichtet, ein wenig spitz und selbstkritisch formuliert: Wir Wissenden belehrten die unwissenden Menschen in Berlin-Neukölln darüber, was sich unter ihren Füssen befindet. In Wahrheit findet sich natürlich bei einem solchen Gespräch auf allen Seiten Wissen, wenn auch unterschiedlichen Typs, und dieses je verschiedene Wissen ist in jeder Hinsicht relevant.
Glücklicherweise fanden sich zu Beginn des Jahres zwei Menschen aus der Wissenschaft, die die gesprächsweise geäußerte Idee eines solchen Dialogformates begeistert und engagiert aufgriffen: Katja Becker, Medizinerin und Biochemikerin, dazu Präsidentin der Deutschen Forschungsgemeinschaft, und Walter Rosenthal, ebenfalls Mediziner bzw. Pharmakologe von der Ausbildung und derzeit Präsident der Hochschulrektorenkonferenz. Die Zusammenarbeit mit den beiden empfinde ich als beglückend und bereichernd; sie zeigt zudem, dass die besten Einfälle erst dann gut werden, wenn man sie man mit klugen und engagierten Menschen teilt, gemeinsam zuspitzt und so verbessert.
Weitere Bündnispartner
Und es braucht natürlich weitere Bündnispartner: Die Rektorenkonferenz und die Deutsche Forschungsgemeinschaft, die von der Wissenschaft selbst getragene, von Bund und Ländern finanzierte Einrichtung zur Förderung der Wissenschaft und Forschung in Deutschland, verfügen über höchst engagierte und qualifizierte Mitarbeitendenstäbe, die sich gemeinsam mit den Mitarbeitenden der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften und der Union der deutschen Akademien der Wissenschaften sofort und leidenschaftlich darum kümmerten, die Ideen ihrer jeweiligen Chefs kritisch zu diskutieren und dann loyal umzusetzen. Sie taten das, obwohl da niemand an Unterbeschäftigung leidet. Just the opposite.
Manchmal hört man, dass die deutsche Wissenschaft „versäult“ sei und diverse Institutionen angeblich nebeneinander her agieren. Das kann ich aus den letzten Wochen und Monaten wirklich nicht bestätigen: Extrem ausgelastete Mitarbeitende haben höchst effizient und geradezu freundschaftlich kooperiert, um ein Format von Gesprächen mit Bürgerinnen und Bürgern auf Fußgängerzonen und Marktplätzen zu realisieren.
Vergangenen Sonnabend war es erstmals so weit, morgen geht es weiter: Das Format heißt nun „Wissenschaft – und ich?!“ und das gemeinsame Logo möchte die Gesprächssituation eines Dialogs auf Augenhöhe wenigstens ansatzweise visualisieren.
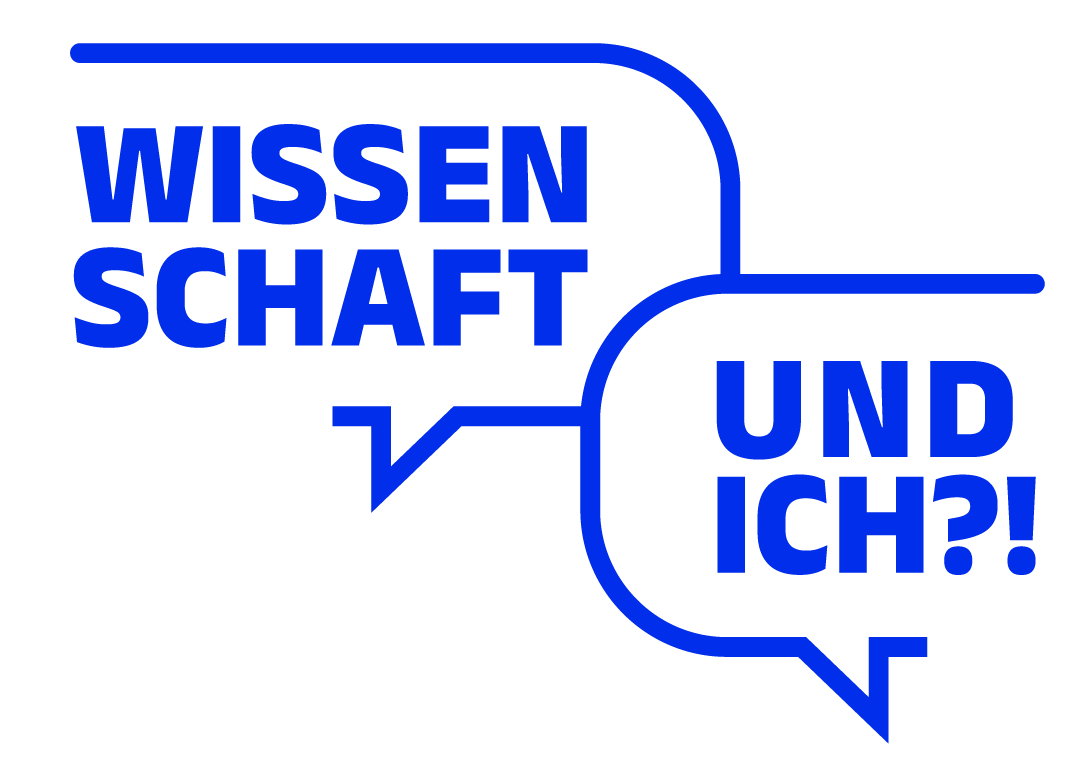
Am Freitag vor einer Woche trafen sich die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die am folgenden Samstag in der Innenstadt von Zwickau die erste Probe auf das Exempel machen wollten. Man lernte sich kennen, erfuhr etwas über die Stadt, ihre Geschichte und die wissenschaftlichen wie kulturellen Institutionen, aber auch über die Probleme und die Sicherheitslage in der Stadt. Ehrlicherweise muss ich erwähnen, dass manche Menschen geradezu Horrorszenarien ausmalten im Vorfeld und uns Initiatoren im Vorfeld warnten. „Ihr werdet im Osten sehr hässlich angegangen und vielleicht sogar verprügelt werden“. Nichts von dem geschah. Auf dem Kornmarkt in Zwickau standen ein paar Stehtische, eine Kinderspielecke, Tische mit ein paar Exponaten (ich selbst hatte eine kostbare antike Kunstuhr mitgebracht, auf der man nicht nur die Stellung aller Himmelskörper, sondern auch noch Sonnen- und Mondzyklen, die Jahre der olympischen und panhellenischen Spiele und Manches mehr ablesen kann).

Dazu hatten wir von vielen Zuwendungen, die uns für das Projekt erreicht hatten, bei lokalen Bäckereien reichlich Kuchen eingekauft und Kaffee, Saft und Wasser bereitgestellt, so dass nun Menschen einfach am Samstagvormittag zu Kaffee, Kuchen und Gespräch eingeladen werden konnten. Ganz viele Menschen haben sich einladen lassen. Unterschiedlichste Gruppen darunter: Menschen mit Migrationshintergrund, die auf unsere Frage nach einem Gespräch schüchtern sagten: „Aber ich bin doch Ausländer“ und dann ganz neugierig Fragen stellten. Ältere Menschen, jüngere Menschen, mittleres Alter. Natürlich gab es auch Passanten, die ein Gespräch ablehnten, weil sie zum Mittagessen verabredet waren oder sonst etwas dringend zu erledigen hatten. Aber ganz selten sagte jemand: „Wissenschaft interessiert mich eigentlich nicht“ – und das ist ja auch vollkommen in Ordnung.
Schwierige Gespräche, die manche befürchtet hatten, gab es eigentlich nicht. Ich habe mich zwar beispielsweise gemeinsam mit einer Mitarbeiterin der DFG länger mit einer Frau unterhalten, die die zunehmende Gewalt auf den Straßen Zwickaus ausschließlich auf Menschen mit Migrationshintergrund zurückführte und mutmaßte, die Polizei dürfe „gegen Ausländer nicht einschreiten“. Aber unser gemeinsamer Versuch, diese Verschwörungstheorie zu hinterfragen und überhaupt über Migration ins Gespräch zu kommen (die Frau war ein Kind ostpreußischer Flüchtlinge und hatte schwer unter der Ablehnung der damaligen Bevölkerung gegen die Flüchtlinge gelitten), fand in einer ganz ruhigen und entspannten Gesprächsatmosphäre statt. Gebrüllt oder heftig gestritten habe ich den ganzen Samstag mit niemanden und auch keiner meiner Kolleginnen und Kollegen.
Keine Alternative
Natürlich gab es Zeiten, in denen die Mengen über den Kornmarkt strömten und wir gar nicht genug waren, um alle anzusprechen, selbstverständlich gab es aber auch Zeiten, wo es tröpfelte (übrigens auch im wörtlichen Sinne der Regen) oder gar niemand über den Platz kam. Dann ertappte ich mich bei der Versuchung, die Kolleginnen und Kollegen aus der ganzen Republik, mit denen wir auf dem Kornmarkt waren, selbst um ein Gespräch zu bitten: Wie geht es mit der Energie weiter? Warum werden Bakterien gegen Antibiotika resistent und was kann man dagegen tun? Wieso stammt eines von Deutschlands ersten Elektroautos aus Zwickau und warum ist es so kompakt, dass ich gar nicht hereinpasse? Wie können wir die großen Kirchengebäude in den Innenstädten bewahren, auch wenn keine Gemeinden sie mehr pflegen und das Geld der Kirche hinten und vorn nicht reicht? Ich müsste jetzt eigentlich alle, die mit dabei waren, einzeln vorstellen und von den eigenen Erfahrungen berichten – ich als Wissenschaftler bin manchmal gerade genauso recht und schlecht über ein anderes Wissenschaftsgebiet informiert wie irgendein Passant auf dem Zwickauer Kornmarkt. Wenn man sich das klarmacht, gibt es zu Gesprächen auf Augenhöhe schon deswegen keine Alternative, weil ich selbst auch möchte, dass ich über die Probleme der Energiewende auf Augenhöhe ins Gespräch genommen werde und nicht von oben herab informiert werde.
Morgen stehen wir auf dem Neustädter Markt in Brandenburg und dann auch noch beispielsweise in Gera, Gelsenkirchen und Wetzlar. Vermutlich wird das Format verstetigt und viele andere eingeladen, sich zu beteiligen. Gern geben die, die es organisiert haben, Rat und Tat weiter. Und wir lernen natürlich aus jedem Termin und werden immer besser. Selbstverständlich führen Gespräche auf dem Zwickauer Kornmarkt nicht dazu, dass in ganz Sachsen das Vertrauen der Menschen in die Wissenschaft steigt und Sorge wie Angst abgebaut werden, die Menschen in die Hände radikaler Parteien und Denkweisen treiben. Aber aus vielen kleinen Strömen kann ein ziemlich mächtiger Fluss werden. Und ohne dass irgendwo einmal angefangen wird, kann es nicht weitergehen. Wird es nicht vorangehen.
Christoph Markschies
Christoph Markschies ist Präsident der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften. Er lebt in Berlin.


