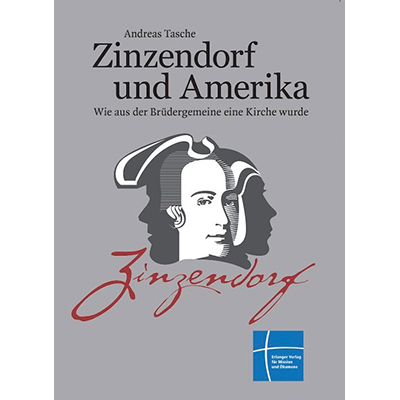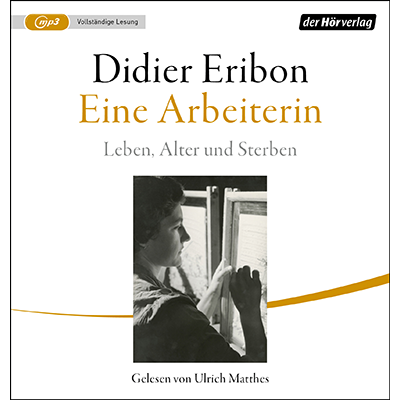In Krisen- und Ausnahmezeiten wie der gegenwärtigen Pandemie sehnen sich alle nach Normalität. Wann wieder Normalität erreicht werde und ob das „neue Normal“ noch das alte sein könnte, wurde und wird allenthalben intensiv diskutiert. Normal ist auch, dass in modernen Gesellschaften das Normale, also das, was traditionell das alltäglich Übliche ist und als die guten Sitten verstanden wird, niemals ganz klar feststeht und in ständiger Veränderung begriffen ist. Für die wissenschaftliche Ethik erzeugen diese hohen Veränderungsdynamiken des gesellschaftlich Normalen einerseits ihren Broterwerb, andererseits vielfältige Probleme: Denn wie greift man diese Entwicklungen methodisch ab? Und wie setzt man sich zu ihnen – insbesondere in der theologischen Ethik – angemessen in ein reflektiertes Verhältnis? Mit letzteren, also den ethischen Fragen beschäftigen sich die Beiträge des von Klaas Huizing und Stephan Schaede edierten Bändchens "Was ist eigentlich normal?" , das auf eine Tagung in Loccum zurückgeht.
In ihrer Einleitung plädieren die beiden Herausgeber dafür, die gesellschaftliche Konstruktion von Normalität nicht einfach als Wechselbegriff für überkommene Sittlichkeit, sondern als etwas spezifisch Modernes zu betrachten, nämlich als die Bildung einer Art Sittendifferenzials, das seinerseits „moderne Massenproduktion und moderne Erhebung von Massendaten“ voraussetzt. „Normalität“ formatierte demnach die guten Sitten in einem Modus, in den ein Sinn für die Veränderungskraft moderner Ökonomie und Technik bereits eingeflossen ist. Daraus erklärte sich, dass „Normalität“ (mit Jürgen Link) immer in zwei Varianten zu denken sei, als eine „protonormalistische“, die dem Veränderlichen die Norm als relativ starre entgegenstellt und als eine „flexibel-normalistische“, das sozusagen „neue Normal“, in dem die Anerkennung der (individuellen) Abweichung von der Norm als normal betrachtet wird.
Ohne Zweifel entspricht dieses fluide neue Normal den Tendenzen und normativen Idealen einer liberalen, wertepluralistischen Gesellschaft. Allerdings lebt es vom Bezug auf jene alte Normalität, die es jedoch zugleich negiert. Darum ist auch das neue Normal nicht frei von repressiven Tendenzen und damit vom Umschlag in einen neuen Protonormalismus. Der drohe immer dort, wo die Moralkeule des Normalen sich womöglich im medialen Beschämungsmodus gegen traditionale Lebensformen richtet.
In der Bio- und insbesondere Medizinethik ist, wie Reiner Anselm zeigt, das Problem als die Dialektik der „Natürlichkeit“ bekannt. Zumindest dann, wenn knappe Ressourcen gerecht verteilt werden müssen, sind Gesellschaften gezwungen, sich auf akzeptable Normalbegriffe von Gesundheit und Krankheit zu einigen. Auch subjektive Leiden müssen irgendwie objektivierbar sein und sich von Verschönerungs- oder Verbesserungswünschen unterscheiden lassen.
Eine inhaltlich ziemlich anders verfasste, strukturell aber durchaus analoge Dialektik der neuen fluiden Normalität ließe sich auch auf deren vielleicht wichtigsten Herrschaftsgebiet, der Gender- und Familienethik, aufweisen. Die vom neuen Gender-Normal vollzogene Abkoppelung des Geschlechts (Gender) von der biologischen Sexualität und Generativität und die darin begründete Neudeutung der Familie als gender- und reproduktionsindifferenter Generationengemeinschaft ändert nichts daran, dass Kinder sich – auch im neuen Normalfall – nicht ihre Eltern heraussuchen und nur sehr bedingt erziehen können. Wenn es stimmt, wie Reiner Anselm und Stephan Schaede vermuten, dass „das Merkmal der lebenslangen Treue, der Beständigkeit und Verlässlichkeit … des klassisch christlichen Ehe-Ideals kulturgeschichtlich tatsächlich … aus der Eltern-Kind-Bindung abgeleitet“ ist, dann könnte die traditionelle Eltern-Kind-Familie, „der familial eingebundene Charakter der Ehe“ auch unter Regenbogenverhältnissen als „Normalfall anzusehen (...) und alle anderen Formen daran zu messen“ sein.
Ähnliche Dialektiken ließen sich schließlich auch noch auf einem anderen Gebiet entdecken, nämlich beim Mensch-Tier-Verhältnis. Hinter dem alten Normal des Tiere-Essens stehe, wie Cornelia Mügge argumentiert, das große uralte Normal der machtvollen Selbstunterscheidung des Menschen von den Tieren, das in der Bibel bekanntlich als Ermächtigung durch Gott legitimiert wird. Wo der Mensch im neuen Normal sein eigenes Tiersein – christlich gesprochen: die gemeinsame Geschöpflichkeit – anerkenne, könne er Tiere nicht mehr essen. Auch da ließe sich aber fragen, ob das neue Normal theologisch wirklich ohne das alte zu denken ist. Schließlich ist es in der Bibel der Mensch, der als sprechendes Tier den Tieren Namen gibt und von Gott die Erlaubnis bekommt, ausnahmsweise und eingedenk seines Gefallenseins aus der ursprünglichen Schöpfung, insbesondere an Feiertagen, die ihn daran erinnern, Tiere, ursprünglich wohl vor allem Tieropferfleisch, zu essen. Vielleicht ist, so könnte man zwischen den Zeilen und gelegentlich auch in dialektischer Umbiegung der Gedanken der Autorinnen und Autoren dieses anregenden Büchleins lesen, gerade den biblischen Geschichten erstaunlich viel weisheitliches Wissen über die Dialektik von neuem und altem Körpernormalitätsideal zu entnehmen.
Georg Pfleiderer
Dr. Georg Pfleiderer ist Professor für Systematische Theologie an der Universität Basel.