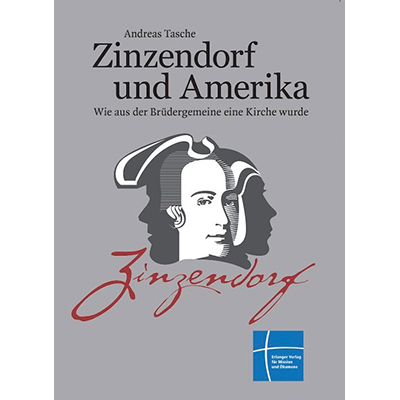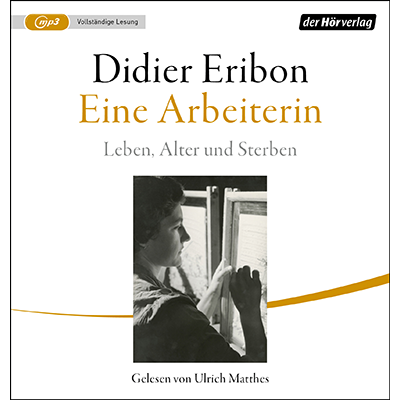Wer nichts glaubt, schreibt“, steht außen auf dem gelben Reclamband, der als eine Art Best of einige von Maxim Billers „Essays über Deutschland und die Literatur“ der vergangenen dreißig Jahre versammelt. Wer nichts glaubt, schreibt, denkt der Leser und fragt sich, wie das wohl mit Maxim Biller zusammenhängen mag, dieser Titel. Denn wer schon einmal Biller gelesen oder ihn auch nur im Literarischen Quartett gesehen hat, dem er eine Zeit lang angehörte, der muss doch überzeugt sein, dass dieser Maxim Biller ganz sicher nicht nichts glaubt. Oder?
Aber es ist natürlich auch nur so ein dialektischer Trick. So was sollte unter Christen ja nicht fremd sein. Immerhin wird hier die grausame Geschichte von der Ablehnung, dem Verrat und Mord an Jesus von Nazareth ja auch Evangelium genannt – gute Nachricht. Das war eine Idee von Paulus, so eine Art re-framing. Und so wurde aus etwas wirklich Abscheulichem etwas Befreiendes. Eine ziemlich gute Idee. Denn genau so etwas brauchen Menschen, die immer und ständig mindestens auch von Abscheulichem umgeben sind. Wir alle brauchen etwas oder jemanden, der oder die oder das die ganze Sache für uns dreht, Abscheuliches zu Gutem macht. Und da wäre der Leser wieder bei Maxim Biller, dessen hier versammelte Essays, die, wie bei ihm immer, glänzend geschrieben sind, den Eindruck vermitteln, dass sie Abscheuliches zu Gutem machen können.
Es ist ja zum Beispiel eigentlich abscheulich, beleidigt zu werden. Aber wenn Biller in seinem Essay „Gebrauchsanweisung für den Hass“ seinen Leser direkt als „armer, kleiner deutscher Untertan“ beschimpft – und das ist nur eine von vielen Beschimpfungen – und dann rhetorisch scharf klarmacht, dass es doch einen Unterschied gibt zwischen echter, „gutkombinierter Polemik“ und der „Hass- und Hetz-Atmosphäre im Internet“, und einem dann wieder einmal aufgeht, dass eine Welt, in der immer alle nett zu einander sind, genau das Gegenteil von dem ist, was sie sein soll, nämlich eine Welt, in der dann auch niemand mehr wirklich nett zu niemandem ist, dann wird aus diesem Abscheulichen doch etwas Gutes. Und es ist ja auch abscheulich, immer wieder darauf hingewiesen zu werden, dass auch die eigenen Vorfahren irgendwie etwas mit diesem schrecklichen Nazi-Deutschland zu tun hatten, das es einmal gab. Wenn aber Maxim Biller dann in seiner großen Heidelberger Poetik-Vorlesung, die den Abschluss der Essay-Sammlung bildet und ihr den Titel gibt, klarmacht, dass nur, wer seine eigene Geschichtlichkeit, also das Stehen und Leben in Überlieferungszusammenhängen, ehrlich wahrnimmt, verstehen kann, warum er so ist, wie er ist, und einem dabei gleich noch einmal mit aufgeht, wie falsch der Wunsch nach einer Glättung der Vergangenheit zur Harmonisierung der Gegenwart ist, dann ist auch aus dieser Abscheulichkeit wieder etwas Gutes geworden.
Und so sind Billers Essays, zugegeben, das ist jetzt ein alter Theologentrick, die vermeintlich Ungläubigen einfach mal einzugemeinden, so sind also diese Essays eben doch durchzogen von einer Art Glauben. Wobei das Wort Glauben, das hat schon Paul Tillich vor über sechzig Jahren gewusst, sowieso wie kaum ein Wort in der religiösen Sprache Missverständnissen, Verzerrungen und fragwürdigen Definitionen ausgesetzt ist. Wo ist denn überhaupt der Unterschied, ob einer schreibt, weil er glaubt oder weil er nicht glaubt? Glauben heißt ja sowieso immer auch Unglauben, Zweifeln. Den Unterschied macht also nicht das Glauben, sondern das Schreiben, der unbändige Wille zum Geschichte schreiben, wie ein weiterer Essay heißt. Wer Geschichten schreibt, verbindet das Chaos zu Sinn. Und genau das tun Billers Essays auf eine abscheulich gute Weise.
Konstantin Sacher
Konstantin Sacher ist Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Systematische Theologie an der Universität Leipzig.