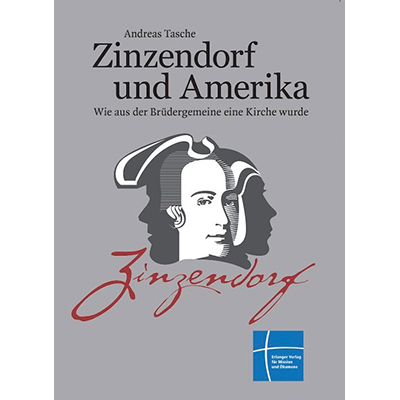Gerechte Menschen
1. Sonntag nach Epiphanias, 12. Januar
Und siehe, eine Stimme aus dem Himmel sprach: Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe. (Matthäus 3,17)
Der Titel „Sohn Gottes“ kann so verstanden werden, als sei Jesus ein Mischwesen gewesen, halber Mensch und halber Gott. Weil Jesus ein frommer Jude war und die Überlieferungen seiner Religion kannte, dürfte er sich nicht als Gott verstanden haben. Aber es ist angemessen und sinnvoll, Jesus als „Sohn Gottes“ zu bezeichnen. Denn ihn verband mit dem „Vater im Himmel“ eine innige Beziehung, ein absolutes Vertrauensverhältnis. Und dieser hat sich vollkommen mit Jesus identifiziert.
Beides klingt auch in Matthäus 3 an. Nur mühsam kann Jesus Johannes überzeugen, ihn zu taufen. „Denn so“, argumentiert Jesus, „gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen“ (Vers 15). Und dabei geht es um die Gerechtigkeit, die Jesus in der Bergpredigt verkündigt, die er lebt, für die er leidet und stirbt. Diese Gerechtigkeit ist anders „als die der Schriftgelehrten und der Pharisäer“ (Matthäus 5,20) – und sie übersteigt, was Menschen für möglich halten.
Die Taufe Jesu durch Johannes ist der Beginn eines Lebens, in dem Gottes Gerechtigkeit praktiziert wird. Und das gilt auch für die Taufe, die die Kirche vollzieht. Im „Missionsbefehl“, mit dem das Matthäusevangelium schließt, wird der Auftrag, die Nichtjuden zu taufen, ja mit der Forderung verbunden, die Getauften zu lehren, „alles“ zu halten, was Jesus „befohlen“ hat. Das ist natürlich nicht einfach Wort für Wort dem Neuen Testament zu entnehmen. Vielmehr müssen Christen immer wieder überlegen, welches Tun in einer bestimmten historischen Situation am ehesten dem Geist Jesu entspricht. Die Bibel lehnt die Sklaverei als Institution nicht ab. Erst unter dem Einfluss des Zeitgeistes, den man im Rückblick mit dem Heiligen Geist gleichsetzen kann, sind Christen zur Einsicht gekommen, dass jede Form der Sklaverei Gottes Geboten widerspricht.
Neue Erkenntnisse
2. Sonntag nach Epiphanias, 19. Januar
Ach, Herr, wenn unsere Sünden uns verklagen, so hilf doch um deines Namens willen! Denn unser Ungehorsam ist groß, womit wir wider dich gesündigt haben. (Jeremia 14,7)
Das 14. Kapitel des Jeremiabuches erzählt von einer großen Dürre, die Jerusalem und Juda heimsucht: „Die Erde ist rissig, weil es nicht regnet auf das Land“ (Vers 4). Da liegt ein Vergleich mit der heutigen Klimakatastrophe nahe. Aber er würde hinken. Die Klimakatastrophe ist auf Entscheidungen in Politik, Wirtschaft und Landwirtschaft zurückzuführen, die Verbraucher und Wähler hingenommen oder gar unterstützt haben – oder es noch tun. Doch die Dürre in Israel führt Jeremia nicht auf die extensive Nutzung des Bodens zurück, sondern auf „Sünden“ des Volkes. Und dazu werden gegen Ende des 13. Kapitels „Ehebrecherei“, „Geilheit“ und „Hurerei“ gezählt. Die Dürreperioden und Missernten in Afrika würden wohl nicht einmal fundamentalistische Christen den Sünden seiner Bewohner zuschreiben und umgekehrt im Überfluss an Nahrung nicht den Beweis dafür sehen, dass Nordamerikaner und Europäer gottgefällig leben.
So fremd uns das Gottesbild des Jeremia in gewisser Hinsicht erscheint, eine Einsicht können Christen des 21. Jahrhunderts nachvollziehen: Gott ist nicht dazu da, zu verhindern oder zu reparieren, was Menschen verbocken, indem sie zum Beispiel gegeneinander und gegen die Natur Krieg führen. Gott schenkt aber denen, die betend und nachdenkend suchen, immer wieder neue Erkenntnisse. Ein Geistesblitz kann einschlagen, wenn man Worte der Bibel liest oder hört, wenn man sich mit Mitmenschen austauscht oder wie die Quäker auf die innere Stimme hört. Und durch die Erzählungen der Bibel und die Liturgie des Gottesdienstes stärkt Gott das Vertrauen in die Zukunft und darauf, dass sich die Menschlichkeit „trotz alledem und alledem“ durchsetzt.
Katholische EKD
3. Sonntag nach Epiphanias, 26. Januar
Petrus aber tat seinen Mund auf und sprach: Nun erfahre ich in Wahrheit, dass Gott die Person nicht ansieht; sondern in jedem Volk, wer ihn fürchtet und Recht tut, der ist ihm angenehm. (Apostelgeschichte 10,34)
Ich glaube an „die heilige christliche Kirche“, bekennen Besucher evangelischer Gottesdienste, in denen das Apostolische Glaubensbekenntnis zur Liturgie gehört. „Christliche Kirche“ klingt so seltsam wie „jüdische Synagoge“ und „islamische Moschee“. Martin Luther hat so den lateinischen Begriff ecclesiam catholicam übersetzt. Denn er wollte sich von der römisch-katholischen Kirche, dem großen Gegenüber absetzen. In England fehlte dieses weitgehend. Daher hatte (und hat) die anglikanische „Kirche von England“ mit dem Begriff catholic kein Problem.
Auch deutschsprachige Protestanten sollten die Bezeichnung „katholisch“ nicht der Römischen Kirche überlassen, die ja nur ein Teil der universalen Kirche bildet.
Zum Wesen der Kirche gehört ihre Katholizität oder Universalität. Das heißt: Die Kirche übersteigt die Grenzen, die Menschen aufrichten und voneinander trennen. Dies wird schon in den frühen Schriften des Neuen Testamentes deutlich, wie im 10. Kapitel der Apostelgeschichte. Es erzählt von der Begegnung des Apostels Petrus, der jüdischer Abstammung ist, mit einem Nichtjuden, dem römischen Hauptmann Kornelius. Wie Juden glauben Christen an den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Aber die Missionierung und Taufe von Nichtjuden erweitert den Kreis der Glaubenden. So folgt das Christentum der universalistischen Linie des Alten Testamentes.
Christen sollen Patrioten sein, indem sie „der Stadt Bestes suchen“, also für die Wohlfahrt des Landes sorgen, in dem sie leben. Und das kann auch eine Kontrolle und Begrenzung von Einwanderung bei gleichzeitiger Aufnahme von Verfolgten bedeuten, wie das zum Beispiel Kanada praktiziert.
Christen können aber keine Nationalisten sein und ihr Land „über alles in der Welt“ stellen. Und völkisches Denken ist erst recht unchristlich. Jesus war genauso wenig ein Deutscher wie die Apostel und die Mönche, die den Germanen eine fremde Religion brachten. Und der Kapstadter Alterzbischof Desmond Tutu, der für die Würde aller Menschen eintritt, steht deutschen Christen zum Beispiel näher als deutsche Rechtsextremisten, die das „Abendland“ beschwören und gegen Mitbürger hetzen, die oder deren Eltern eingewandert sind.
Symbole und Gesten
Letzter Sonntag nach Trinitatis, 2. Februar
Er legte seine rechte Hand auf mich und sprach: Fürchte dich nicht! Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. (Offenbarung 1,17–18)
Die Reformation hat die Bibel, die Volkssprache im Gottesdienst und die Predigt wieder zu Ehren gebracht. Fortschritt bedeutet Gewinn, aber auch Verlust. In der Abgrenzung zur römisch-katholischen Kirche und Volksfrömmigkeit ging die Einsicht verloren, dass Kommunikation nicht allein mit Worten geschieht, sondern auch durch Symbole und Gesten. Schon im Alltag macht es einen Unterschied, ob man jemand mit Handschlag begrüßt oder nicht. Und im Trauerfall sagen ein liebevoller Blick und eine leichte Berührung manchmal mehr als Worte.
Gott kommuniziert durch Worte, aber nicht nur. Eine Vision, wie sie der Seher Johannes erfährt (Offenbarung 1,12–17), ist sicher die Ausnahme. Aber Gott wirkt nicht nur auf den Geist, sondern auch auf den Geschmacks- und den Tastsinn. Im Abendmahl tut er das durch Brot und Wein und in der Taufe durch Wasser. Worte deuten das Geschehen, und die Elemente lassen spüren und bekräftigen, was gesagt wird.
Durch die Begegnung mit römischen und anderen Katholiken haben Protestanten die Bedeutung von Symbolen und Gesten (wieder) entdeckt. Das Abendmahl wird in Kirchen der Reformation häufiger gefeiert als früher, wenn auch nicht jeden Sonntag. Auch in evangelischen Kirchen werden Taufkerzen übergeben, die Christus und das neue Leben des Getauften symbolisieren. Im Traugottesdienst ist ein Ringwechsel möglich, obwohl das Paar die Ehe schon auf dem Standesamt geschlossen hat. Und ich selber habe in der Kirche von England gelernt, mich zu bekreuzigen. Indem ich so meinen Körper berühre, verleibe ich mir persönlich ein, was ich im Gottesdienst höre, vor allem beim Segen, den der Liturg der Gemeinde zuspricht.
Gnade vor Recht
Sonntag Septugesimä, 9. Februar
Siehst Du darum so scheel, weil ich so gütig bin? (Matthäus 20,15)
Diese Frage stellt der Besitzer eines Weingartens dem Tagelöhner, der sich ungerecht behandelt fühlt. Das „Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg“ erinnert an zwei Züge, die das Gottesbild von Juden und Christen prägen: Gott ist gerecht und barmherzig. Und das führt zu Spannungen. Denn wer zu dem einen Mitmenschen barmherzig ist, behandelt den anderen gleichzeitig oft ungerecht.
„Gerechtigkeit erhöht ein Volk“ (Sprüche 14,34). Aber ohne Barmherzigkeit kann sie zur Prinzipienreiterei erstarren und Herzen verhärten. Umso mehr berühren Geschichten, in denen Gnade vor Recht ergeht. Das ist schon bei der alttestamentlichen Erzählung von Kain und Abel der Fall. Und erst recht bewegt das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Solche Geschichten der Bibel und ähnliche aus dem eigenen Leben prägen sich ins Gedächtnis ein und regen – hoffentlich – zur Nachahmung an.
In Englisch, das ich ab Klasse fünf lernte, bekam ich in der Regel eine Zwei. Aber in der Oberstufe hatte ich einmal eine Englischarbeit verhauen. Als ich sie zurückerhielt, war ich erstaunt und gerührt. Denn der Text war durchgestrichen, und darunter stand: „Sie hatten wohl einen schlechten Tag, Arbeit wird nicht gewertet.“ Dabei war der Lehrer konservativ, unbestechlich und bisweilen grob. Dass er in meinem Fall ein Auge zudrückte, hätten ihm meine Mitschüler als ungerecht ankreiden können. Aber keiner beschwerte sich. Vielleicht auch, weil Noten damals nicht so wichtig waren. Denn der Numerus Clausus betraf nur wenige Studienfächer, und die Schule war noch nicht so verrechtlicht wie heute.
Was der Englischlehrer tat, habe ich nie vergessen. Und vermutlich habe ich dabei mehr fürs Leben gelernt, als durch eine schlechte Note, auch wenn sie gerecht gewesen wäre.
Jürgen Wandel
Jürgen Wandel ist Pfarrer, Journalist und ständiger Mitarbeiter der "zeitzeichen".