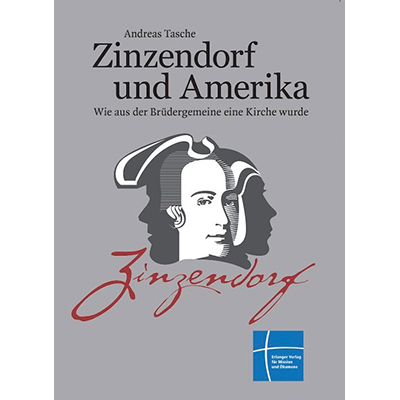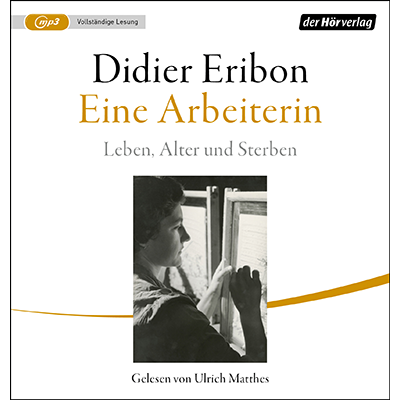Der kleine große Brite Jamie Cullum ist ein Grenzgänger par excellence zwischen den Genres Jazz, Pop und Funk – vielleicht vergleichbar mit Regina Spektor oder Norah Jones, am ehesten aber mit dem gerade gewaltig startenden Jacob Collier. Wer mit Größen wie dem funkigen Oscar- und Grammy-Preisträger Watermelon-Man Herbie Hancock oder dem Hip-Hopper Pharrell Williams, auch als Skateboard P unterwegs, der mit Happy einen Welthit landete, musiziert, hat hinlänglich bewiesen, was in ihm steckt.
Das neue, nunmehr neunte Album, das ironisch mit dem Titelsong Taller startet: „I wish I was taller, I wish I was wiser, so can I stand next to you?“ hat vier Jahre auf sich warten lassen – Jahre, die Cullum ohrenfällig doppelt genutzt hat, um sowohl menschlicher Größe auf Spur und Schliche zu kommen, als auch der eigenen Songwriter-Kraft Raum und Richtung zu geben. Damit ist ihm ein wunderschönes Konzeptalbum klassischer Provenienz und, in Form der lustvoll bewegten Darstellung der eigenen Lebensetappe, ein beeindruckend persönlicher musikalischer Meilenstein geglückt. Dabei spart er nicht am großen Bahnhof, wenn er in die Fülle verschiedenster Bigband-Besetzungen greift und sowohl das exquisite Tippett Quartet als auch das London Symphony Orchestra zu opulenten Balladen einlädt – jede ein Freiflug über den weiten Horizont, jede aber auch und vor allem – wie das ganze Album – getragen von einer poetisch-lebendigen Komposition und der großen Stimme dieses scheinbar unscheinbaren Mannes, seinem coolen, gleichwohl freund- und väterlichen Bariton und der dieser Stimmlage als großer Segen beigegebenen Registerweite, die neben dem sonoren Timbre in brustiger Resonanz ein feines, wohlklingendes Falsett ermöglicht, wie es auch Queen-Ikone Freddie Mercury vielfach zum Besten gab. Diese wandelbare Stimme trägt alles, zieht sich durch das wundersam mäandrierende Konvolut von sechszehn Songs und kann von Monstern „When I lose my sense of motion/An ocean there in front of me ...“ ebenso unter die Haut gehend singen, wie in die Stille hinein sinnierend „If endings are beginnings/Maybe we should be leaving//If loving you´s like dying/Maybe we should stop breathing?//We listen but are we hearing?/And endings are like beginnings. … I pray that I´m not just dreaming – and endings are like beginnings”.
Es gibt Alben zum Bejubeln von Klängen, die ins Schwärmen bringen, und Rhythmen, die ein Lob auf die Lebendigkeit sind. Dieses Album ist so eins. Aber es hat so schön stille Momente, dass der Jubel dafür nicht mit Luftsprüngen, sondern auf Zehenspitzen daherkommt.
Klaus-Martin Bresgott
Klaus-Martin Bresgott ist Germanist, Kunsthistoriker und Musiker. Er lebt und arbeitet in Berlin.