Missae meae
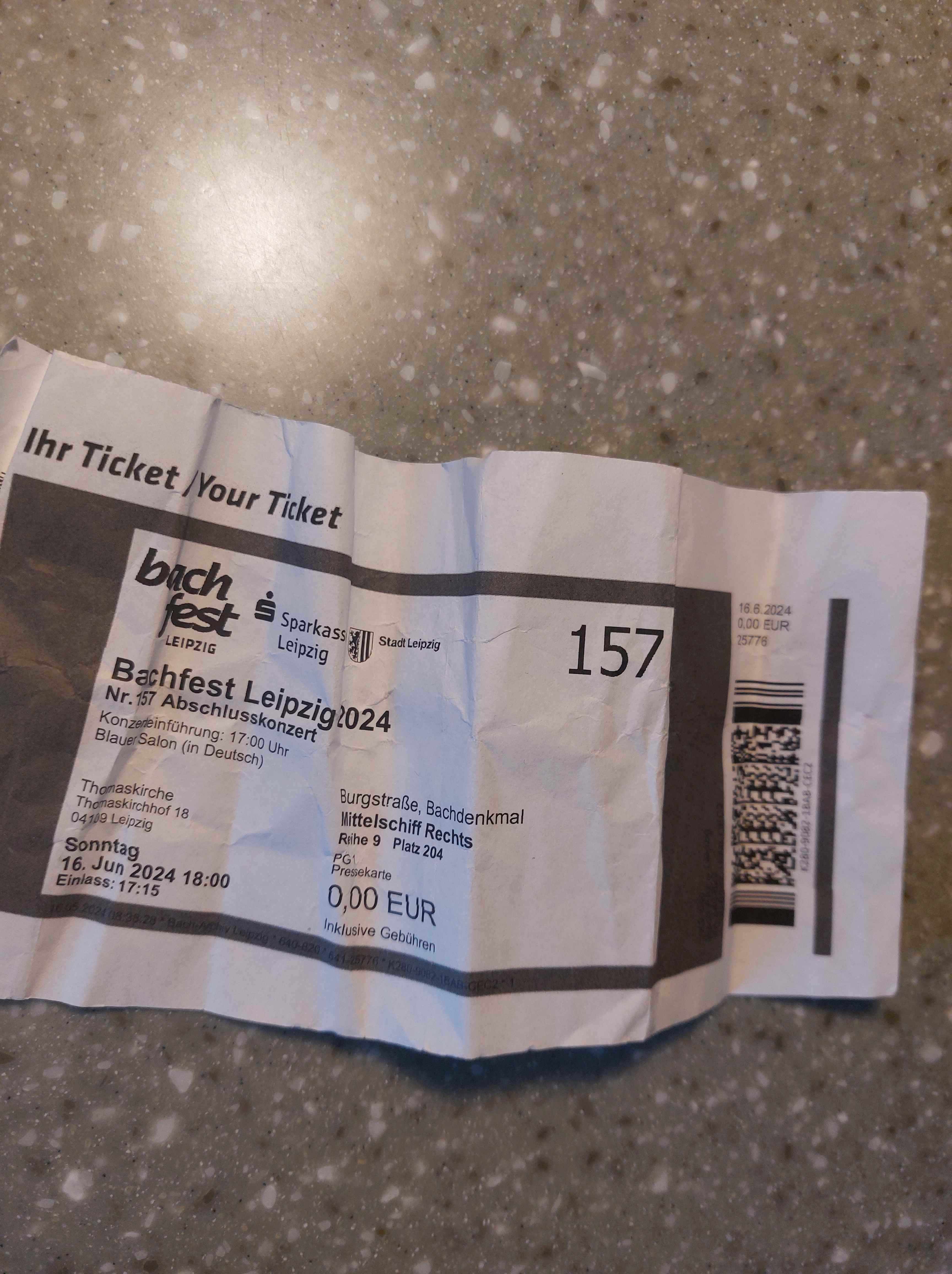
Die h-Moll-Messe von J.S. Bach gilt als „größte(s) musikalische(s) Kunstwerk aller Zeiten und Völker“. Zeitzeichen-Chefredakteur Reinhard Mawick erlebte am vergangenen Sonntag das Abschlusskonzert des Leipziger Bachfestes mit Philippe Herreweghe. Er erinnert sich anlässlich dieses Ereignisses an seine bisherigen neun h-moll-Messen-Konzerte als Sänger und hofft inständig auf ein zehntes.
„Kyrie – Kyrie – Kyrie eleison“. Es ist da. Wie aus dem Nichts schallt es von den Höhen der Empore der Thomaskirche zu Leipzig – so muss es sein. Es soll doch tatsächlich Dirigenten geben, die lassen kurz zuvor einen h-moll-Akkord spielen und/oder gar ansummen. Dann ist die Spannung leider schon weg, bevor es losgeht. Denn wie eindrucksvoll ist es, wenn am Beginn von Bachs H-Moll-Messe diese drei schwermütige Chorseufzer-Juwelen aus dem Himmel fallen, bevor eines der erhabensten Lamenti der Musikgeschichte anhebt: das Kyrie I der H-Moll-Messe von Johann Sebastian Bach!
Das 19. Jahrhundert scheute keine Superlative. Der Beginn der sogenannten Bachrenaissance liegt inmitten der Romantik, und als der Schweizer Musikverleger Hans-Georg Nägeli 1818 zur Subskription der Partitur des Werkes aufruft, nennt er Bachs h-moll-Messe das „größte musikalische Kunstwerk aller Zeiten und Völker“. Und am Sonntag? Wunderbar strömt die Fuge in die Weiten der Thomaskirche, und mein Platz ist berufsbedingt ein privilegierter, optisch wie akustisch: Mittelschiff Rechts, Reihe, Platz 204 – direkt am Mittelgang, etwa zehn Meter vis-a-vis von Bachfestintendant Michael Maul, der nach zehn Tagen Dauerstress nun auch mal zwei Stunden lang da einfach sitzen, hören und zu sich kommen darf.
Das Wogen und Wallen des ersten Kyrie von Chor und Orchester des Collegium Vocale Gents unter Großmeister Philippe Herreweghe ist unbeschreiblich schön. Obwohl, man verzeihe die Beckmesserei, das „Kyrie“ ist mir doch zu sehr „Kii-rie“, ich liebe das dunkle, ü-lastige Ypsilon-Küürie. Es klingt wärmer und erbarmender. Und dann, der kecke Gedanke schleicht sich ein, ist das Ganze nicht auch einen Tick zu schnell? Die Quart- und Quintsprünge des ersten Themas könnten noch ein bisschen mehr ächzen. Aber bitte, das ist weit entfernt von Kritik, es ist nur ein leises Geschmacksurteil, geäußert im Übermut.
Wie unendlich grober, schlichter und wohl auch scheußlicher als dieses wohlige, saubere Wogen der genialen Interpreten Anno 2024 war doch damals unser Tun in einer Kantorei am nordwestlichen Strande der norddeutschen Tiefebene vor fast 40 Jahren: Monatelang hatte uns die Kantorin diese Messe am Klavier eingehämmert. Ja, sie konnte nett sein, die Kantorin, aber sie neigte leider sehr häufig zum Jähzorn. Naja, irgendwann konnten wir halbwegs die Töne und bogen es irgendwie hin. Aber wenn ich ehrlich bin, habe ich an meine allererste h-Moll-Messe, das „Konzert dahoam“ in der Banter Kirche in Wilhelmshaven im großen Bachjahr 1985, als an den 300. Geburtstags des Meisters weltweit gedacht wurde, keine bewusste musikalische Erinnerung mehr.
Erste Garde aus Hannover
Halt! Jetzt gerade ist in Leipzig der Eingangschor zuende, und das liebliche Duett „Christe eleison“ hebt an – nach herbem h-moll nun sanft-frohes D-Dur! Schon fliegen beim Einsatz der beiden Sängerinnen meine Gedanken wieder knapp vierzig Jahre zurück in das sagenumwobene Bachjahr 1985. Damals sang meine verehrte erste Gesangslehrerin Erika Orth den Sopran und die unvergleichliche Ulla Groenewold den Alt beziehungsweise 2. Sopran. Ich betrat die Alexanderkirche in Wildeshausen bei der Probe des „Christe“ und war verzückt: „Ach, so kann das auch klingen …“. Denn anders als Monate zuvor in meinem ersten Konzert in Wilhelmshaven sägten nicht irgendwelche Stahlsaitensöldner lieblos daher, sondern es spielte schon die erste Garde der damals dank Lajos Rovatkay aufblühenden Hannoveraner Alte-Musik-Szene.
1985, im großen Bachjahr, kulminierte so einiges in Sachen h-moll-Messe bei mir, dem 19-jährigen Abiturienten. Zunächst das oben erwähnte Mühsam-Konzert mit der heimischen Kantorei und Kantorin im Norden kurz vor den Sommerferien. Dann gab es 1985 im aufziehenden Kammerchorfrühling meines Lebens noch zwei weitere Projekte im Herbst, die mir das „größte musikalische Kunstwerk aller Zeiten und Völker“ nachhaltig und unbedingt positiv in Herz und Seele gruben: Zunächst im September eine Aufführung in Bad Gandersheim mit der Capella Vocale, einem dieser jungen, enthusiastischen Vokalensembles, die damals im Zuge der historischen Aufführungspraxis barocker Musik aus dem Boden schossen. Die Leitung hatte Martin Heubach. Wir waren dort im Harzvorland mit nur sechs Tenören am Start, um das anspruchsvolle Werk zu gestalten, aber zumindest nach unseren damaligen Maßstäben reüssierten wir prächtig.
Überhaupt nicht reüssierten 1985 in Bad Gandersheim jedoch die Trompeten. Mon Dieu, sei mir nicht böse, liebes Trompetenensemble, aber als nach dem grüblerischen fis-moll des archaischen Kyrie II dann im nächsten Stück, im „Gloria in excelsis Deo“, die Trompeten glanzvoll einsetzen sollten, stimmte eigentlich kein Ton. Nur daneben gehupt. Schlimm! Aber man nahm es damals als Dienst am teilweise fetischartig verehrten historischen Instrumentarium in Kauf. Vorgestern hingegen tönte es aus den himmlischen Leipziger Höhen, wo Bach-Gottvater Herreweghe souverän waltete, so: Mild-strahlender Glanz, herrliches Tempo, homogene, aber doch lebendige Stimmpracht, bewegte Fugen ohne einen Funken Schleppvirus … bravissimo. Was haben doch 40 Jahre für Fortschritte gebracht! Auf dem Gebiet der Bachinterpretation unermessliche.
Wobei es auch 1985 schon gewaltige Unterschiede gab. Sechs Wochen später im November, bei meinem zweiten historisch informierten H-Moll-Messen-Projekt – wir Spätpubertierenden witzelten damals schon beim Bier von der "H-Mess-Molle" – mit den versammelten Kammerchören aus Oldenburg und Stadthagen unter der Leitung von Rainer-Michael Munz (ein Konzert) und Gerald A.Manig (anderes Konzert), war das Trompetenensemble Friedemann Immer am Start. Nach meiner Erinnerung spielten die auch schon damals so gut, wie die jetzt in Leipzig – auf jeden Fall kein Vergleich zum Harzer Blechdesaster ein paar Wochen zuvor.
Begeisterte Alte-Musikszene
Ja, ja, 1985 war für mich ein Initiationsjahr besonderer Güte. Weniger aufgrund des laut Aktenlage passablen Abiturs (an das ich kaum eine Erinnerung habe, außer an die ekstatischen Feiern danach), aber auf jeden Fall wegen Nikolaus Harnoncourt und Gustav Leonhardt, also wegen der Entdeckung und meiner begeisterten Aneignungsversuche der historisch informierten Aufführungspraxis. Diese Bewegung trat damals durch neue Einspielungen (Harnoncourt und natürlich Reinhard Goebels Musica Antiqua Köln), durch Konzerte einer begeisterten kleinen Alte-Musikszene in und um Wilhelmshaven (in der auch meine große Cello-Schwester zumindest eine kleine Rolle spielte) und besonders durch die Lektüre des Buches „Musik als Klangrede“ von Nikolaus Harnoncourt in mein Leben. Es war eine neue Bach-Zeit angebrochen, und ich, der frischgebackene Zivildienstleistende, hatte ein neues Hobby. Ein Hobby, das dann bald in der Gründung der Konzertreihe Alte Musik Sengwarden kulminierte, deren Kuratierung für ein Vierteljahrhundert mein (Freizeit-)Leben bestimmen sollte. Aber das ist eine andere Geschichte …
Am Sonntag in St. Thomas zu Leipzig betören im „Christe“ die beiden internationalen Starsängerinnen Dorothee Mields und Hana Blažíková. Superb. Genauso wie „La Blažíková“ nach dem herrlichen „Et in terra pax“ von Chor und Orchester im „Laudamus te“. Unaufgeregt perfekt liefern sie und Sologeigerin Christine Busch die berückende Soloarie ab, bevor sich das herrliche „Gratias agimus tibi“ entfaltet, in dessen Verlauf das Trompetentrio über dem edlen Chorgeflecht einen Dachstuhl im Himmel errichtet. Es ist eines der beiden Stücke in der h-moll-Messe, nach dem man nicht seufzen muss: „Ach, schade, schon vorbei …“, denn es kommt ja nochmal – zumindest dieselbe Musik – ganz am Schluss.
Apropos „Gratias agimus tibi“: Nur zwei Jahre nach jenem Annus mirabilis 1985 hatte ich die Freude mit der erwähnten Oldenburger und Stadthäger Chorgemeinschaft die Kantate BWV 29 (Wir danken dir. Gott) zu musizieren. Deren Eingangschor nach der fulminanten Sinfonia mit konzertierender Orgel kam mir verdammt bekannt vor. Kein Wunder, denn es war (und ist) zumindest von den Noten her 1:1 das „Gratias agimus tibi“ aus der h-moll-Messe. So erlebte ich damals das segensreiche Bachsche Parodieverfahren endlich am eigenen Leibe, obwohl uns schon die gestrenge Kantorin der norddeutschen Tiefebene davon anlässlich der zahlreichen Weihnachtsoratorien meiner früheren Jugend erzählt hatte, allein, es fehlte mir bisher die Anschauung bzw.-hörung, denn YouTube, dieser segensreiche Fluch, war noch nicht erfunden.
Und weiter fließt es auf Leipzigs Thomashöhen dahin: Jetzt das zauberhafte Duett „Domine Deus“, in dem sich Tenor Guy Cutting sehr ordentlich einführt. Aber so richtig sagen, wie ein Solo-Tenor in der h-moll-Messe ist, kann man eigentlich erst, wenn im Schlussteil das „Benedictus“ erklingt, und das liegt jetzt noch weit voraus. Im „Domine Deus“ jubiliert die Flöte so souverän und schön, wie ein befreiter Vogel. Ihr folgen die Streicher, aber nicht als Jäger oder Gejagte, sondern eher als Mit-Befreite. Meisterhaft. Und dann ist da noch, kurz bevor Sopran und Tenor einsetzen, dieser herrliche Schwellton der Violinen, der aus dem Nichts erwächst – ach, wer es weiß, der kann sich vor Erwartungsfreude kaum zügeln.
Dieses Duett teilt mit einigen anderen Passagen der H-Moll-Messe das Schicksal, in das folgende Stück direkt einzumünden, und deswegen heißt es hier immer für den Chor: „Obacht, gleich geht’s los“, das unvergleichlich schöne „Qui tollis peccata mundi“. Es ist ein noch sündenbelasteter Chor, der sich in seinem Gesamtduktus aber gleichzeitig schon fürs Sündentragen des Sohnes Gottes bedankt. Und dass dieses Sündentragen wirklich Arbeit, Arbeit, Arbeit ist, verkörpert neben den trauernd-ächzenden Betonungen besonders die wuselnde Traversflöte, die nach ein paar Takten einsetzt. Für Herreweghes Topteam auf der Thomasempore natürlich gar kein Problem: Alles gut zusammen, alles seidig. Was für eine Freude! Wir Erdlinge hingegen mussten uns schon 1985 immer antreiben lassen, denn wenn der Chor schleppt, dann ist es auseinander, und das ist (und war) oft schade.
Latent schlechtes Umweltgewissen
Weiter geht’s im Messtext: Mit klarem Schwung hebt die Solo-Oboe den sündentragenden Sohn Gottes herrlich in den Himmel: "Qui sedes ad dextram patris". Hier tritt erstmals der Solo-Alt auf. In Leipzig ist es Alex Potter, ein besonders vortrefflicher Könner auf dem seit längerer Zeit größer gewordenen Feld exzellenter Altussänger. Wer damals, 1985, alles so Altus sang … Damit war es dann ein knappes Jahrzehnt später schon deutlich besser geworden. In das Jahr 1994 fällt nämlich meine nächste große, sehr intensive praktische Phase mit der h-moll-Messe. Zwischenzeitlich hatte sich ein Kammerchor begeisterter Mitstreiter und Kantoreiabtrünniger gegründet, das Wilhelmshavener Vokalensemble. Und wir hatten damals Glück, dass der Raffineriebesitzer unserer Stadt sein latent schlechtes Umweltgewissen mit recht großzügigen Spenden für die Aufführung Bach’scher Werke bekämpfte. Heute würde man es Greenwashing nennen, damals kannte man das Wort noch nicht. Dank ihm, dem Ölmäzen, konnten wir die beiden Passionen, das Weihnachtsoratorium und eben die h-moll-Messe von J.S. Bach aufführen – mit tollen Solisten und Orchestern in unserer friesischen Dorfkirche in Sengwarden nördlich von Wilhelmshaven.
Im Zuge der 1994-er Einstudierung erfuhr meine Bekanntschaft mit der h-moll-Messe einen gewissen Ausbau, denn ich musste das Programmheft schreiben. Und in der Kirche in Wilhelmshaven-Sengwarden, wo nur 350 Leute reinpassten, machten wir auch immer zwei Konzerte hintereinander. Insofern absolvierte ich 1994 meine h-moll-Messen-Konzerte Numero fünf und sechs. Und hören tat ich das edle Werk damals sowieso oft, denn andauernd erschien eine neue Aufnahme, die man haben musste. Es war das goldene Zeitalter der CD und des Discmans – viele eingestaubte CD-Regalmeter zuhause zeugen bis heute davon.
Doch zurück nach Leipzig: Nach dem „Qui tollis“ kommt das „Qui sedes a dexteram patris“: Alex Potter singt es von der Emporenhöhe herausragend gut, und ja, ich lege mich fest, seinen weiteren Leistungen im Credo und im Agnus Dei hier schon vorgreifend: Er war vorgestern von den Vieren der Beste, wenn man bei einem so hochklassigen Solistenquartett überhaupt differenzieren kann und will. Schon kommen wir zum „Quoniam tu solus sanctus“, einem der merkwürdigsten Stücke, die Bach je geschrieben hat: Zwei Fagotte und ein Horn (!) sind die Soloinstrumente über einem Basso Continuo. Eine per se archaische Knarzerei, aber zugleich eine wahre Preziose und ziemlich tief für den Basssänger. Da fällt es schwer, sich auszuzeichnen, zumindest wenn man eher dem baritonalen Fach zuneigt. Aber Bassist Johann Kammler kann sich durchaus behaupten. Auch das Horn (der Name des Ausführenden sei ausdrücklich genannt: Bart Cypers) ist tadellos, ja sogar Tadellöser & Wolff, wie Walter Kempowski sagen würde.
Herrliches Hörspiel
Hier muss ich etwas länger einhaken, denn das „Quoniam“ aus der h-moll-Messe treibt mir jedes Mal, wenn ich es höre, hartnäckig eine Probenerinnerung aus dem Jahr1985 in den Sinn. Es geschah vor meiner persönlichen Aufführung Nummer 2 in Bad Gandersheim: Wir hatten damals erstmals einen Luxus, den es früher bei der Kantorei in Wilhelmshaven nie gab, nämlich eine Hauptprobe mit dem Orchester und nicht nur einen generalprobenartigen Durchlauf, der dann häufig noch am Nachmittag des Konzerttags stattfand. Als ich den Probenraum betrat, es war irgendein Schulzentrum, da der Gandersheimer Dom wohl noch anderweitig besetzt war, sah und hörte ich den unvergleichlichen Sänger Max van Egmond, wie er mit den beiden Fagotten samt Violone und Orgel dieses „Quoniam“ knarzte, voller Vergnügen, aber noch ohne das Soloinstrument Horn, denn dessen Spieler steckte noch auf der Autobahn. Aber welch herrliches Hörspiel!
Max van Egmond war damals für uns ein großer Star, denn er sang oft in den Einspielungen der Bachkantaten von Harnoncourt und Leonhardt, die damals gerade in den letzten Zügen lagen und deren Sammlung man einst mit den braunen Teldec-LP-Schachteln begonnen hatte, um sie in den letzten Jahrgängen dann im prosaischen CD-Format fortzusetzen. Zu meinem akustischen Edel-Knarzerlebnis aus Bad Gandersheim ist noch anzufügen, dass es zwei Tage später im Konzert mit dem Hornisten leider genauso daneben ging wie im „Gloria“ mit den Trompeten: Kaum ein Ton stimmte, und das „Quoniam“ geriet, wie so häufig in dieser Frühzeit historischer Aufführungspraxis, unfreiwillig zu einem Stück expressiv-atonaler und letztlich sinnloser „Moderne“. Tempi passati – Gott sei Dank!
Auch das „Quoniam“ geht in das nächste Stück über, nämlich in das virtuose „Cum sancto spiritu“. Ein Moment mit absoluter Pflicht zum Hinschauen für Mezzosoprane und Tenöre, damit sie das Tempo erwischen! Bald folgen Sopran I und Alt, dann rettet erstmal das Tutti mit den ersten herrlichen Schwelltonstellen („… in gloria Dei Pa-a-a-a-a-a-a-a-a-tris“). Doch es naht für Tenöre der berüchtigte Takt 37: Soloeinsatz im Quartsprung aufs hohe A, anschließend ein stürmischer Pas de deux mit dem Alt, bis es sich dann wieder vollstimmiger gestaltet – puh. 1985 hatten wir davor nackte Angst. Und dieses Tenor-Takt-37-Problem hat erst der Chorleiter von 1994 mit uns, den dann schon etwas erfahreneren Endzwanzigern, besser in den Griff bekommen (sein Name sei gerne genannt: Ralf Popken). Welch ein Fortschritt! Und diesen Sonntag in Leipzig: Virtuos gemeistert, na klar. Und dabei haben sie sich noch nicht mal hörbar bemühen müssen. Ein einziger Gruß vom Koloraturolymp – alles in bester Fasson. Herreweghe & Co. eben …
Dann kommt in jedem h-moll-Messenkonzert zwangsläufig eine kleine Pause: Eine Stunde ist vergangen, es muss mal ausgiebig gestimmt werden, und 1000 Menschen in der Thomaskirche müssen sich auch mal – zumindest am Platz und umzu – die Beine vertreten dürfen. Ach, wie schön, dass bei aller Innovation, bei aller Abwechslung, bei allen Formaten, die gerade in der überaus segensreichen Ära Michael Maul hier entwickelt wurden, am zehnten Tage, ergo am zweiten Festsonntag, um 18 Uhr immer die h-moll-Messe das jährliche Bach-Pilgern zu Leipzig beendet - ein würdiger Schlussfels in der Bachfestbrandung.
Verflixte siebte Messe
Wann aber kam eigentlich für mich, den endlich erwachsenen Tenor, die nächste H-moll-Messe nach den beiden Anno1994? Das frage ich mich während des Stimmen des Orchesters und will mir nicht einfallen. Als Tenor, der für einen engagierten Laiensänger, der, wie Bach vielleicht sogar selbst in gnädigen Momenten formuliert hätte, „nicht schlimm einschläget“, habe ich in meinen fast zwanzig Hamburger Jahren bis 2006 zwar immer mal wieder Johannespassionen oder „WOs“ (also das Weihnachtsoratorium BWV 248) als Student (gerne auch für einen kleinen Obolus) mitgesungen, oft mehrmals pro Saison. Aber eine h-moll-Messe? Ich erinnere mich nicht, und meine verflixte siebte Messe will mir nicht einfallen … aber dann doch: 2006 war’s, zu meinem Abschied aus Hamburg und dem vorläufigen vom Harvestehuder Kammerchor. In jener Zeit hatten wir gute Beziehungen zum fantastischen Ensemble Resonanz, und die H-Moll-Messe in Februar 2006 mit ihnen war klasse. Zusammen mit der allerersten in der Wilhelmshavener Kantorei Anno 1985, an die ich keinerlei Erinnerung mehr habe, war es die einzige, die ich bisher in hoher Stimmung (also Stimmton a = 440 Herz) bewältigen musste. Doch Musizieren mit Bach und dem Ensemble Resonanz bringt einfach so viel Freude, dass ein halbes Tönchen höher auch für eher tiefe Tenöre zu verschmerzen war …
So, die Stimmpause in Leipzig ist vorbei. Bis hierher klang die Missa von 1733. Ab jetzt, mit dem großen Glaubensbekenntnis, dem Symbolum Nicenum, nehmen die deutlich später und möglicherweise erst ein Jahr vor Bachs Tod im Jahre 1749 komponierten und zusammengestellten Passagen ihren Lauf. Vier kurze ("lutherische") Messen, also nur mit Kyrie und Gloria hatte Bach ja bereits Mitte der 1730-er Jahre vorgelegt, gestrickt fast ausschließlich aus dem Musikmaterial seiner Kantaten. Zur Komplettierung der Missa von 1733 zur Missa tota kam es erst kurz vor seinem Tod.
Wieder kommen die belgischen Ausnahmekünstler rasant und aus dem Nichts, kein hörbarer Vorher-Ton nirgends: Credo in unum Deum – der altertümlich-virtuose Choral, ein Gruß aus alter Zeit – eigentlich schwer, das gut zu singen, und als Tenor darfst Du auch gleich wieder allein auf weiter Flur anfangen. Doch das Collegium Vocale Gent bringt so etwas genauso wenig ins Schwitzen, wie gleich im Anschluss das Patrem omnipotentem – das wuchtige und koloraturenreiche, besonders in der Trompete. Angeblich, so erklärten uns schon unsere Dirigenten Munz und Manig in Wildeshausen und Stadthagen 1985, sei dieses Trompetensolo der Takte 40 bis 47 eines der schwersten von Bach überhaupt. Ob das stimmt? Keine Ahnung, ich spiele nicht Trompete, aber es fällt mir ein, als schon längst das Et in unum dominum klingt. Vielleicht ist das sogar mein Lieblingsstück aus der h-Moll-Messe, weil sich Sopran und Alt wieder und wieder so unvergleichlich schön gegenseitig hervorschälen und damit dem „unvermischt und ungetrennt“ zwischen Gottheit und Menschheit besonderen Ausdruck verleihen? Dorothee Mields und Alex Potter tönen jedenfalls zusammen, dass es eine Wonne ist.
Fieses hohes Fis
Dann geht es Schlag auf Schlag: Et incarnatus est. Eigentlich so einfach: Absteigende Linien für die inkarnierten Gottessohn, dann stetes An- und Abschwellen dieses Geheimnisses, während die Violinen unverdrossen abwärts schlängeln, als wollten sie zärtlich-klagend sagen: Gott kommt herab zu dir, ja, ja, er kommt. Und Angst vor kieksenden Tönen (besonders der Tenoreinsatz auf dem hohen Fis in Takt 23 auf Vokal E ist fies) muss man bei Herreweghe & Co nicht haben, himmlisch, einfach himmlisch. Es folgt sogleich das Crucifixus etiam pro nobis: Wir können es hier nicht ausbreiten (man lese dazu den hervorragenden Wikipedia-Artikel zum Werk), aber erkleckliche Teile der h-moll-Messe sind, ähnlich wie im Weihnachtsoratorium, Parodien, also musikalische Wiederverwendungen bzw. -verwertungen wenn auch teilweise sehr weiterbearbeiteter früherer Werke Bachs. Hier, zum "Crucifixus", kramt der reife Thomaskantor Material aus dem Eingangschor einer Weimarer Kirchenkantate hervor, der folgende Worte trägt: „Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen, Angst und Not sind der Christen Tränenbrot“ (BWV 12). Passt zum Kreuz, oder? Herreweghes Interpretation in Leipzig passt auf jeden Fall: Kristallklar, nicht zu wuchtig und mit jener besonderen Genter Prise gekonnten Understatements zelebrieren der Maestro und die Seinen diese große Musik, verschmelzend mit einem homogenen, doch dabei stets plastisch formenden Orchester. Schöner schwer vorstellbar. Und zum Glück ist diese Wundermesse ja noch nicht zuende ..
Und wann war nach 2006 dann eigentlich mein nächstes Mal? Es mussten wieder zwölf Jahre vergehen und geschah dann bei dem einzigen Dirigenten, bei dem ich es zum wiederholten Male sang (sein Name sei nochmals gerne genannt: Ralf Popken). Es war 2018, vor bald sechs Jahren, als wir noch nichts von Corona und den gut zwei Jahren Unsicherheit ahnten, die ab März 2020 für alle Musici und Musikliebhaber folgen sollten, und fand in Lütjenburg statt. Dort im Holsteinischen mit einem völlig „normalen“, aber dabei besonders glücklichen und motivierten Kirchenchor, in dem sich umständehalber seit einigen Jahren mein Singeglück häuft. Durchschnittsalter 60+, aber das Ergebnis damals – man glaube es oder glaube es nicht – absolut formidabel. Sofort würde ich es dort gerne wieder machen!
Doch weiter geht's in Leipzig: Nach dem ersterbenden oder besser versinkenden Crucifixus ( ... et sepultus est) das jubelnde „Et resurrexit tertia die“. Natürlich alles tippitoppi, zum ersten Mal aber ertappe ich mich bei dem Gedanken, dass der Bach der Belgier einen Tick mehr Kante, mehr Wucht vertragen könnte. Könnten die „Rs’“ mehr rollen und damit das Ganze noch mehr Felszerbröselndes, Steinwegrollendes haben? Geschmackssache.
Dann hat der Chor nach drei Nummern endlich mal Pause, wenn der Bass sein „Et in Spiritum Dominum“ singt. Darin wird in Gestalt von zwei verliebt anbandelnden Oboen und Basso Continuo der Heilige Geist mit Gott Vater und Gott Sohn gut trinitarisch zusammengeführt. Unendlich schön. Vielleicht ist doch eher DAS mein Lieblingsstück aus der h-moll-Messe? Vorgestern leider nicht, denn hier passieren dem Bassisten, und das anzumerken ist bei dem ausnehmend hohen Gesamtniveau nicht spitzfindig, zwei wirklich nicht schöne gedrückte Vokale und zwar jeweils auf der zweiten Silbe von „ec-cles-iam“. Keine Katastrophe, klar. Aber schade, es hätte nicht passieren sollen. Andererseits: Trotz dieser kleinen Entgleisung, die in erster Linie auffiel, weil eben sonst alles so perfekt war, hatte auch der Bassist am Sonntag immer noch eine Treffer- beziehungsweise Passquote wie Toni Kroos vergangenen Freitag gegen Schottland. Insofern: Schwamm drüber.
„Jeder Tenor einmal ein Held“
Dann wird’s mystisch in Leipzig, denn das Confiteor unum baptisma hebt an. Was für ein tolles Stück; „mezzopiano, aber bekennerisch“ habe ich mit Bleistift irgendwann in meine Partitur gekritzelt. Es beginnt eher leise, und man muss höllisch aufpassen, nicht zu schleppen. Ein Walking-Basso-Continuo setzt glasklare schnelle Viertelimpulse – da hat man schnell das Nachsehen. Und dann kommt die Wahnsinnsstrecke von Takt 92 bis 118, wo Munz und Manig uns schon 1985 zuriefen: „Los, jeder Tenor einmal ein Held!“ Aber klar doch, die Chortenöre dürfen als einzige Stimmen den Cantus firmus „Confiteor unum baptisma in remissionem peccatorum“ in ganzen Pfundnoten vortragen. Herrlich, das muss kesseln, dachten wir früher! Am Sonntag in St. Thomas, der elegant verschmelzenden Interpretation der Belgier lauschend, überkommt mich eine Ahnung, dass ich bei all meinen bisherigen neun H-Moll-Messen vielleicht dort immer etwas zu dick aufgetragen habe. Ich will mich ehrlich bessern, sollte auf Erden noch eine zehnte für mich vorbeikommen.
Das „Confiteor“ endet mit einem Adagio, und das muss man gehört haben. Denn was soll, was kann man dazu mit Worten sagen? Vielleicht das, was einst der große Bachforscher Walter Blankenburg (1903–1986) schon vor Jahrzehnten darüber schrieb: „In 24, auf das Ende der Welt hinweisenden Takten durchschreitet Bach in – für seine Zeit – kühnster Harmonik und dichtester Folge von Modulationen den gesamten Quintenzirkel, der seinerseits 24 Tonarten umfaßt, um die totale Verwandlung, die das menschliche Sein in der Auferstehung erfährt, zu versinnbildlichen.“[1]
Alles klar? Ansonsten: einfach mal anhören. Früher, in den Tiefen des 20.Jahrhunderts, drohte uns in diesen 24 Takten akute Absackgefahr. Mit den Jahren und Jahrzehnten aber verinnerlicht selbst ein mittelmäßiger Tenor das Harmoniegefüge und kann nun geradezu darin baden. So geschah es in aller vornehmen Nüchternheit samt vollendeter Perfektion natürlich am Sonntag zu Leipzig, bevor Herreweghes Crew dann das Et expecto resurrectionen mortuorum – soft aber immerhin – explodieren ließ.
Danach ist ganz kurze Pause in Leipzig: ein bisschen Instrumente stimmen, einmal durchschnaufen – ein kurzer Einschnitt vor dem letzten Fünftel des Werkes. Zeit also, um mich an meine neunte und bisher letzte eigene h-moll-Messen-Aufführung zu erinnern. Sie fand vor bald zwei Jahren in Hamburg-Harvestehude statt, und ich werde sie nie vergessen. Wenige Tage vorher hatte ich, gestärkt durch die schönen Proben im Vorfeld, die (Vernunft-)Entscheidung gefällt, meine jahrzehntelange Mitwirkung in diesem wunderbaren Harvestehuder Kammerchor (von Claus Bantzer 1980 gegründet und bis 2017 geleitet und seitdem vortrefflich geführt von Edzard Burchards) zu beenden. Einziger Grund: Die wöchentlichen Anreisen zu den montäglichen Proben nach Hamburg samt folgender Übernachtung bei lieben Freunden gingen dann doch – so schön es immer war – mit der Zeit einen Tick über meine Kräfte. Man muss (spätestens!) mit Ende Fünfzig beginnen, ehrlich zu sich selbst zu sein. Hamburg 2022 war eine unbeschreiblich schöne Aufführung, ja, es war die bisher schönste meines Lebens, und es war der bestmögliche Abschluss, denn man soll ja aufhören, wenn es am schönsten ist. Wie selten gelingt das ... Dieser Chor aber wird für immer in meinem Herzen bleiben.
Halte- und Schwelltöne
Am schönsten von der Hamburger h-moll-Messe 2022 ist mir übrigens das Sanctus – dieses triolenselige Wahnsinnstück in Erinnerung. Nach dem Wogen des auf einmal sechsstimmigen (!) Chores (Alt II tritt hinzu), kommen diese einmaligen Halte- und Schwelltöne mit dem sich wahnsinnig entwickelnden Sanctus-A-Vokal. Darunter zelebriert der Bass seine weltumspannenden Oktavsprünge, und dann kommt die Fuge „Pleni sunt coeli“ – wieder ein alleiniger Tenorbeginn, wieder gefährdet in Sachen Tempo („Tenor klingt kläglich und rennt …“), doch wenn es gelingt, wie 2022 in Hamburg nahezu vollendet (und in Leipzig 2024 mit dem Herreweghe-Bachclan sowieso), dann ist der Himmel auf Erden da: Heilig, heilig, heilig … , aber keine Rührseligkeit bitte, denn gleich danach geht es attaca weiter: Osanna in excelsis. Hier kann man sich munter vertun, besonders wenn man auswendig singt – ein herrliches Stück, in dem der nun achtstimmige (!) Doppelchor samt allen Instrumenten edel-kräftige Koloraturperlenketten knüpft.
Nach diesem ersten "Osanna" bricht plötzlich eine ganz andere, zärtliche Welt ein, das „Benedictus qui venit in nomine Domine“: Berückendes Flötensolo, goldene Tenorkantilenen (großartig in Leipzig: Guy Cutting, in meiner sicher verklärten Erinnerung noch großartiger 1985: Christoph Prégardien, damals 29), und dann kommt gleich – die Liturgie der Messe fordert es also – das Osanna in excelsis noch einmal. In früheren Jahrzehnten war das Benedictus häufig eine Bedenkzeit für beim ersten „Osanna“ überraschte oder überbordende Choristen, welche Kurve sie nun noch etwas besser nehmen könnten. Prinzip Second Chance …
Dann aber geht es wirklich zu Ende: „Agnus Dei“, das vorletzte Stück dieser unvergleichlichen Messe hebt an. Eine einmalige Altarie … denkt man. Ist es natürlich auch, aber nein, ist es nicht wirklich. Ich weiß noch, es muss wohl 1994 im Zuge meiner Konzertprogrammbemühungen gewesen sein, wie pikiert ich war, als mir die Literatur auch diese Arie als Parodie entlarvte. Heute macht es die Sache nur schöner. Zugrunde liegt dem Stück eine andere Altarie, und zwar aus dem Himmelfahrtsoratorium BWV 11 – dort einen halben Ton höher notiert, a-moll statt g-moll, und in der Singstimme gleich mit dem Motiv einsteigend, das in der h-moll-Messe für die Worte „qui tollis peccata mundi“ verwendet wird. Die vier ersten Takte wenigstens („Agnus dei“), die hat Bach wohl neu komponiert und nicht nur das, sondern der Vergleich gerade dieser beiden Stücke zeigt eigentlich, wie genial Bach das von neuzeitlichen Nichtwissern oft abschätzig betrachtete Parodieverfahren nutzte, um einst gefundene musikalische Motive zu verändern, zu veredeln und zu verstärken.
„Ach fliehe nicht so bald von mir“
Der Text des A-Teiles, aus dem das „Agnus Dei“ gestrickt ist, lautet im etwa 1738 entstandenen Himmelfahrtsoratorium so: „Ach bleibe doch, mein liebstes Leben, ach fliehe nicht so bald von mir“. Passt total zum leidenden Gotteslamm, und passt auch zum Ende dieses großen Werkens, denn wenn der letzte Ton, ein unisono klingendes „G“ verklingt, so ergeht es mir jedenfalls in Leipzig, möchte man nicht glauben müssen, dass die h-moll-Messe nun von einem erstmal scheidet ... "Ach, bleibe doch! Zwar kommt noch der Schlusschor „Dona nobis pacem“, aber „nur“ mit dem vom „Gratias“ bekannten Material. Doch unendlich schön ist das Stück meist und ist es auch in Leipzig, wo Alex Potter und die Sologeige noch mal alles auspacken. Danke Philippe Herreweghe für eine befreiende, maßstabsetzende Aufführung! Und natürlich ein unendlicher Dank an Johann Sebastian Bach, den fünften Evangelisten. Manchmal ertappe ich mich dabei, dass ich für ihn die anderen vier dahingeben würde. Viele tun das ja, aber es ist kein Muss.
Ein Muss ist für mich aber, der nächsten Bachfest-Aufführung der h-moll-Messe in der Thomaskirche wieder beizuwohnen. Hoffentlich klappt es! Und allen, die auch dabei sein möchten: Sie wird – so Gott will und wir leben – am Sonntag, 22. Juni 2025 um 18 Uhr erklingen, und – das ist bereits amtlich – es musiziert Ton Koopman mit seinem Amsterdam Baroque Orchestra samt Chor. Es wird also wieder himmlisch, denn auch das ist bei dieser Besetzung eigentlich schon amtlich.
PS: Und wann wird der Autor dieser Zeilen seine zehnte h-moll-Messe singen? Er weiß es nicht. Für Koopmans Chor 2025 reicht es wohl leider nicht, es sei denn, die EU legt ein spezielles Förderungsprogramm für Senior Tenors auf …
Ansonsten bleibt der himmlische Chor.
Der wartet auf jeden.
Halleluja!
[1] Walter Blankenburg. Einführung in Bachs h-moll-Messe, DTV/Bärenreiter, 2.Auflage 1982, 86 f.
Reinhard Mawick
Reinhard Mawick ist Chefredakteur und Geschäftsführer der zeitzeichen gGmbh.


