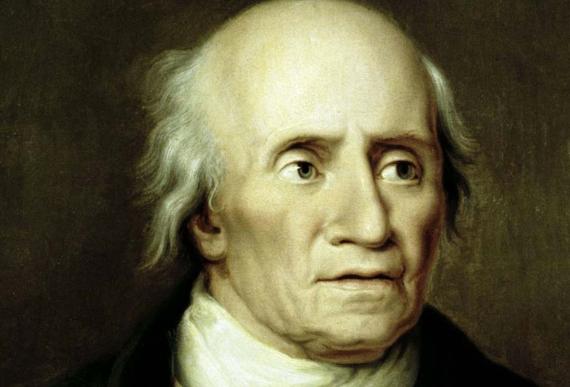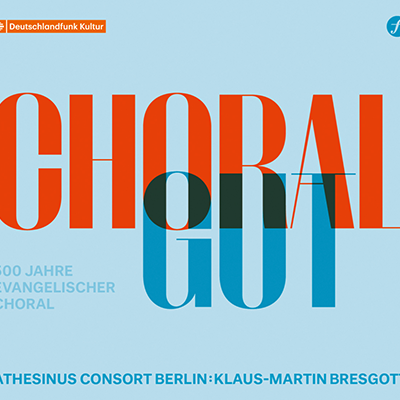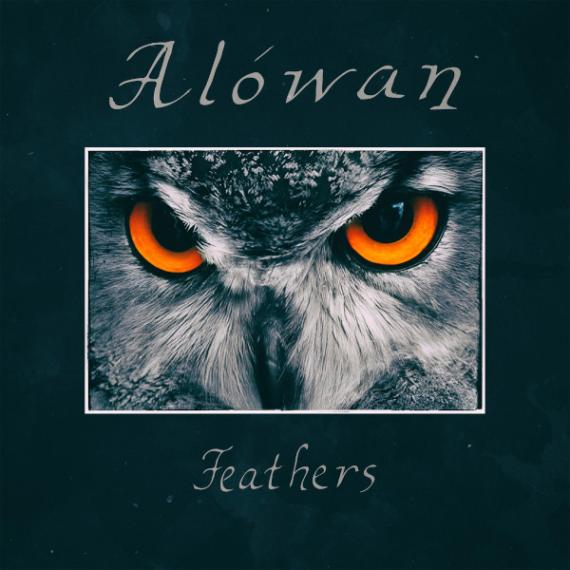„Schiebe mich nicht zu den Verlorenen“

Franz Kafkas Verhältnis zum Judentum war ambivalent. Über sich und andere Juden seiner Generation schrieb er: Mit dem „Hinterbeinchen klebten sie noch am Judentum des Vaters und mit den Vorderbeinchen fanden sie keinen neuen Boden“. Wie hielt es Kafka mit der Religion? Eine Erkundung von Karl-Josef Kuschel, emeritierter Professor an der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Tübingen.
In einem Briefentwurf Franz Kafkas an den Vater von Felice Bauer heißt es am 21. August 1913: „Mein Posten ist mir unerträglich, weil er meinem einzigen Verlangen und meinem einzigen Beruf, das ist in der Literatur, widerspricht. Da ich nichts anderes bin als Literatur und nichts anderes sein kann und will, so kann mich mein Posten niemals zu sich reißen, wohl aber kann er mich gänzlich zerrütten. Davon bin ich nicht weit entfernt.“ Als diese Zeilen geschrieben werden, sind zwei Entwicklungen in Kafkas Leben eingetreten. Im August 1912 hatte er die in Berlin lebende und aus einer Familie jüdischer Herkunft stammende 25-jährige Felice Bauer kennen gelernt, eine Frau, die für den mittlerweile 29-jährigen Juristen und Angestellten einer Prager Versicherungsanstalt erstmals als potenzielle Braut infrage kommt. Und nur wenige Wochen später erlebt Kafka nach eigenem Selbstverständnis seinen Durchbruch als Schriftsteller, als er in einer einzigen Nacht, der vom 22. auf den 23. September 1912, seine Erzählung „Das Urteil“ niederschreibt. Damit ist ihm endgültig bewusst geworden: Er interessiert sich nicht bloß für Literatur wie andere, die Lesen als Freizeitvergnügen oder Ablenkung vom Alltag begreifen. Er ist Literatur. Sie ist alles, was seine Existenz ausmacht, alles, was zu seinem Wesen gehört. Bitter ernst ist es ihm, wenn er das von sich preisgibt: „Da ich nichts anderes bin und sein kann als Literatur …“
Damit aber prägt ein unauflösbarer Zwiespalt Kafkas Leben. Auf der einen Seite steht „Felice“ und mit ihr seine und ihre Familie mit der Erwartung eines bürgerlichen Lebens: mit Beruf, Ehe, Familie, Sicherheit in geordneten Verhältnissen. Und auf der anderen Seite die kompromisslose Hingabe an die Kunst, an das Schreiben-Müssen, an die Selbstverpflichtung des Schriftstellers auf nichts als das Werk. Dabei weiß Kafka, dass beide Welten ihr Recht haben; das aber macht gerade seine Zerrissenheit aus. Was er bei der einen gewinnt, verliert er bei der anderen. Beides ist ihm so unerträglich wie notwendig. Mit der Konsequenz: Für eine Seite sich zu entscheiden, in einem Leben glücklich zu werden, wird Kafkas Sache nie werden. Eindeutigkeiten im Leben, das So-und-nicht-Anders, das will ihm weder in der Kunst noch im gelebten Leben gelingen. Die schließlich eingegangene Verlobung mit Felice wird denn auch aufgelöst. Später folgt eine zweite. Bis zum Ende lebt Kafka mit einem Riss zwischen Kunst und Leben, zwischen literarischer und bürgerlicher Existenz. Einem Riss, dessen Wirkungen er freilich luzide durchschaut, ist doch die Nichtidentität zugleich Movens literarischer Produktivität.
Strukturell ähnlich verhält es sich mit Kafkas Verhältnis zum Komplex Religion, näherhin mit seinem Verhältnis zum Judentum, aus dem er familiär stammt. In einem Brief an Max Brod, seinem engsten jüdischen Freund und Weggefährten, vom Juni 1921 analysiert Kafka schon in der Rückschau auf viele Jahre Erfahrungen mit Juden und Judentum in seiner Heimatstadt Prag das „Verhältnis der jungen Juden zu ihrem Judentum“. Kafka konstatiert eine „schreckliche innere Lage dieser Generationen“. Wörtlich: „Weg vom Judentum, meist mit unklarer Zustimmung der Väter (diese Unklarheit war das Empörende), wollten die meisten, die deutsch zu schreiben anfingen, sie wollten es, aber mit den Hinterbeinchen klebten sie noch am Judentum des Vaters und mit den Vorderbeinchen fanden sie keinen neuen Boden. Die Verzweiflung darüber war ihre Inspiration.“
Gewohnt analytisch scharf beschreibt Kafka hier die Gespaltenheit, ja Zerrissenheit jüdischer Existenz in der Welt der Moderne, genauer: in der Welt der modernen westlichen Großstädte nach Verlassen der geschlossenen jüdischen Wohngebiete auf dem Land. Das gilt vor allem für diejenigen Juden, welche sich in Prag die deutschsprachige Kultur anverwandelt und mit ihr auch den sozialen Aufstieg geschafft hatten. Kafkas geschäftlich erfolgreicher Vater Hermann gehört dazu. Welch ein Bild: Mit „Hinterbeinchen“ kleben solche Juden noch „am Judentum des Vaters“, aber „mit den Vorderbeinchen“ finden sie „keinen neuen Boden“. Sie leben folglich eine Käferexistenz wie Gregor Samsa in Kafkas Käfer-Erzählung „Die Verwandlung“, nur wenige Wochen nach dem „Urteil“ niedergeschrieben. Will sagen: Ein Zurück in die Glaubensfestigkeit jüdischer Orthodoxie gibt es für sie nicht, und zugleich ist ihre Zukunft „als Juden“ völlig offen, buchstäblich bodenlos. Eine Schwebeexistenz also zwischen Tradition und Moderne.
Identität und Anpassung
Einige von Kafkas literarischen Texten spiegeln das. Es sind Sondierungen, Probebohrungen vergleichbar. Mit jeweils einer ganz eigenen Versuchsanordnung. Sie kreisen um Themen wie Identität und Anpassung, Künstlertum des Einzelnen und dessen Verhältnis zur Gemeinschaft. Ein Beispiel dafür ist Kafkas im April 1917 veröffentlichte Erzählung: „Bericht für eine Akademie“. Eine skurrile Geschichte, keine Frage, diese Erzählung vom Grenzgängertum zwischen Tier und Mensch. Kafka nimmt hier die literarische Tradition der Tierparabel auf und lässt sie einen Affen erzählen, der eingefangen wurde bei einer Jagdexpedition und Monate in einem Käfig gehalten wird, bevor man ihn in einem Varieté auftreten lässt. Dann wird das Tier von einer „Akademie“ eingeladen, um über sein Vorleben zu berichten, und dieser Bericht handelt von nichts anderem als seinem Versuch der Selbstverleugnung als Tier, um sich der Menschenwelt anzupassen, sie buchstäblich „nachzuäffen“ – mit dem Ziel, ein „Mensch“ zu werden. Kafka kleidet also die Problematik mühsamer „Menschwerdung“, mühsamer Akzeptanz in der Menschenwelt in die groteske Geschichte eines Tieres, das sich als Menschenimitator versucht.
Unter der Tiermaske
Man geht in diesem Fall nicht fehl, wenn man den Text unter der Tiermaske als Gleichnisgeschichte auch autobiografisch liest. Denn so, wie es für den Affen keine Rückkehr mehr gibt zu seinem früheren Affenleben, so auch für Kafka keine Rückkehr in ein orthodoxes jüdisches Leben von einst. So aber, wie es für den Affen nur eine Nachahmung des Menschlichen gibt, eine imitierende Zurschaustellung im Varieté der Welt, so auch für den „Mensch gewordenen“ Franz Kafka als Künstler und als einen die Assimilation verachtenden Angehörigen des jüdischen Volkes. Damit ist für uns ein Kreis geschlossen, und wir erkennen bei Kafka einen engen Zusammenhang zwischen seiner Selbstwahrnehmung als Künstler und seiner Selbstwahrnehmung als Angehöriger eines Judentums, wie er es im heimischen Prag kennengelernt hatte.
Im literarischen Werk freilich wird dieser Zusammenhang direkt nicht thematisch. Nirgendwo beschreibt Kafka einen Menschen jüdischer Herkunft, der an Diskursen über Judentum oder Zionismus teilgenommen hätte. Das Wort „Jude“ kommt in keinem seiner literarischen Texte vor. Aber dieser Autor tut etwas viel Wichtigeres: Er findet und erfindet Geschichten, in denen sich die exterritoriale Situation des modernen Menschen in grundsätzlicher Weise buchstäblich verdichtet.
Das kommt literarisch nirgendwo treffender zum Ausdruck als in dem später in seiner Schlüsselbedeutung für das Werk erkannten Prosastück „Vor dem Gesetz“, ursprünglich Teil des Romans Der Prozess, später auch als Einzelstück veröffentlicht. Hier kann man exemplarisch das Unverwechselbare an Kafka zu verstehen suchen. Dabei darf der Text nicht, wie vielfach geschehen, allein auf Bezüge zum Judentum reduziert werden. Er ist vielmehr so gefasst, dass er auf eine grundsätzliche Situation von Menschen in der Moderne des frühen 20. Jahrhunderts verweist, ob Jude oder Nichtjude. Spiegelt denn nicht in der Tat diese Parabel von einem „Mann vom Lande“, der vor einer von einem Türhüter bewachten Tür bis zu seinem Ende ausharrt, ohne Zugang zum „Gesetz“ zu finden, die Situation ungezählter Menschen zu Beginn des 20. Jahrhunderts? Menschen leben doch weitgehend in einem jeweiligen „Davor“, leben im Zustand der Nicht-Zugänglichkeit zu einer traditionellen religiösen oder politischen Ordnung, der Nicht-Erfahrung einer institutionellen Geborgenheit. Ungezählte Menschen also leben grundsätzlich vor oder neben einer solchen Welt der Ordnung. Sie finden keinen Zugang oder keinen Zugang mehr. Leben im Vor-Raum. Leben „vor dem Gesetz“.
Zugleich aber gibt es neben dem literarischen noch ein zweites, ein autobiografisches „Werk“ dieses Schriftstellers. Es ist vom Umfang her durchaus beträchtlich und umfasst unter anderem zahlreiche Aufzeichnungen, Aphorismen, Tagebuch- und Briefäußerungen. Dass es überhaupt erhalten geblieben ist, verdanken wir dem Freund und Nachlassverwalter Kafkas, Max Brod, der sich über den entsprechenden Vernichtungswunsch des Freundes aller seiner nicht gedruckten Texte hinweggesetzt hat. Zum Glück. Dieses Material ist nicht zu systematisieren. Aber gewisse Grundthemen und Stilelemente lassen sich erkennen. Da stehen pointierte Aphorismen mit blitzartigen Perspektivenwechseln neben längeren meditativen Passagen. „Ein Käfig ging einen Vogel suchen“, lautet so ein Satz. Oder: „Einer staunte darüber, wie leicht er den Weg der Ewigkeit ging; er raste ihn nämlich abwärts.“ Oder: „Ein Glaube wie ein Fallbeil, so schwer, so leicht.“
Solchen und vielen anderen geistig funkelnden Aphorismen stehen längere Reflexionen wie diese gegenüber: „Der Mensch kann nicht leben ohne ein dauerndes Vertrauen zu etwas Unzerstörbarem in sich, wobei sowohl das Unzerstörbare als auch das Vertrauen ihm dauernd verborgen bleiben können. Eine der Ausdrucksmöglichkeiten dieses Verborgenbleibens ist der Glaube an einen persönlichen Gott.“
Aufzeichnungen dieser Art haben vor allem in den Tagebüchern ihre größte Dichte dort erfahren, wo sich Kafka mit biblischen Überlieferungen auseinandersetzt. Kafka als Bibelleser: Das ist für uns ein Stück Erhellung traumatischer Lebenszusammenhänge; ein Stück Trauerarbeit an Nichtgelungenem, Gescheitertem; ein Stück Einholung der Bibel in ein Gespräch buchstäblich über Leben und Tod. Was meinte Kafka, wenn es im „Tagebuch“ heißt: „Nur das Alte Testament sieht“? Es ist die Zeit, in der Kafka einen neuen Höhepunkt im selbstquälerischen Prozess erlebt, ob er mit Felice Bauer eine zweite Verlobung eingehen soll. Vom 2. bis 13. Juli 1916 verbringen sie gut zehn Tage im tschechischen Marienbad.
Mitleid, Wollust, Feigheit
Tagebuch 5. Juli: „Mühsal des Zusammenlebens. Erzwungen von Fremdheit, Mitleid, Wollust, Feigheit, Eitelkeit und nur im tiefen Grunde vielleicht ein dünnes Bächlein, würdig, Liebe genannt zu werden, unzugänglich dem Suchen, aufblitzend einmal im Augenblick eines Augenblicks. Arme Felice.“ Einen Tag später noch konkreter. 6. Juli 1916: „Unglückliche Nacht. Unmöglichkeit, mit F. zu leben. Unerträglichkeit des Zusammenlebens mit irgendjemandem. Nicht Bedauern dessen; Bedauern der Unmöglichkeit, nicht allein zu sein. Weiter aber: Unsinnigkeit des Bedauerns, sich Fügen und endlich Verstehen. Von der Erde aufstehn. Halte dich an das Buch.“ „Das Buch“? Was gemeint ist, zeigt die nächste Eintragung: „Nur das Alte Testament sieht – nichts noch darüber zu sagen.“
Keine 14 Tage später aber sollte es aus Kafka einmal förmlich herausbrechen, in einem bei ihm so seltenen, direkt gebetsartigen Text. 20. Juli 1916: „Erbarme Dich meiner, ich bin sündig bis in alle Winkel meines Wesens. Hatte aber nicht ganz verächtliche Anlagen, kleine gute Fähigkeiten, wüstete mit ihnen, unberatenes Wesen, das ich war, bin jetzt nahe am Ende, gerade zu einer Zeit, wo sich äußerlich alles zum Guten für mich wenden könnte. Schiebe mich nicht zu den Verlorenen. Ich weiß, es ist eine lächerliche, in der Ferne und schon sogar in der Nähe lächerliche Eigenliebe, die daraus spricht, aber lebe ich einmal, so habe ich auch die Eigenliebe des Lebendigen, und ist das Lebendige nicht lächerlich, dann auch seine notwendigen Äußerungen nicht. Arme Dialektik! [Bin ich verurteilt, so bin ich nicht nur verurteilt, zum Ende, sondern auch verurteilt mich bis zum Ende hinein zu wehren.]“
Religiöse Reflexionen
Welch ein Verlust also, dass all diese „Splitter“ religiöser Reflexionen, Meditationen und Exegesen keine literarische Form gefunden haben, wie wir sie aus seinen Druckwerken kennen. Kafka stirbt zu früh, als dass er dies alles zu einer großen Synthese hätte verarbeiten können – wenn er es gekonnt oder gewollt hätte. Auch ist es ihm nicht vergönnt, den Plan zu verwirklichen, den er mit seiner letzten Partnerin, Dora Diamant, ein Jahr vor seinem Tod gefasst und auf den er sich durch intensives Hebräischstudium vorbereitet hatte: die Übersiedlung nach Palästina, um dort dann doch seine Zugehörigkeit zum jüdischen Volk unter Beweis zu stellen. Aber auch diesen Plan macht sein kranker Körper zunichte. Der Tod kommt schon, als Kafka gerade 40 Jahre alt ist. Er kommt am 3. Juni 1924 in einem Lungensanatorium im österreichischen Kierling bei Klosterneuburg. Die 1917 ausgebrochene Tuberkulose-Erkrankung hatte sich nicht beherrschen lassen und sich zuletzt noch auf den verstummenden Kehlkopf gelegt. Aber noch am Tag zuvor sieht man diesen Mann Druckfahnen korrigieren. Es sind die Fahnen des Prosabandes, der sein letzter werden sollte: „Ein Hungerkünstler“.
Literatur:
Karl-Josef Kuschel: Auf dem Seil: Franz Kafka. Eine Würdigung. Patmos Verlag, Stuttgart-Ostfildern 2024, 152 Seiten, Euro 18,–.
Karl-Josef Kuschel
Dr. Karl-Josef Kuschel ist emeritierter Professor für Ökumenische Theologie. Er lebt in Tübingen.