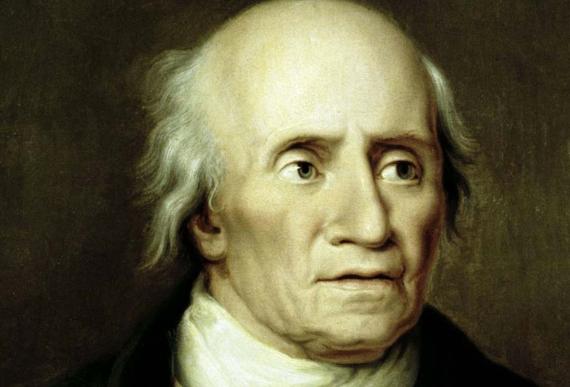„Eines Menschen Fall als Fall der Menschheit“

Seit einer Woche sorgt der neue Roman von Benjamin Stuckrad-Barre für Aufsehen in der Literatur- und Medienszene. Unser Autor Karl Tetzlaff, promovierter Systematischer Theologe an der Universität Halle/Saale, hat das Buch gelesen und dem theologischen Subtext des Werkes nachgespürt.
„Literatur ist absolute Subjektivität.“ So lautet Benjamin von Stuckrad-Barres Antwort auf die journalistischen Dauerfragen nach dem Realitätsbezug seines kürzlich erschienenen Romans „Noch wach?“. „Ich habe einen Roman geschrieben, wirklich einen Roman, und der ist fiktiv“, gibt er im Exklusivinterview mit dem Magazin DER SPIEGEL zu Protokoll. Allerdings sei „die beste Vorlage für Fiktion“ immer noch „die Wirklichkeit“.
Dass im Hintergrund von „Noch wach?“ offensichtlich reale Ereignisse stehen, die sich im Berliner Axel-Springer-Hochhaus und anderswo zugetragen haben (sollen), wird von ihm gar nicht bestritten. Allerdings verwehrt er sich dagegen, sein Buch auf einen „Schlüsselroman“ zur sogenannten „Reichelt-Affäre“ zu reduzieren. Allein als Inspirationsquelle hätten ihm diese und andere reale Begebenheiten gedient, sagt Stuckrad-Barre, um daraus Literatur zu machen. Und „Literatur“ sei eben idealerweise „absolute Subjektivität“ und nicht der Versuch, eine (vermeintlich) objektive Beschreibung der Wirklichkeit zu liefern – um sich dann damit „in allerlei gesellschaftliche Debatten einzumischen und Position zu beziehen“, wie es die „Podiumsdiskussionsschriftsteller“ gern täten.
Doch der betont subjektive Blick, der literarischen Texten nach Stuckrad-Barres Verständnis zugrunde liegen sollte, macht diese nicht zu einer durch und durch subjektivistischen Angelegenheit. „Bestenfalls“, sagt er im SPIEGEL-Interview, „kann“ Literatur so „eine tiefere, allgemeingültigere Wahrheit freilegen. Eines Menschen Fall als Fall der Menschheit.“ Gerade wenn sie allein dem subjektiven Blick ihres Autors verpflichtet sind und nicht so tun, als verkündigten sie DIE Wahrheit, vermögen literarische Texte demnach einen exemplarischen Charakter zu entfalten. Dann wird, so Stuckrad-Barre, was für einen Menschen existenziell der Fall ist, zum Fall der Menschheit, weil sich andere in der fiktionalisierten Erfahrungswelt eines individuellen Autors wiederfinden können.
„Manches aus dem christlichen Symbolgehalt“
Stuckrad-Barres Formulierung „Eines Menschen Fall als Fall der Menschheit“ macht theologisch hellhörig. Auch wenn der ihm verwandte Ich-Erzähler von „Noch wach?“ bekennt, „in den Jahren des düsteren Schreckensregimes“ in einem „christlichen Elternhaus […] für alle Zeit extremsäkularisiert“ (313) worden zu sein, scheint sich dem schriftstellernden Pfarrerssohn doch manches aus dem christlichen Symbolhaushalt erhalten zu haben. Zumindest liegen Assoziationen nicht fern an eine berühmte Stelle aus dem Römerbrief des Paulus. Dort werden Adam und Jesus einander als exemplarische Figuren entgegengesetzt, deren je besonderer „Fall“ – ein doppeldeutiges Wort – in unterschiedlicher Weise „für alle Menschen“ (Römer 5,18) relevant geworden sei. Während das schuldhafte Handeln des einen Verdammnis und Tod gebracht habe, habe das gerechte Tun des anderen Heil und neues Leben bewirkt.
Stuckrad-Barres Ich-Erzähler scheint beide Figuren in sich zu vereinen. Sein literarisch verdichteter „Fall“ kann als ein Herausfallen aus dem paradiesischen Zustand einer „träumenden Unschuld“ (Paul Tillich) verstanden werden. Zugleich wird er im Verlauf der Geschichte plötzlich und etwas widerwillig zum Retter für andere. Liest man „Noch wach?“ vor diesem Hintergrund lässt sich darin ein interessanter theologischer Subtext entdecken. Das soll im Folgenden an einigen Romanpassagen gezeigt werden.
Wenn der als Schriftsteller tätige Ich-Erzähler von „Noch wach?“ im zweiten Kapitel des Romans die Bühne betritt, befindet er sich an einem ausdrücklich als „Paradies“ (177) bezeichneten Ort. Es ist das legendäre Hotel Chateau Marmont in West Hollywood, wo er gemeinsam mit anderen Alltagsflüchtigen ein von Arbeit und sonstiger Mühsal befreites Dasein pflegt. Insbesondere die Mondnächte am hauseigenen Swimmingpool verhelfen den Anwesenden zur Flucht aus der „lästige[n] Gegenwart“ (19): „Da war zwar vordergründig manches los (bei, natürlich, absolutem Stillstand), und obzwar sehr, sehr viel geplappert wurde, […] so trat (dabei und dadurch) im Kopf dennoch das Ersehnte ein, eben: Ruhe. Ach, diese Ruhe. Absolutes Hinschweigen. Endlich.“ (29)
„Natürlich ein Opfer im eklatanten Maße“
Doch im „surreale[n] Garten Eden des Hotels“ (24), wo mehr Schein als Sein herrscht, wird es für den Ich-Erzähler bald ungemütlicher. Der „MeToo-Skandal“ wirft seinen Schatten voraus. Unter den Hausgästen befindet sich nämlich die Schauspielerin Rose McGowan, die auch im realen Leben zu den vielen Missbrauchsopfern des Filmproduzenten Harvey Weinstein gehört und als erste mit ihrer Geschichte an die Öffentlichkeit gegangen ist. Sie führt dem Ich-Erzähler vor Augen, wie lange er selbst schon Teil des Me Too-Problems ist, indem sie ihm eine Monica Lewinsky-Biografie schenkt.
Als Gagschreiber in der Harald-Schmidt-Show hatte sich der Ich-Erzähler in den 1990er-Jahren an der medialen Verhöhnung Lewinskys beteiligt. Nun wird ihm bewusst, dass sie „natürlich ein Opfer gewesen war, in eklatantem Maße“ und findet es rückblickend „seltsam, wie unzugänglich uns dieser Gedanke damals gewesen war“ (171). In die unschuldig-unbedarfte Atmosphäre des Hotelgartens hält eine Schwere Einzug: die Schwere einer bislang unbewussten Schuld, der sich der Ich-Erzähler nicht mehr verschließen kann. Als er am Ende des Romans damit konfrontiert wird, dass es auch unter dem Personal des Chateau Marmont zu Missbrauchsfällen gekommen sei, wird ihm vollends klar, dass selbst „dieses letzte Paradies“ (372) jenseits von Eden liegt.
Doch nicht nur die paradiesische Weltentrücktheit des Hotels wird durch den von außen andrängenden MeToo-Problemdruck desillusioniert. An einer Stelle des Romans überkommt den Ich-Erzähler, der „eigentlich über LIEBE schreiben“ (151) wollte, sich aber nun mit gegenteiligen Themen konfrontiert sieht, die Erinnerung an vergangene „Szenen einer Freundschaft, nein, Freundschaft fasste es nicht, es waren – Szenen einer Liebe“ (78). Er schaut zurück auf eine Reihe von erfüllenden Momenten, die er mit seinem namenlos bleibenden „allerbeste[n] Freund“ (50) erlebt hat. Beispielsweise erinnert er einen Spaziergang „durchs verschneite Fextal ins Sils Maria, ein ganzes Tal nur für uns, die großen und allergrößten, vielleicht gar letzten Fragen erörternd“ (78).
Moralische Frage nach Gut und Böse
Nicht minder paradiesisch anmutende Szenen wie diese aber werden zunehmend dadurch entzaubert, dass der Freund, seines Zeichens Besitzer eines großen deutschen Boulevardsenders mit immer rechtslastigerer Ausrichtung, einen sexistischen Chefredakteur hofiert. Auf dessen fragwürdiges Gebaren weiblichen Untergebenen gegenüber wird der Ich-Erzähler ebenfalls am Hotelpool aufmerksam gemacht. Er trifft dort eine junge Journalistin, die des Nachts klebrig-doppeldeutige Kurznachrichten von ihrem Vorgesetzten, dem Chefredakteur, zugeschickt bekommt. Sein Freund aber hält weiter am Chefredakteur fest – auch als der Ich-Erzähler immer mehr Fälle herbeizitieren kann, in denen dieser seine Machtposition zum eigenen sexuellen Vorteil ausgenutzt hat.
Die schließlich zerbrechende Liebesfreundschaft zwischen beiden Männern verliert infolgedessen ihr Unschuld. Sie wird für den Ich-Erzähler zunehmend unerträglicher. Er sieht sich plötzlich gezwungenen, seine normalerweise unentschiedene, leicht zynische Beobachterposition zu verlassen. „Es läuft meinem Wesen völlig zuwider, irgendwelche politischen Ansichten in einem STREITGESPRÄCH zu äußern“, sagt er, „ich habe auch gar nicht so viele, oder vielleicht auch viel zu viele, jedenfalls bevorzuge ich es, andere damit nicht zu belästigen. Neuerdings zwang mein Freund mich praktisch dazu, immer wieder.“ (75)
Angesichts der durch das sexistische Verhalten des Chefredakteurs betroffenen Frauen vermag er sich einer Positionierung nicht mehr zu entziehen. Es stellt sich ihm unweigerlich die moralische Frage nach Gut und Böse, der er stets harmonie-, ja paradiesbedürftig hat ausweichen wollen. Zugleich merkt er, wie schwierig diese Frage zu beantworten ist – gerade im Blick auf die gegen den Chefredakteur erhobenen Vorwürfe, die juristisch nur schwer zu greifen sind. Auch die betroffenen Frauen müssen schließlich einräumen, sich irgendwann einmal auf dessen manipulatives Spiel eingelassen zu haben. Die Anbahnungsstrategie des Chefredakteurs wird im ersten Kapitel des Romans plastisch geschildert. Dass es ihm „wirklich um DICH ALS PERSON“ geht und du „absolut OUTSTANDING“ bist, war die Botschaft, mit der er seine weiblichen Angestellten zu ködern wusste.
„Er … sah aus wie Jesus“
„War ich denn eigentlich objektiv, was den Chefredakteur betraf? Nein, natürlich nicht. Aha. War das gut? Mir egal. War es gerecht? Nee, vielleicht nicht, aber – WAS aber? Ach ja, die ergiebigste Form des Selbstgesprächs ist und bleibt das STREITGESPRÄCH“, das der Ich-Erzähler in unentwegten Gewissensbefragungen mit sich führt. „Wer sich frei von solcher Ambivalenz fühlt, poste den ersten Stein. Ich ganz bestimmt nicht“ (266), gesteht er sich dabei ein. Jesus, der im Johannesevangelium ganz ähnliche Worte spricht („Wer ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein“, Johannes 8,8), tritt übrigens bereits am Anfang des Romans auf. Über „Brandon“, einen weiteren Dauergast des Chateau Marmont heißt es: Er „sah aus wie Jesus, wirklich genau wie Jesus, Bart und Haare, Gesicht und Figur, alles, nur trug er andere Kleidung […]. Brandon strahlte jetzt und rief nach mir, hier schau nur! Er habe jetzt die Lösung FÜR ALLES gefunden, wir seien gerettet.“ (26)
Das biblisch inspirierte Eingeständnis der eigenen Ambivalenz scheint für den Ich-Erzähler zumindest Teil einer rettenden Lösung zu sein, um mit der moralisch fragwürdigen Situation, mit der er sich konfrontiert sieht, umzugehen. Der Journalist Dirk Knipphals hat „Noch wach?“ in diesem Sinne in der taz einen „Roman über das Verstricktsein in haltlose Zustände“ genannt, der von schier unüberwindlichen „Hilflosigkeitserfahrungen“ erzähle. Doch partizipiert die Einsicht in die eigene Verstricktheit, um ein klassisches theologisches Argument aufzugreifen, nicht auch schon ein wenig an deren Überwindung?
Als der Ich-Erzähler die ihm von Rose McGowan überreichte Lewinsky-Biografie aufschlägt, entdeckt er darin eine Botschaft: „Wenn sie sich dir anvertrauen – sei kein Arschloch. […] Hör ihnen zu. Und dann setz dich für sie ein.“ Diese Aufforderung beherzigt er, indem er den Frauen zu helfen versucht, die durch den Chefredakteur geschädigt wurden. Er überredet seinen Freund zu einem unternehmensinternen Compliance-Verfahren, das jedoch am Ende zu keiner Veränderung führt, sondern nur den Beschuldigten im Amt bestätigt.
„Lasst uns mal ein bisschen lachen“
Zudem entwickelt er sich aber zu einer Art Telefonseelsorger, bei dem die betroffenen Frauen „fortlaufend Beichten und Berichte“ (262) abladen. In einer Zoom-Konferenz mit potenziellen Belastungszeuginnen betätigt er sich mithin als therapeutischer Gesprächsleiter. Nach bedrückenden Erfahrungsberichten aller Anwesenden, zu denen auch er einen selbsterlebten Missbrauchsfall beisteuert, scheint ihm plötzlich die Gelegenheit „günstig, ins Heitere zu wechseln: Lasst uns mal ein bisschen lachen – vielleicht lest ihr mir einfach ein paar von seinen Nachtnachrichten vor?“ (293) Es folgt eine Präsentation der abstoßendsten Distanzlosigkeiten des Chefredakteurs, die aus Sicht des Ich-Erzählers dafür sorgt, dass die Frauen augenblicklich „einen ganz guten Abstand […] zu all dem“ finden, was sie bedrückt. „Wenigstens in dieser Situation“ nämlich, so bemerkt er, vermag einmal „die Frau zu gewinnen, die die widerwärtigste Nachricht vorweisen“ (294) kann.
Das erscheint angesichts der realen Folgenlosigkeit ihrer Erfahrungen, die im Fortgang der Geschichte erzählt wird, als ein schwacher Trost. Doch wenigstens für einen Moment stellt sich in dieser Gemeinschaft der Verletzten eine Situation ein, in der alle das Gehör finden, das ihnen ansonsten verwehrt bleibt und in der so das Beschwerende kurz etwas leichter wird. „Andächtige Stille. Kurz fühlen wir uns alle, ich sogar auch, sehr mutig“ (289), stellt der Ich-Erzähler, dem ansonsten Gruppenkonstellationen eher verdächtig sind, im Verlauf des Gesprächs völlig unironisch fest.
Irgendwo zwischen Adam und Jesus, so habe ich eingangs behauptet, ist Stuckrad-Barres Protagonist angesiedelt. Aus der unschuldigen Traumlandschaft eines Paradieses vertrieben, muss er sich in der unübersichtlichen Gemengelange seines Lebens irgendwie zwischen Gut und Böse orientieren. Dabei versucht er trotz aller ihm eigenen Ambivalenz und Schuldverstricktheit etwas zum Besseren zu wenden, ohne wie andere Jesus-Figuren gleich eine rettende „Lösung FÜR ALLES“ parat zu haben. „Eines Menschen Fall als Fall der Menschheit.“ Wer mag, kann sich darin wiederfinden.
Die im Text angegebenen Seitenzahlen beziehen sich allesamt auf: Benjamin von Stuckrad-Barre, Noch wach? Roman, Köln 2023.
Karl Tetzlaff
Karl Tetzlaff ist promovierter Systematischer Theologe und Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Systematische Theologie/Ethik der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg.