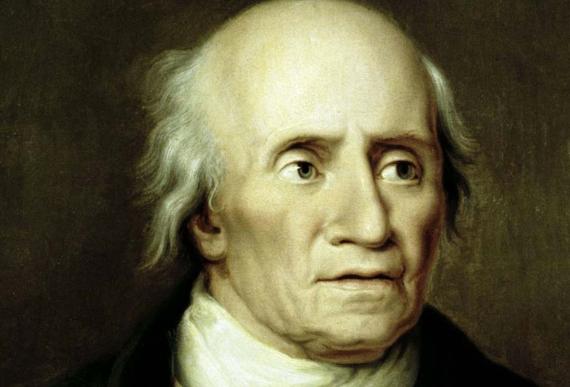Jeder kennt eine Schlüssel-Situation, in der einem der Boden unter den Füßen weggezogen wird: Bei mir war es der Tod meines Vaters. Gerade fünfzig geworden, starb er nicht unerwartet, sondern nach einer langen Krankheitsgeschichte der Atemnot und aufgeschwemmt vom Cortison. Ich war gerade sechzehn geworden, mein Vertrauen in die Stabilität des Alltags jäh ruiniert, die Orientierung einem Schwindelgefühl gewichen. Ich erinnere mich, wie meine starke Mutter mit verweinten Augen lange im Büro meines Vaters stand und sich mit der linken Hand an der Wand abstützte, als könne sie so den Einsturz ihres Lebensgebäudes verhindern. Erst am Tag nach der Beerdigung, als wir das Grab nochmals besuchten, und die ausgehobene Wunde im Friedhof, in die mein Vater vor Stunden verschwand, geschlossen war, empfand ich leichten Trost. Besucht habe ich meinen Vater beinahe nie auf dem Friedhof, meine Füße weigerten sich standhaft, die Richtung einzuschlagen, der Friedhof blieb ein abschreckender Nicht-Ort.

Friedhof von Wamberg Foto: Heiko Bielinski.de
Zwei Erfahrungen haben mir den genius loci, die geistige Atmosphäre eines Friedhofs nähergebracht. Wenn in den frühen Neunzigern an Wochenenden dicke Luft herrschte, unsere zwei Töchter Birte und Lea-Heleen sich mit großer Ausdauer und ohne Verschleiß aneinander abarbeiteten, sich nicht einigen konnten, ob Lea-Heleen zuerst Geige oder Birte Klavier übt, sind wir häufig von Berg bei Starnberg aus nach Garmisch gefahren. Nur ein Klacks entfernt. Hanneslabauer war das Zauberwort, das die dicke Luft auf der Stelle umwälzte. Nie gab es ein Veto. Häufig sind wir vom Klinikum Garmisch-Partenkirchen nach Wamberg hochgewandert, dem höchsten Dorf Deutschlands mit knapp 50 Einwohnern, dem nur vier Meter an der 1000 Meter-Marke fehlen. Birte und Lea Heleen, die oft weit vorausrannten, gingen wie selbstverständlich immer zuerst auf den ummauerten Friedhof, der wie eine Terrasse dem kleinen Kirchdorf vorgelagert war. Birte las dann Lea-Heleen die Namen der Verstorbenen vor und sie liebten es, die Namen auf anderen Gräber zu entdecken und wie ein Memory zuzuordnen. Wir hörten sie, langsam näherkommend, ausgelassen lachen und kichern. Es blieb in Wamberg alles in den Familien. Beim ersten Mal noch zögernd, bei späteren Malen schlugen meine Füße wie von selbst den Weg zum Friedhofseingang.
Weltbester Kaiserschmarrn
Nach dem Friedhofsbesuch ging es an der kleinen Kirche, die oft verschlossen war, nur selten konnte man den kleinen Hochaltar bestaunen, vorbei zur ersten Rast am Gasthof Wamberg. Aufgetankt wanderten wir über den Grat runter nach Graseck, dort in der Almwirtschaft Hanneslabauer gab es an Tischen unter dem mächtigen Schattendach der Bäume den zweiten Almdudler und den weltbesten Kaiserschmarrn. Wenn noch Luft und Lust war, zwängten wir uns durch die gespenstisch enge Partnachklamm, meine jüngere Tochter suchte dann eine Hand, im Frühling fasziniert und erschrocken zugleich von den steilen Felswänden, dem tosenden Wasser und den noch mächtigen Eiszapfen, die den Winter gegen den Frühling verteidigten und langsam schlappmachten.

Dia de los Muertos in Oaxaca, Mexico. Foto: Kenneth Garrett, National Geographic
Meine zweite Erfahrung habe ich nach einer langen Reise in dem korpulenten Vogel einer Boeing gemacht. Ich begleitete für eine Kulturzeitschrift eine Filmcrew, die einen Doku-Film über den lange in Mexiko lebenden saarländischen Schriftsteller Gustav Regler drehte. Nach nervösen und verkochten Tagen auf dampfenden Straßen in Mexiko-Stadt, die mir zu eng war und zu aggressiv, die sich nicht buchstabieren ließ, reisten oder besser: flohen wir nach Oaxaca weiter. Der Día de los Muertos, der Tag der Toten, das war das Versprechen gewesen, mit dem der Regisseur Boris Penth, mit einer Mexikanerin verheiratet, mich angelockt hatte. Im Internet hatte ich mich satt gelesen an Informationen über diesen Tag, ich fühlte mich so unförmig wie der Vogel, in dem ich gereist war. Die Werbesendungen über die Hauptstadt dieses Bundesstaates waren nicht geschönt, denn die Altstadt verströmte schiere Lebenslust: Bunt angestrichene Häuser hockten friedlich nebeneinander und schienen miteinander zu spielen, Antennen auf den Dächern angelten nach Luftfischen, Flamboyant-Bäume machten ihrem Namen alle Ehre. Die Geschwindigkeit der Fußgänger war im Vergleich zu Mexiko-Stadt deutlich heruntergeregelt, die Einheimischen glichen sich dem Tempo der flanierenden Touristen an. Vor den Bars und Cafés wurde geraucht und getrunken, dabei heftig gestikuliert, immer wieder hörte man den Begriff Día de los Muertos heraus, Radiostimmen im Hintergrund schienen nur dieses Thema zu kennen, die Fieberkurve stieg am ganzen Körper spürbar an.
Prähistorische Wurzeln
Fest und Ritus gehen auf prähispanische Kulturen zurück (Azteken, Tolteken, Nahua), dort war der Tod nicht der Feind, sondern gehörte zum Leben dazu, und auch die Toten waren weiterhin im Leben präsent. Klug hat die katholische Kirche Mexikos die Idee in ihre Festkultur zum Allerheiligen eingebettet. An diesem Tag werden nicht nur Blumen und Kerzen abgestellt, sondern ganze Familien ziehen für eine Nacht auf den Friedhof, errichten auf dem Grab einen Altar (ofrenda), bestücken es mit Bildern, Räucherkerzen, Spielsachen (für verstorbene Kinder), Seligkeitsdinge, um die Toten willkommen zu heißen. Blütenblätter, mit Vorliebe von Studentenblumen, markieren den Weg zum Altar. Die ganze Familie macht es sich bequem am Grab ihrer Liebsten, bringen das Lieblingsessen und die Lieblingsgetränke der Verstorbenen mit und essen und trinken zu ihrem Gedächtnis. Und selbstredend werden auch ein kräftiges Essen und ein (gerne alkoholisches) Getränk für die oder den Verstorbenen abgestellt. Als Getränk ist immer Pulque, aus Agavensaft hergestellt, dabei, häufig auch heiße Schokolade. Eine jährliche Totenvesper auf dem Grab selbst. Typisch für das mexikanische Ritual sind auch kleine Gedichte, die auf Handzetteln kursieren, ebenfalls Calaveras genannt, oft gehen sie auf Grabinschriften zurück, satirische Kommentare, die die Lebenden verlachen. Und überall flattert Papel Picado, von Könnern kunstvoll durchlöchertes Papier, das an die Verwundbarkeit menschlichen Lebens erinnert. Und nirgendwo Kunststoffblumen!
Damals saßen wir mehrere Stunden auf einem Grab, der Regisseur half mit Übersetzungen, und langsam, nachdem ich das Grausen in den Griff bekam, setzte die Geschichte der Eltern, die hier begraben lagen, Fleisch an, mal lachend, mal weinend, erzählte die Tochter, die Schminke kam ins Rutschen, die Sprache stolperte und überschlug sich, fand wieder in den Rhythmus, führte zu Umarmungen. Wieder und wieder und wieder wurden Leckereien und Getränke gereicht. Wir kannten bald die Lieblingsspeisen und die kleinen Gewohnheiten der beiden Toten, die plötzlich ganz vertraut neben uns saßen. So stark kann ein erzähltes Leben Gegenwart stiften. Sitzend auf dem Grab, hatte ich wieder Boden unter den Füßen. Und mein verstorbener Vater war mir so nah, wie lange nicht.
Click-Tipp:
https://www.youtube.com/watch?v=ZXaWISbavFg
Día de Muertos en Oaxaca
Klaas Huizing
Klaas Huizing ist Professor für Systematische Theologie an der Universität Würzburg und Autor zahlreicher Romane und theologischer Bücher. Zudem ist er beratender Mitarbeiter der zeitzeichen-Redaktion.