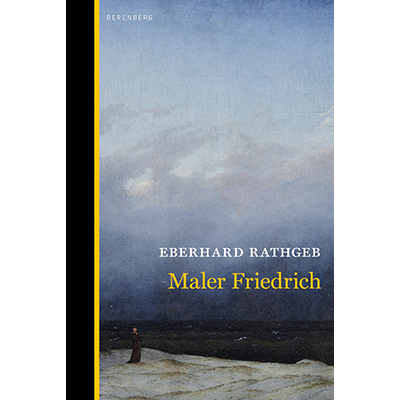Gefühlt ist „die“ Kirche seit Jahrzehnten in der Krise. Neuen Auftrieb bekam das Krisenbewusstsein 2019 durch die „Freiburger Studie“, dann kam auch noch Corona und im vergangenen Jahr die höchsten Kirchenaustrittszahlen aller Zeiten. Was tun? In einer Tagung der Evangelischen Akademie Tutzing wurde ein vielschichtiges Thema erneut vermessen.
Früher gab es in der DDR den Witz, dass der Sozialismus vier Feinde hätte, nämlich Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Daran fühlte man sich ein wenig erinnert, als Alexander Deeg, Professor für Praktische Theologie in Leipzig, in seinem Eröffnungsvortrag der Tagung vier Variationen vorstellte, in denen heute vom Zustand „der Kirche“ an sich geredet werde.
Die Vertreterinnen und Vertreter der ersten Variation seien fest davon überzeugt, dass die Kirche sterbe, dass sie sinke wie die Titanic, die den Eisberg gerammt habe. Besonders die Veröffentlichung der Freiburger Studie im Jahre 2019, in der prognostiziert wird, dass die Kirchen bis 2060 die Hälfte ihrer Mitglieder und ihrer Einnahmen verlieren werden, habe diese Sichtweise unterstützt, die natürlich besonders auch von seit jeher kirchenkritischen oder -feindlichen Kreisen begierig aufgenommen wurde.
Aber auch innerhalb der Kirchen sei die Freiburger Studie in dieser Weise aufgenommen worden. Deeg, der aufgrund einer Erkältung schweren Herzens von der Anreise nach Tutzing Abstand genommen hatte und per Zoom zugeschaltet war, erwähnte einen Workshop unter dem Titel „Vo(r)m Untergang der Titanic“, der im Juni im sächsischen Nöbdenitz stattgefunden habe. Und er erwähnt mehrmals den Namen von Heinzpeter Hempelmann, einem der Initiatoren und Teilnehmenden dort. Hempelmann, seines Zeichens Theologieprofessor vornehmlich im freikirchlichen Bereich, hatte vor etwa zwei Jahren 11 Thesen veröffentlicht unter der Überschrift „Warum die Kirche keine Zukunft hat“.
Für Deeg stehen solche Positionierungen exemplarisch für diese erste Variation der „Von-der-Kirche-Redenden“. Sie sehnten den Untergang der herkömmlichen Kirche geradezu herbei. Merkwürdig allerdings, so Deeg, dass viele von ihnen dann schon wüssten, was kommen müsste, nämlich: „Schluss mit der Volkskirche, endlich hin zu einer Kirche der engagierten Freiwilligen!“ Eine fröhlich apokalyptische Vision, die die dysfunktionale, sterbende Kirche der Ortsgemeinden als Negativfolie dringend benötige.
Resignation statt Aufbruch
Anders der Tenor der zweiten Variation, die Deeg skizzierte: Ihre Vertreter zelebrierten aufgrund der niederschmetternden Statistiken Resignation statt Aufbruch. Hier klage man: „Früher waren wir mal 100 Leute im Gottesdienst, heute kommen nur noch fünf oder zehn“ oder ähnlich. Meistens handele es sich dabei „um engagierte Mitarbeitende, die vor allem darunter leiden, dass das, was sie selbst lieben, so wenig Resonanz auslöst.“ Ihr Fazit: Die Kirche sei eben im Niedergang und leider „ein Verein der hängenden Schultern, der grauen Haare, der fehlenden Zukunft.“ Da könne man wohl nichts machen, und so sei man bei den Resignativen lediglich froh und dankbar, wenn man in stetig abnehmender Schlagzahl noch etwas weitermachen könne. Allerdings höre man hier stets „das Seufzen schon mit“.
Ganz anders, trotz ähnlichem Befund, sei die dritte Möglichkeit, auf die Kirche zu sehen, die Deeg beobachtet, allerdings sei sie nicht sehr verbreitet: Hier rede man sich, dogmatischer Verheißungen eingedenk und wider den Augenschein, in eine trotzige Gelassenheit hinein und sage mit der Tradition: „Allezeit werde eine heilige christliche Kirche bleiben“ – so stehe es schon in der Confessio Augustana. Und auch wenn die sichtbare Kirche zurzeit nicht glänzend dastehe, ändere es doch aber nichts daran, „dass der lebendige Herr selbst die Kirche ins Leben gerufen hat und ins Leben ruft und die Pforten der Hölle sollen sie ebenso wenig überwältigen wie Säkularisierung oder gegenwärtige Statistiken.“
Schließlich kommt Deeg zur vierten Variation, die er unter das große Stichwort Transformation stellt. Er erzählt von Kindern, die unter der Woche durch einen Kirchenraum laufen, weil dort die Kita eingezogen sei. Da sei endlich nicht (nur) sonntags etwas los, sondern an deutlich mehr Tagen, wie er am Beispiel einer katholischen Kirche in Düren ausführte. Deeg: „Da muss nichts sterben, und da wird nichts ganz neu auferstehen, aber da ereignet sich Neues mitten im Alten, so dass irgendwann gar nicht mehr klar ist, was eigentlich „alt“ und was „neu“ ist, weil eben Kirche hier ganz kontinuierlich in Bewegung ist.“ Das sei nichts Schlimmes, denn sie werde ja eh schon immer umgebaut.
Dieser Praxis des tätigen „Ecclesia semper reformanda“ neigt sichtlich auch Alexander Deeg zu: der Reform im Alltag, die Bestehendes verändert, und so stellt er einige interessante Beispiele der Innovation aus seinem Leipziger Nahbereich vor, wo eine Kirchenruine zur Fahrradkirche umgebaut worden sei und wo Kirchengemeinden sich gelingend in die Zivilgesellschaft einbringen. Auch erwähnt Deeg positive Zahlen im Zusammenhang mit Kirche: So gebe es immer noch etwa eine Million Menschen, die sich in Deutschland in den evangelischen Kirchengemeinden engagieren – eine Zahl, die relativ stabil bleibe, darunter die Mitglieder von mehr als 12.000 Kirchenchören. Zudem wachse die Zahl der evangelischen Schulen, die meisten von ihnen wurden in den vergangenen zwanzig Jahren gegründet. Das sei doch mal „ein echtes Wachsen gegen den Trend.“
„Kirche kann lebendig sein“
In seinem reichhaltigen Vortrags, der die Lage und Gemütslage der Kirche und der Rede über sie umriss, war es Deeg sehr wichtig, die Kirchengemeinde „vor Ort“ hervorzuheben, die ihm in der EKD-internen Diskussion schon seit dem Impulspapier Kirche der Freiheit von 2006 stets zu schlecht wegkomme: „In den Ortsgemeinden liegen die Potenziale für jede Kirchen- und Gemeindeentwicklung.“ Schließlich seien aus den Gemeinden die Ehrenamtlichen gekommen, die während der Corona-Pandemie gezeigt hätten, „wie lebendig Kirche sein kann.“ Und überhaupt wünschte sich der Leipziger Theologe, man möge „liebevoller“ auf die Kirche blicken. Und zwar auch auf die Traditionen, die gepflegt werden und die zum Großteil keinesfalls „schlecht oder altmodisch“ seien, noch „entrümpelt“ werden müssten. In diesem Zusammenhang warnte Deeg vor einem „Verschwinden der Rituale in unserer Gesellschaft“ und zitierte den Philosophen Byun Chul-Han, der jüngst geschrieben habe, Rituale machten die Zeit erst „bewohnbar“ und schafften überhaupt erst „Gemeinschaft der Verschiedenen“, befreiten das Selbst von seinem „permanenten Erlebnisanspruch“ und könnten so die „neoliberalen Dispositive der dauernden Innovation und Kreativität“ überwinden, durch die sie „am Ende“ doch immer wieder nur „Variationen des Gleichen“ böten.
Auch die inflationär gebrauchte Formel von der „Kommunikation des Evangeliums“, die sich in vielen Reformpapieren finde, unterzieht der Leipziger Theologe einer kritischen Betrachtung: „Wir suchen zurecht neue Kommunikationswege, Social Media und vieles andere, was der digitale Raum bietet. Aber gut wäre es doch, wenn wir uns mindestens genauso intensiv mit der Frage beschäftigen würden, was wir da eigentlich kommunizieren.“ Es werde der Eindruck erweckt, als „hätte“ die Kirche das Evangelium, und die Frage sei nur noch, wie man es „milieugerecht und zielgerichtet und in unterschiedlichen medialen Formen“ kommuniziere. Die Idee derer, die die Formel „Kommunikation des Evangeliums“ vor Jahrzehnten einführten, zum Beispiel Ernst Lange, sei aber genau umgekehrt gewesen, nämlich, so Deeg: „Was Evangelium heißt, zeigt sich überhaupt erst in verschiedenen kommunikativen Konstellationen und durch die immer neue Kommunikation.“
Schließlich wurde Deeg theologisch: „Wir benutzen die Vokabel ,Gott‘ immer noch zu routiniert, anstatt das Leiden an mancher Gottesfinsternis auszuhalten und auszudrücken.“ Vielmehr sei die kirchliche Verkündigung in einer „hochgradigen Positivität“ gefangen, die „toxisch“ werden kann. Dabei sei der Glaube Israels und der Kirche ist der Glaube an einen Gott, „der immer wieder auch der Verborgene ist.“ So gelte also: „Kirche ,hat‘ Gott nicht und teilt ihn dem Menschen aus, sondern „erfährt ihn, oder auch nicht. (…) Es geht nicht darum, dass wir ,die da draußen‘ retten, sondern dass wir miteinander Gott suchen".
„Wer ein Christ ist, ist kein Christ“
Am Ende zitierte dann der überzeugte Leipziger Lutheraner mit fränkischen Wurzeln Martin Luther selbst: „Ein Christ steht nicht im Worden-sein, sondern im Werden. Darum, wer ein Christ ist, der ist kein Christ. Wer da meine, er ist schon ein Christ geworden, der ist … nichts.“ Darauf fußend formulierte er dann seine Antwort auf die Frage, wozu die Kirche da sei, wie folgt: „Um als Gemeinschaft der Gefundenen zugleich eine Gemeinschaft der Suchenden zu bleiben; Kirche als Gott-Sucherin, die immer neu erwartet, sich selbst von Gott zu empfangen“. Eine solche Perspektive, so der Leipziger Professor, könne „Leidenschaft und Gelassenheit, Bescheidenheit und immer neue Aufbrüche verbinden“ und zwar jenseits der quantitativen Imperative und erst recht jenseits aller Todes- und Krisenrhetorik. „Hinein in Suche nach Gott und in die Freiheit Gottes und hinein in die Welt, in die wir gesandt sind. Gott feiern, als ob’s nichts Selbstverständlicheres gäbe, Gott die Not klagen, weil’s jetzt nötig ist, mit Gott in die Welt gehen – und so Kirche sein“ – so schloss Alexander Deeg seinen eindrücklichen Vortrag, in dem viele Fragen und Themen der Tagung bereits eingeschlossen und aufgeworfen waren.
In den folgenden Tutzinger Tagen wurde immer wieder deutlich, wie vielschichtig und unterschiedlich „Kirche“ wahrgenommen, angesehen und bewertet werden kann. Den Anfang am zweiten Tag machte die bayerische Synodenpräsidenten Annekathrin Preidel, die unter dem Titel „Herausforderung als Chance“ zunächst ihren eindrucksvollen Weg als Ehrenamtliche bis an die Spitze der Synode skizzierte, bevor die promovierte Biologin detailliert, präzise und durchaus selbstbewusst die vielfältigen Anstrengungen, Programme und Initiativen der Landeskirche in Sachen Reform aus den vergangenen Jahren samt den aktuell laufenden schilderte. Haften blieb dabei ihr Satz: „Die Kirche wird nicht weniger, wenn wir uns in der Kunst des Loslassens üben.“
Diese Meinung teilte auch Uta Pohl-Patalong. Die Kieler Professorin für Praktische Theologie, die geplantermaßen per Video nach Tutzing zugeschaltet war, gab einen halbstündigen Impuls zum Thema „Evangelische Kirche gestalten – aber wie?“ Sehr interessant, um nur einen ihrer sieben Punkte zu nennen, waren ihre Erwägungen zur Geschichte der Ortsgemeinde. In ihr vereinigten sich „zwei Grundideen“, die aus verschiedenen Epochen stammen. Zum einen die „Idee der Flächendeckung“. Sie gehe auf die junge Reichskirche im 4. Jahrhundert zurück, die ihren Anspruch auf die „Christianisierung des ganzen Landes“ deutlich machen wollte. Zum anderen aber habe die Ortsgemeinde heute darüber hinaus auch den Anspruch, dass sie „persönlichen Kontakt, soziale Gemeinschaft und räumliche Nähe“ vermitteln solle. Diese Idee, so Pohl-Patalong, stamme allerdings erst aus dem Ende des 19. Jahrhunderts. Damals wollte man der „Anonymität der Großstadt“ zur Zeit der Industrialisierung entgegenwirken.
„Logik der Gruppe“
Ursprünglich also gehörten die Phänomene Flächendeckung und soziale Gemeinschaft gar nicht zusammen. Und diese historisch gewachsene Verbindung sei aus heutiger Perspektive äußerst schwierig umzusetzen, denn die typischen Formen der Ortsgemeinde basierten auf der „Logik der Gruppe“, das heißt, sie setzen auf „persönliche Beziehungen und regelmäßigen Kontakt im Wohngebiet“. Daran aber habe nur noch knapp zehn Prozent der evangelischen Kirchenmitglieder heute noch Interesse „mit stark sinkender Tendenz“, denn es seien vornehmlich die älteren Menschen, die diese Angebote wahrnähmen. Früher habe man davon ausgehen können, so Pohl-Patalong, dass Menschen, die sich in jüngeren Jahren nicht für die Kirche interessierten, mit höherem Alter und „abnehmender Mobilität“ zur Kirche finden. Das sei heute längst nicht mehr der Fall. Gleichzeitig sei diese Form der Gemeindekirche besonders personalintensiv, da hier der persönliche Kontakt zu den Pfarrpersonen und anderen Hauptamtlichen eine besondere Rolle spiele. Insofern komme mit schwindenden finanziellen und personellen Ressourcen die kirchliche Arbeit in der Ortsgemeinde vielerorts schlicht an ihre Grenzen. Es sei also an der Zeit, so die feste Überzeugung der Kieler Professorin, die Ausrichtung der Kirche am Modell der Ortsgemeinde zumindest „als Dominante“ zu verlassen. Es gelte, andere Formen der Kommunikation des Evangeliums stark zu machen
Ebenso wie Uta Pohl-Patalong hatte sich am Samstagvormittag auch Klaas Huizing wenig um die Ortsgemeinde gekümmert, denn sie war schlicht nicht sein Thema. Der Würzburger Professor für Systematische Theologie trug in einem luziden Vortrag eine Essenz seines Denkens für ein religiöses Selbstverständnis und Selbstverhältnis unserer Tage vor. Gerade ist sein Opus Magnum erschienen, dessen Titel auch über seinen Ausführungen stand: „Lebenslehre – Eine Theologie für das 21. Jahrhundert“.
Huizing (Jahrgang 1958) gilt vielen als Exot in der akademischen Theologie, was sich zum einen daraus speist, dass er es – wahrscheinlich für viele Kolleginnen und Kollegen des Faches unverständlich und außerhalb ihrer eigenen Möglichkeiten – geschafft hat, neben seiner intensiven theologischen Lehr- und reichhaltigen Publikationstätigkeit als Schriftsteller nicht weniger als 14 (!) Romane zu veröffentlichen. Zum anderen aber liegt es daran, dass sein Ansatz ganz anders ist als der der klassischen Theologie. Klaas Huizing, der in jungen Jahren ein überzeugter Barthianer war, geht seit langem einen Denkweg auf den Spuren der Weisheitstraditionen der Bibel und versucht sich an einer Neubestimmung der Rede von Gott, in das Gewahrwerden der und das Nachdenken über die Leiblichkeit des Menschen im Zentrum steht. Denn es sei das leibliche „In-der Welt-sein“, das laut Huizing Erfahrungen des Heiligen ermöglicht.
„Kirche heißt: Zugang zur Transzendenz“
In Tutzing sprach Huizing über fünf Begriffe, die er im Bezug auf seine Sicht menschlicher Transzendenzmöglichkeiten untersuchen wollte: Leib, Weisheit, Schöpfung, Sünde und Kirche. Gleich zu Beginn seines einstündigen, auswendig (!) gehaltenen Vortrag, in dem er lebhaft direkt mit dem Publikum kommunizierte, markierte der Würzburger Literat und Theologe sein Ziel in Bezug auf das Thema der Tagung: „Wenn Kirche heißt, ,Zugang zur Transzendenz‘, welche Orte können wir dann als Kirche definieren?“ Dabei blickte Huizing weniger auf die real existierende Kirche beziehungsweise die Kirchenorganisation, sondern weitete die Perspektive erheblich, indem er Natur, Kultur, Wissenschaft und – rekurrierend auf Karl Jaspers – die Idee von „maßgebenden Menschen“ in den Mittelpunkt seiner Ausführung stellte. Kirche und Theologie seien immer dann „besonders wirkmächtig“ geworden, wenn es ihnen gelungen ist, „auf Probleme der Welt“, also „kontextsensibel“ zu reagieren.
Huizing erwähnte in diesem Zusammenhang Karl Barth und Wolfhart Pannenberg als widerstreitende Konzepte des 20. Jahrhunderts. Heute gehe das religiös-theologische Interesse in Absetzung von Barths Offenbarungstheologie wie von Pannenbergs Geschichtstheologie schon seit geraumer Zeit eher in Richtung existenzieller Fragen. Insofern sieht Huizing die Aufgabe der Theologie darin, in „Zeiten von Orientierungsschwäche in einer digitalisierten Gesellschaft eine Theorie gelingenden Lebens anzubieten und profilierte eine neue Tugendethik, die er von der Werkgerechtigkeit klar abgrenzte. Es würde zu weit führen, dies im Detail auszuführen, jedenfalls erhielt Huizing für seinen rhetorisch überzeugenden, umfassend und dabei durch und durch unterhaltsamen Vortrag viel Applaus. Zum Thema der Organisation von Kirchen und Gemeinden aber konnte beziehungsweise wollte (und sollte) Huizing nichts beitragen, denn es ging ihm in seinem Vortrag sichtlich darum, Perspektiven aufzeigen, die die traditionelle, verkirchlichte religiöse Erfahrung „lebensweltlich unendlich weiten“. Es wäre interessant, ihn bei anderer Gelegenheit einmal deutlicher zu befragen, wozu es denn bei dieser extrem individualisierten Perspektive einer Kirche und Kirchengemeinden überhaupt noch bedürfe.[1]
„Mit geistlich-seelischem Ergebnis nicht zufrieden“
Sehr interessant, ja kurzweilig, wurde es dann am späteren Nachmittag, als sich auf einem Podium drei Menschen präsentierten, die in jüngerer Zeit aus der Kirche ausgetreten sind[2]. Darunter ein besonderer Fall, ein evangelischer Theologe, der einige Jahre erfolgreich im Pfarramt tätig gewesen war, dann aber aufgrund von Selbstzweifeln an der Wahrheit des christlichen Glaubens kündigte und auch seine Kirchenmitgliedschaft beendete. Er hatte versucht, eine strikt evangelikale Sozialisation mit dem reichlichen Rezeption einer „Gott-ist-tot-Theologie“ zu überwinden, war aber letztlich mit seinem geistlich-seelischen Ergebnis nicht zufrieden. Das er für diese Konsequenz viele Vorteile, zum Beispiel den Beamtenstatus aufgab, nötigt Respekt ab. Andere mögen aber auch an das berühmte Bonmot von Papst Johannes XXIII gedacht haben, dem Gott im Traum einst erschien und ihm über seine inneren Nöte sagte: „Nimm dich nicht so wichtig, Giovanni!“
Die anderen beiden Fälle waren deutlich konventioneller. Der eine war in seiner Jugend kirchlich sehr engagiert gewesen, zum Beispiel in der Jugendgruppe, durchlief dort, wie er es in Analogie zu Fußballvereinen bezeichnete, „die D-,C- und B-Jugend“, aber dann habe ihm die „A-Jugend“ gefehlt, sprich das kirchliche Angebot für ihn als jungen Erwachsenen und er verlor den Kontakt. Als er dann beruflich in finanzielle Schieflage geriet und die Kirchensteuer drückte, trat er aus. Der dritte Podiumsgast schließlich erzählte, dass schon seine Eltern eher „U-Boot-Christen“ gewesen wären und er nach dem Umzug in eine andere Umgebung, einfach ausgetreten sei, weil er keinerlei Beziehung mehr zur Kirche, geschweige denn zu ihren Angeboten mehr verspürte. Aber, o Wunder, als seine Tochter geboren wurde, wollte er unbedingt, dass sie getauft wird. Und dann wurde ihm klar: „Ich muss wieder eintreten“, was er auch tat.
Leider musste der für Samstagabend angekündigte Vortrag; „Die Zukunft der Religion und die Zukunft des Protestantismus“ aufgrund der kurzfristigen Absage des Philosophen Alexander Grau ausfallen. Am Sonntag machte dann ein Medienmann seinen Aufschlag zum Thema „Wie ich die evangelische Kirche erlebe“. Es referierte der erfahrende Journalist Alexander Jungkunz, der seit vielen Jahrzehnten in leitender Position für die Nürnberger Nachrichten unter anderem auch über Kirche berichtet hatte und auch als Synodaler für die bayerische Landeskirche aktiv gewesen ist.
Medien und Kirche im Abschwung vereint?
Zunächst parallelisierte Jungkunz das Ergehen von Kirche und Medien: Beide seien zahlenmäßig im Abschwung begriffen: Die Mitglieder - wie die Abozahlen - gingen stetig zurück, mit neuen Methoden (hier mehr digital, dort vielfältige neue, andere Formen kirchlicher Arbeit) versuchen beide, Medien wie Kirche, verlorenen Boden gutzumachen, aber beide wüssten nicht, wie das finanziert werden soll, da es an Finanzmitteln und an geeignetem Personal mangele. Dann beklagte der Redakteur aus Nürnberg, dass die Kirche vielfach auch nur offiziell dasselbe verlautbare wie andere gesellschaftliche Gruppen. Ihm fehle da häufig die geistliche Strahlkraft. Gleichzeitig gab er im anschließenden Gespräch zu, dass aus allen kirchlichen Verlautbarungen auch nur die gesellschaftlichen und politischen Themen medial verwertet würden, da eindeutig geistliche und religiöse Themen der eigenen Leserschaft nicht zugemutet werden solle. Alles in allem ein profunder Vortrag, der die – vielleicht unvermeidlichen – Aporien der Beziehung zwischen Kirche und Medien in Deutschland aufzeigte.
Den Abschluss bildete dann der Vortrag des renommierten Theologen und Ethikers Klaus Tanner. Der seit zwei Jahren emeritierte Professor (zuletzt in Heidelberg) zog gleich zu Beginn seines entspannten, aber überaus materialreichen Vortrages eine treffliche Bilanz der Tutzinger Schau in die Glaskugel, wohin es mit der Evangelischen Kirche gehe. Tanner tat dies, indem er mit einer kleinen „intellektuellen Grußkarte“ zum 75-jährigen Jubiläum der Evangelischen Akademie Tutzing an eine berühmte Rede des Soziologen Helmut Schelsky erinnerte, die dieser 1957 zum zehnjährigen Jubiläum in Tutzing gehalten habe. Der Titel: „Ist die Dauerreflexion institutionalisierbar?“
Der Text sei ihm eingefallen, da auf der Tagung eine Reihe von „dichten Beschreibungen von Problemen“ erfolgt sei, „die durch rein statistische Analysen“ nicht erreichbar seien. Natürlich gehe durch die Dauerreflexion komplexer Fragen die „Eindeutigkeit“ verloren. Das, so Tanner, wurde schon zu Schelskys Zeiten den Evangelischen Akademien vorgeworfen. Aber schon Schelsky setzte dagegen, dass nur in dieser Dauerreflexion viele Themen überhaupt verflüssigt, sprich, für die jeweilige Zeit operationalisierbar gehalten werden können. Aber vielen fehle dann der Halt der Eindeutigkeit. Darauf habe schon Schelsky damals geantwortet: Die Vorstellung, dass Religion etwas ist, was sich in Formeln, Sätze, dogmatische Lehrsätze wie Bausteine packen lasse, sei vollständig falsch. Dem stimmte Tanner ausdrücklich zu und verwies auf den Vortrag von Klaas Huizing vom Vortage, der überkommene Formen aufgebrochen habe.
In erster Linie Mahnerin und Verbotsinstanz
Danach entfaltete Tanner sein reifes Panoptikum liberaler Theologie. Er zeigte auf, dass schon seit geraumer Zeit mehr und mehr die Wissenschaft und die Kultur religiöse Fragen aufgeworfen haben, zum Beispiel die Diskussionen um die Bioethik. Von den Kirchen und der Theologie sei dagegen wenig gekommen. Tanner stellte die provokante Frage: „Nennen Sie mir einen Punkt, wo die Kirchen nicht als Verbotsinstanz auftraten? Nennen Sie mir einen kirchlichen Text, wo die Wissenschaftsfreiheit positiv gewürdigt wird?“ Da sei nichts. Das Kirche sei euch heute noch vielfach in erster Linie als Mahnerin und als „Verbotsinstanz“ unterwegs. Und nicht zuletzt viele Medienvertreter seien mehrheitlich kirchenkritisch, selbst wenn sie es „individuell nicht mehr erlebt“ hätten, weil die Kirche eben noch im 19. Jahrhundert eine offizielle Zensurinstanz gewesen sei, und dies sei immer noch im „kollektiven Gedächtnis“ vorhanden.
In seinem Fazit riet Tanner dann zur Gelassenheit. Sicher müsse organisatorisch in den Kirchen einiges geändert werden, aber das gehöre wie bei einem guten Unternehmen in das „Backoffice“ und nicht ins Schaufenster. Dass es zahlenmäßig bergab gehe und man darüber so bestürzt ist, sei eine deutsche Besonderheit. Anderorts habe es die Kirche noch nie so dicke gehabt. Hierzulande schmerze es, dass „der Wohlstandsbauch“ nun deutlich abzuschmelzen beginne. Damit könne, so Tanners letzter Punkt, die evangelische Kirche deutlich besser umgehen als die katholische, da für den Protestantismus die sichtbare Kirche ein „weltlich Ding“ sei. Dies bekräftigend zitierte er Martin Luther: „Die Summe dieser und aller Ordnungen ist, sobald ein Missbrauch daraus werde, dass man sie flugs abtue und eine andere mache.“
Viel Applaus für Klaus Tanner, den großen, wenn auch gar nicht so alten Mann der Kirchensoziologie, am Ende eines reichhaltigen Wochenende mit viel Analyse und viel Dauerreflektion beim Blick in die große Glaskugel, wohin sich die evangelische Kirche in diesen Zeiten entwickelt. Es ist keine Kritik, wenn als Fazit der Tagung zum einen bleibt: „Der Vorhang geschlossen und alle Fragen offen“, zum anderen aber auch das unüberhörbare Signal: „Fürchtet Euch nicht!“
[1] Wenige Tage vor der Tagung führte Klaas Huizing im Bayerischen Rundfunk ein Gespräch mit dem Redakteur Matthias Morgenroth in der Sendung Ökumenische Perspektiven – Ausschnitt: Minute 31:20-36:30)
[2] Verständlicherweise wurde gebeten, diese Informationen medial nicht zu sehr zu verbreiten, insofern werden die Namen der Betreffenden nicht genannt.
Reinhard Mawick
Reinhard Mawick ist Chefredakteur und Geschäftsführer der zeitzeichen gGmbh.