Das Gehirn reicht nicht
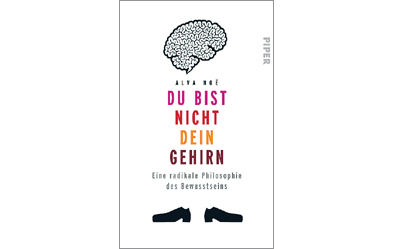
Denn so lehren es die Neurowissenschaften: Das Bewusstsein ist im Inneren des Menschen zu lokalisieren. Im Gehirn spielt sich das Denken ab; hier findet sich die Fähigkeit, zu sprechen, zu lernen, sich zu erinnern, Emotionen zu empfinden, zu handeln, zu entscheiden, Schmerz zu fühlen, schließlich auch die Entwicklung von Ich-Bewusstsein. Dies alles lässt sich mit Hirnströmen auf einer rein neurobiologischen Ebene erklären. Letztlich braucht dieser Theorie zufolge das Gehirn nicht mehr als eine Reizung seiner Neuronen, um sich innerlich das Abbild der äußeren Welt zu erschaffen. Einer Welt, von der wir schließlich nicht einmal mehr wissen, ob sie nicht eine große Illusion ist: eine Kopfgeburt sozusagen. So ist ein Gedankenspiel vorstellbar, nach dem das Gehirn in einem Tank mit einer Nährlösung über Kabel mit einem Computer verbunden ist. Bewusstsein entsteht über die elektrischen Impulse, die auf das Hirn einwirken, und diese schaffen die Wahrnehmung einer Welt, die nicht notwendig der Realität entspricht.
Noë aber glaubt, wir suchten an der falschen Stelle, wenn wir das Bewusstsein im Kopf vermuteten. Dabei will er nicht einfach zu einem dualistischen Ansatz mit der Vorstellung des Bewusstseins als einer immateriellen Entität zurückkehren. Er stellt auch nicht in Abrede, dass dem Gehirn bei der Entwicklung von Denken, Wahrnehmung und Bewusstsein eine wichtige Rolle zukommt. Aber er hält es für kurzschlüssig, nur das Gehirn zu betrachten, wenn man verstehen will, wie Bewusstsein entsteht, und dabei die Körperlichkeit des Menschen und die spezifisch strukturierte Umwelt, in der er lebt, außer acht zu lassen. Beide - Körper und Welt - schaffen seiner Ansicht nach gemeinsam mit dem Gehirn Bewusstsein. Noë plädiert für einen biologischen und evolutionstheoretischen Ansatz anstelle des technisch-mechanischen Verständnisses.
Denn der Mensch ist immer ein verortetes, in natürliche, soziale und kulturelle Umgebungen eingebundenes Wesen. Das Bewusstsein stellt eine biologisch und kulturell entwickelte Fähigkeit dar, entstehend in dynamischer Interaktion mit der Umwelt: "Das Bewusstsein ist nicht in unserem Inneren, sondern es ist vielmehr eine Art aktive Einstimmung auf die Welt, eine erlernte Integration." Das Gehirn ist also keine "eigenständige Quelle für Erfahrung und Kognition", sondern auf das reelle "Außen" ausgerichtet und schafft uns einen Zugang zu der Welt, in der wir leben.
Noë kritisiert die naturwissenschaftlichen Methoden nicht, stellt aber die Deutung wichtiger Experimente der Hirnforschung infrage. Und er analysiert ihre philosophischen Grundannahmen, die auf dem cartesianischen Erbe beruhen, das eine innere "Res cogitans" annimmt, ohne sie nachzuweisen. Was zu Zirkelschlüssen führt: "Wir wollen die biologische Grundlage des Geistes entschlüsseln. Das wird aber kaum funktionieren, wenn wir annehmen, dass unsere eigenen kognitiven geistigen Fähigkeiten nur unter Bezugnahme auf die kognitiven Kräfte des Gehirns erklärt werden können." Noës Ansatz ist ausgesprochen interdisziplinär und betont die Bedeutung der Geisteswissenschaften für naturwissenschaftliche Fortschritte: Die Zusammenarbeit beider Disziplinen ist für die Entwicklung einer überzeugenden Theorie des Bewusstseins unabdingbar.
Alva Noë: Du bist nicht Dein Gehirn. Piper Verlag, München 2010, 240 Seiten, Euro 19,95.
Natascha Gillenberg
Natascha Gillenberg
Natascha Gillenberg ist Theologin und Journalistin. Sie ist Alumna und Vorstand des Freundes- und Förderkreises der EJS.

