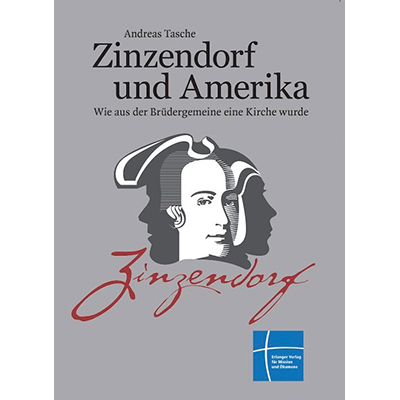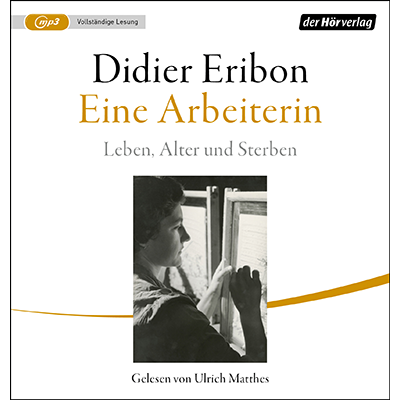Im Exil
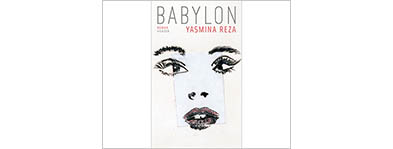
In der christlich-jüdischen Mythologie steht „Babylon“ für so ziemlich alles Schlechte: Für das Leben in Sünde und Gottesferne, für Hochmut und Sprachverwirrung, aber auch für ein Leben fern der Heimat im Exil. In Yasmina Rezas jüngstem Roman, den sie nach der Hauptstadt des babylonischen Reiches benannt hat, klingt vieles davon an, obwohl sie uns zunächst wieder einmal ins vermeintlich wohlgeordnete Pariser Bürgertum der Gegenwart führt. Doch wie schon in früheren Werken zelebriert sie den Verlust der Konventionen im Streit, das Aufbrechen der wohlgeübten Verhaltensnormen, das Tier im Citoyen – diesmal radikaler als zuvor.
Denn erstmals steht nicht nur verbale Gewalt im Mittelpunkt des Geschehens, sondern tatsächlich eine Gewalttat: Ein Mann tötet seine Frau. Nicht aus Kalkül oder niedrigen Beweggründen, sondern aus Wut, die zum totalen Kontrollverlust führt. Zum Glück ist der Leser nicht live dabei, das wäre dann doch eine Spur zu grob für den Roman, der bis zur Leiche doch eher von französischer Langeweile der gehoben Art geprägt ist. Vielleicht muss das so sein, denn die Hauptfigur Elisabeth, eine gut sechzig Jahre alte Frau, scheint sich ebenfalls zu langweilen in ihrem lauen Leben, beginnt zu leiden am Älterwerden. Sie erinnert sich an den Tod der Mutter, an die Jugend und den ebenfalls verstorbenen Jugendfreund. Und ihre Lebensbilanz fällt trotz allem beruflichen Status als Patentanwältin und einer zumindest stabilen Partnerschaft recht mau aus. Sechzig von hundert Punkten würde sie sich geben auf die Frage, ob sie ein glückliches Leben führen würde. Elisabeth ist nicht wirklich zu Hause in ihrem Leben, so scheint es, lebt mitten in Paris im babylonischen Exil.
In dieser Situation lernt sie ihren eher unscheinbaren Nachbarn Jean-Lino näher kennen und schätzen, keine Liebe, kein Sex, nur Gespräche und menschliche Nähe. Ob dies der Impuls dafür war, ein Frühlingsfest zu feiern, eine größere Party als je zuvor? Wie auch immer, auf dieser Party streiten sich Jean-Lino und seine Frau über Bio-Hühner und diesen Streit führen sie dann in ihrer Wohnung fort – mit dem bekannten dramatischen Ende. Wie gesagt, bis dahin schleppt sich die Handlung dahin, wirken die Dialoge bisweilen recht konstruiert, melancholischer Mehltau durchzieht die Seiten. Doch dann kommt Schwung in die Sache, denn statt zur Polizei zu gehen, bittet der Nachbar Elisabeth und ihren Mann um Hilfe bei der Beseitigung der Leiche. Was folgt ist tragisch-komisch, manchmal etwas zu klamaukig, aber sehr unterhaltsam und anregend. Denn es geht ja um Existenzielles. Was machst Du, wenn Du mit Gewalt konfrontiert wirst? Wieviel Schuld bist Du bereit auf Dich zu nehmen, um dem babylonischen Exil der Konvention zu entfliehen? Ist Mitmenschlichkeit gegenüber den Lebenden nicht wichtiger als juristische Gerechtigkeit gegenüber den Toten? Und wie ist das alles nicht nur intellektuell, sondern auch praktisch zu lösen?
Natürlich bleibt der Ausbruchsversuch auf noch nicht mal halber Strecke stecken, zu groß die Skrupel, zu groß die Angst erwischt zu werden. Am Ende hat alles wieder seine Ordnung, der Täter wird verhaftet, Elisabeth schwindelt sich aus der Sache heraus, der belebende Einbruch der Gewalt in ihr Dasein bleibt nur eine nächtliche Episode und folgenlos. Oder deuten die letzten Sätze in eine andere Richtung? „Mir fiel ein, dass Jean-Lino, immer, wenn sein Vater in der Coer Parmentier den Psalm vorlas, ein Zugehörigkeitsgefühl zu einer schattenhaften Gemeinschaft empfunden hatte. Ich schaute zum Himmel auf und zu allen, die sich dort befanden. Dann ging ich allein wieder hoch.“ Die Rest-Religion glimmt nur, aber sie könnte noch wärmen. Es gibt eine Verbundenheit mit den anderen im Exil. Immerhin.
Stephan Kosch