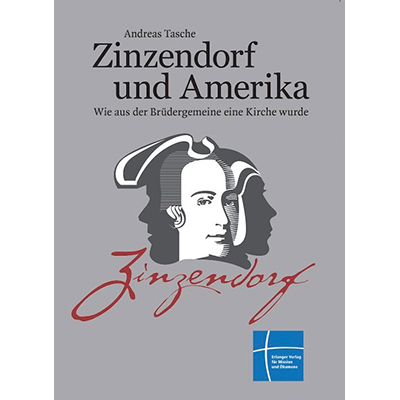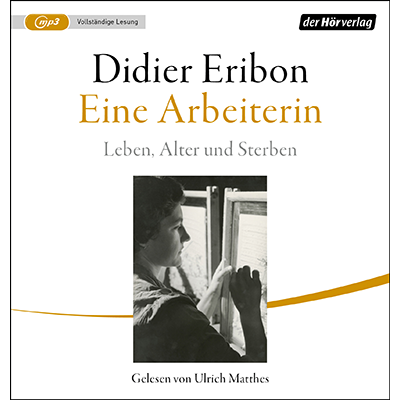Im Meer

Kolumbien ist exotisch, man kennt aus Garcia Màrquez´Romanen den magischen Realismus Lateinamerikas, der keine rein literarische Erfindung ist, sondern aus dem Volk hervorging, entstanden aus der jahrhundertelangen Vermischung von Spaniern, indigenen und afrikanischen Völkern, mit all ihren Glaubensrichtungen und Phantasien, den alten Riten und ererbten Erinnerungen.
Auch Tomás Gonzáles, der viele Jahre als Übersetzer und Journalist in New York arbeitete und heute wieder in seiner Heimat schreibt, weiß um diese Mystik und lässt sie geschickt in seinen Roman einfließen, der in dem fiktiven Ort Playamar spielt. In der kleinen Ferienanlage an der Küste, weit ab vom mondänen Cartagena, entspannt der kolumbianische Mittelstand. Man wohnt in kleinen Strandhütten, badet im warmen Meer, döst in Hängematten unter Palmen, trinkt den landesüblichen Aguardiente und geht abends ins Restaurant, um frischen Fisch zu essen. In dem despotisch geführten Familienbetrieb bleiben die Zwillingssöhne stets Handlanger ihres Vaters, dem sie auch beim Fischen helfen. So fahren die drei Männer auch an diesem Samstag um vier Uhr morgens mit ihrem kleinen Boot auf Fangtour, obschon der Wetterbericht nichts Gutes verheißt. Mit dem weiten Meer und drohenden Unwetter bedient sich Gonzáles zweier bekannter Metaphern, um zwischenmenschliche Spannungen darzustellen.
In diesem Psychothriller mit siebenundzwanzig Kapiteln, die einen Zeitraum von siebenundzwanzig Stunden beschreiben, wechselt der Autor Perspektiven und Zeitebenen. Nach und nach bröckelt die Idylle, und man blickt in die schizophrene, stimmentönende Welt der Mutter, in die des cholerischen Vaters, der sein Leben mit der jungen Geliebten und dem gemeinsamen Kind rechtfertigt, während die Söhne zwischen Aushalten, Abhauen, Liebe und Pflichtgefühl gegenüber der Mutter schwanken. Den einen lockt das intellektuelle Leben Bogotás, den anderen das leichte Leben und schnelle Geschäft. Alles scheint der Vater ihnen vorzuenthalten, sie fühlen sich abhängig, seltsam unerwachsen mit ihren achtundzwanzig Jahren. In episodenhaften Monologen lassen einige Feriengäste und Angestellte ihr Leben Revue passieren, ihre Probleme aufblitzen und deren Sichtweise auf die seltsame Familie erkennen.
Auch Tomás Gonzáles, der viele Jahre als Übersetzer und Journalist in New York arbeitete und heute wieder in seiner Heimat schreibt, weiß um diese Mystik und lässt sie geschickt in seinen Roman einfließen, der in dem fiktiven Ort Playamar spielt. In der kleinen Ferienanlage an der Küste, weit ab vom mondänen Cartagena, entspannt der kolumbianische Mittelstand. Man wohnt in kleinen Strandhütten, badet im warmen Meer, döst in Hängematten unter Palmen, trinkt den landesüblichen Aguardiente und geht abends ins Restaurant, um frischen Fisch zu essen. In dem despotisch geführten Familienbetrieb bleiben die Zwillingssöhne stets Handlanger ihres Vaters, dem sie auch beim Fischen helfen. So fahren die drei Männer auch an diesem Samstag um vier Uhr morgens mit ihrem kleinen Boot auf Fangtour, obschon der Wetterbericht nichts Gutes verheißt. Mit dem weiten Meer und drohenden Unwetter bedient sich Gonzáles zweier bekannter Metaphern, um zwischenmenschliche Spannungen darzustellen.
In diesem Psychothriller mit siebenundzwanzig Kapiteln, die einen Zeitraum von siebenundzwanzig Stunden beschreiben, wechselt der Autor Perspektiven und Zeitebenen. Nach und nach bröckelt die Idylle, und man blickt in die schizophrene, stimmentönende Welt der Mutter, in die des cholerischen Vaters, der sein Leben mit der jungen Geliebten und dem gemeinsamen Kind rechtfertigt, während die Söhne zwischen Aushalten, Abhauen, Liebe und Pflichtgefühl gegenüber der Mutter schwanken. Den einen lockt das intellektuelle Leben Bogotás, den anderen das leichte Leben und schnelle Geschäft. Alles scheint der Vater ihnen vorzuenthalten, sie fühlen sich abhängig, seltsam unerwachsen mit ihren achtundzwanzig Jahren. In episodenhaften Monologen lassen einige Feriengäste und Angestellte ihr Leben Revue passieren, ihre Probleme aufblitzen und deren Sichtweise auf die seltsame Familie erkennen.
Alle blicken sorgenvoll auf die Männer, die das Meer in diesem Tropengewitter verschlucken könnte. Draußen auf dem Boot entsteht derweil ein Kräftemessen zwischen drei unterschiedlichen Charakteren, der in der Luft liegende Vater-Sohn-Konflikt und ein Bruderzwist scheinen sich zu entladen. Als der boshafte Alte über Bord geht, stellt sich den Söhnen die entscheidende Frage: er oder wir? Wie soll unser Leben weitergehen? An Land, geplagt von Vorahnungen, fragt sich die Mutter: Werden die Söhne das akzeptieren, „was das Meer ihnen vorschlägt“?
„Die Welle gelangt immer an den Ort, zu dem sie unterwegs ist, und beginnt immer dort, wo sie entstanden ist“, schreibt Tómas Gonzáles der in Bogota Philosophie studierte und 1983 seinen ersten Roman veröffentlichte. Und so endet der Roman nach 153 Seiten beinah unspektakulär dort, wo er begann. Der Sturm hat sich verzogen, der Alte leckt seine Wunden, die Zwillinge liefern ihn bei seiner jungen Frau ab und bleiben in ihrer Welt verfangen.
Angelika Hornig