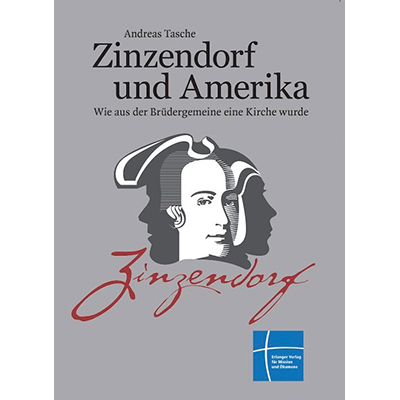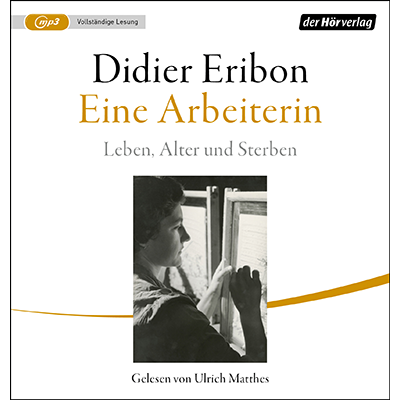Kunst gegen Macht

In diesem Buch geht es nicht wirklich um Lärm, ausdrücklich wird sogar darauf hingewiesen, dass der Protagonist nicht lärmempfindlich ist. Nur Hundegebell stört Dmitri Dmitrijewitsch Schostakowitsch (1906-1975) hin und wieder beim Komponieren, aber das ist allenfalls ein Problem, als er während des Krieges auf dem Land leben muss. Wohl aber leidet er an dem „Lärm der Zeit“, an all dem, was nicht Musik ist, sondern der Macht zuzuschreiben ist, die ihn hofiert, wenn seine Musik dem sowjetischen Ideal entspricht, die ihn aber auch stets bedrängt und bedroht, wenn dies nicht der Fall ist. Etwa, als Stalin eine Aufführung seiner Oper „Lady Macbeth von Mzensk“ besucht und diese vorzeitig verlässt. Kurz darauf sorgt ein offenbar vom Diktator selbst geschriebener Verriss in der Parteizeitung Prawda nicht nur für den zeitweiligen künstlerischen Bann, sondern für existenzielle Angst vor der Hinrichtung.
So begleiten wir im ersten Teil von Julian Barnes’ jüngstem Buch Schostakowitsch bei seinem nächtlichen Warten am Aufzug auf die Geheimpolizei. Schließlich sollen ihm, Frau und Kind die entwürdigenden Szenen einer Verhaftung in der Wohnung erspart bleiben. Man sagt, dass man anhand von Schostakowitschs Symphonien die Geschichte der Sowjetunion nacherzählen könne.
Der britische Bestseller Autor Julian Barnes wählt zum Glück einen anderen Weg, der das Buch auch für weniger musikalisch Interessierte lesenswert macht. Er beschreibt drei Phasen in Schostakowitschs Leben. Zunächst eben die Zeit nach der vernichtenden Kritik an „Lady Macbeth von Mzensk“ im Jahr 1936. Dann, vermeintlich reputiert durch seine im „vaterländischen Krieg“ geschriebene siebte Symphonie, als Teil einer Delegation, die auf Stalins Anordnung 1949 den Weltfriedenskongress in New York besucht. Dort hört er in der Übersetzung seiner Rede, die er nicht selber geschrieben hat, wie der von ihm verehrte Strawinsky als Verräter und reaktionärer Musiker beschimpft wird, der Musik nur um der Musik Willen mache - und sieht sich gezwungen, dieses Urteil öffentlich mit eigenen Worten zu bestätigen. Und abschließend, im „Tauwetter“ unter dem sowjetischen Staats- und Parteichef Nikita Chruschtschow ab 1956, als er gezwungen wird, in die von ihm so gehasste Partei einzutreten.
Man könnte dies als drei Stufen der Anpassung an ein Regime verstehen, das jedwede Kunst für seine Zwecke und Ziele einspannte und auf ihre Freiheit nichts gab. Doch das wäre zu banal. Julian Barnes taucht ein in die, zum Teil akribisch recherchierte, zum Teil anverwandelte, Gedankenwelt des Komponisten, der doch eigentlich nur der Musik verpflichtet sein will und um das physische und künstlerische Überleben in einer Diktatur kämpft. Seine Waffe ist die Ironie, die auch in seinen Kompositionen eine Rolle spielt, auch wenn sie nicht von allen als solche erkannt wird.
Doch in der späten Phase seines Lebens muss er einräumen: „Und Ironie hatte ihre Grenzen. Zum Beispiel konnte man kein ironischer Folterer sein, auch kein ironisches Folteropfer. Ebenso konnte man nicht ironisch in die Partei eintreten. Man konnte aufrichtig in die Partei eintreten oder man konnte zynisch in die Partei eintreten: eine andere Möglichkeit gibt es nicht. (.) Wenn man der Ironie den Rücken zukehrte, erstarrte sie zu Sarkasmus. Und wozu war sie dann nütze? Sarkasmus war Ironie, die ihre Seele verloren hatte.“
Manche Kritiker meinen, dass Barnes neuestes Buch nicht sein stärkstes ist. Mag sein. Aber es ist mindestens ein gutes Buch, das Nachdenken lässt über die Rolle der Kunst, den Umgang mit Macht und Schuld und das zudem die bedrohliche Enge eines Lebens in einer Diktatur spürbar werden lässt.
Stephan Kosch