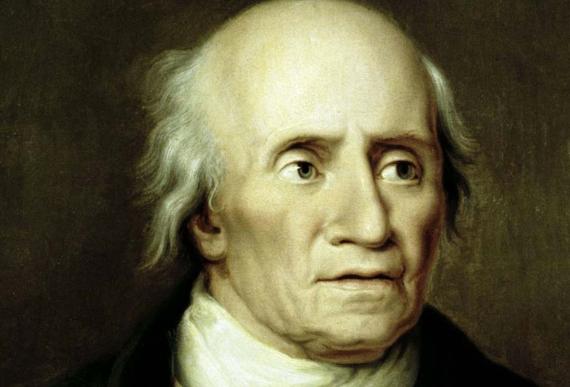Rabenmist und gehackte Würmer

Haltet euch so getrost als ihr immer könnt“, sagt die Wehemutter, die Christoph mitten in der Nacht in die Erfurter Kürschnergasse geholt hat. Vor kurzem erst sind sie hierhergezogen, nur wenige Schritte weit. Er hört, wie sie nebenan auf seine Frau einredet. „Lasst den Mut und die gute Hoffnung nur nicht fallen, ich versichere euch, es wird mit Gottes Hülfe besser gehen, als ihr denkt!“ Maria Magdalena ist dieses Mal so großen Leibes, dass sie sich in der vorigen Woche kaum noch hat rühren können. Zuerst einmal hat die Hebamme Maria Einhalt geboten, die sich nach altem Brauch das Haarband lösen will – es sei ein Aberglaube, sagt sie, dass eine Frau nur gebären kann, wenn sie alle Knoten und Bänder löst, die sie an sich hat. „Haltet euch mit den Händen nur feste an, dass ihr nicht so zittert! Es geht gleich wieder vorüber!“
Christoph wünscht das Gleiche für sich, er hat rasendes Zahnweh und kippt noch einen Wein hinunter, roten, wie ihn die Wehmutter seiner Frau gegeben hat. „Ihr werdet sehn, dass euch der liebe Gott bald helfen wird.“ Maria schreit auf, die Wehmutter redet ruhig weiter auf sie ein. „Wie bald ist eine Weh vorbei! Wer wollte seinen Mut so bald sinken lassen?“ Aber es währt und währt, und als der Morgen des 22. Februar 1645 über der Stadt dämmert, hält Christoph es nicht mehr aus. Der Stadtmusiker überlässt seine Frau Gott und der Hebamme – ihren kleinen Georg Christoph haben sie der Schwägerin gebracht – und eilt zum Zahnzieher.
Christoph hat gegen seinen Schmerz schon alles ausprobiert, Bilsenkraut und Alraune, Kampferöl und Lavendel. Seit gut zwanzig Jahren ist auch unter belesenen Chirurgen die Wirkung der Gewürznelke anerkannt, die er schon aus Prinzessin Hedwigs gut sortierter Lichtenburger Apotheke kennen dürfte. Nun findet er sich im Sessel sitzend, den Behandler im Rücken, der ihn lobt, schon Wein getrunken zu haben, und ihm noch einen Becher reicht – lokale Anästhesie wird zwar hier und da schon versucht, aber Rabenmist und gehackte Würmer haben allenfalls suggestive Wirkung.
Der Alte lässt Christoph einen Becher mit Weingeist und Lavendel trinken, dann legt er ihm, mit der Linken unter das Kinn greifend, den Kopf in den Nacken, ermittelt den kranken Backenzahn, legt ihn mit einem Schaber frei – Christoph ballt die Fäuste über der Brust – und greift dann zum gefürchteten Pelikan, einer Art festem, offenstehendem Metallschnabel, mit dessen Hebelwirkung nur kundige Chirurgen so umgehen können, dass nicht gleich drei Zähne aus der Fassung geraten. Darum bevorzugt man alte Zahnbehandler, erfahren und bedachtsam. Dieser Patient hat Glück, auch wenn das für die Leute draußen auf der Gasse nicht so klingt. Geißfuß und Stoßeisen kommen nicht zum Einsatz, die Zange nur für die finale Extraktion, nach der Christoph, fast ohnmächtig geworden, mit Weingeist spült und eine Pfeife mit Brasiltabak zum Rauchen erhält.
Tränen in den Augen
Trotzdem hat er Tränen in den Augen, noch ehe er, benebelt zurück im „Haus zum Christoffel“, die gute Nachricht vernimmt. Es riecht auch hier nach Alkohol, nach Branntwein, und die Hebamme kommt ihm entgegen. „Nur einmal ist das Wasser gesprungen“, sagt sie fröhlich, „und dann ist ein Kind gleich dem andern gefolgt, mit Gottes Hilfe!“ Die Nabelschnur sei so lang gewesen, dass die beiden damit auf dem Wehelager hätten tanzen können. Die beiden? In warme Tücher gewickelt, mit Branntwein abgerieben liegen sie da, die Zwillinge, zwei Knaben, die sich wie ein Ei dem andern gleichen. Wie es kommt, dass es auch einander weniger ähnliche Zwillinge gibt, weiß man noch nicht. Zwei Tage später werden die Knaben in der Erfurter Kaufmannskirche getauft: Johann Am-brosius und Johann Christoph. (...)
Unterdessen erreicht der Krieg die Phase der letzten Schlachten, die fern von Thüringen geschlagen werden, das Land aber noch einmal schwer treffen. Lennart Torstensson, einst Page Gustav II. Adolfs, der schon in Breitenfeld und Wittstock die schwedische Artillerie kommandierte, hat die Wendigkeit der Geschütze und Einheiten mit einer Zielstrebigkeit entwickelt, die man in der Medizin und Zahnmedizin des Jahrhunderts vermisst. Er schlägt im März dieses Jahres 1645 bei Prag – unfern der ersten Schlacht des Dreißigjährigen Krieges – mit 16 000 Söldnern und 80 Geschützen die zahlenmäßig überlegenen, aber schlechter bewaffneten Truppen Kaiser Ferdinands III. so vernichtend, dass der verstärkt auf Frieden sinnt. Im April wird der Kurfürst von Trier freigesetzt, den zehn Jahre zuvor spanische Truppen gefangen genommen hatten, im August lädt der Kaiser, ganz gegen seine vorherige Machtpraxis, sämtliche rund 140 Reichsstände zu dem Friedenskongress ein, der sich seit zwei Jahren in den neutralen Städten Münster und Osnabrück dahinschleppt.
In Erfurt merkt man wenig von diesem Licht am Horizont. Der schwedische Stadtkommandant Caspar Ermes, den man den „lahmen Bösewicht“ nennt, tut sich durch brutale Justizpraxis hervor, und einem harten Winter, in dem das Eis auf der Gera 30 Zentimeter dick wird, folgen im Februar Torstenssons Truppen auf dem Weg zurück nach Norden. „Anno 1646 ist das schwedische Volk, die ganze Armee, in das Thüringer Land dieser Seit der Saale, Jena, Rudolstadt, Stadtilm hat der Stab gelegen, Arnstadt, Ohrdruf, Eisenach, Gotha, Weimar, Buttstädt, und aller Wegen, auf allen Dörfern, so sind sie verwüstet worden“, schreibt Blaufärber Hans Krafft – wobei sich im Wort „verwüstet“ das erneute Niederbrennen ganzer Dörfer verbirgt, Plünderung, Folter, Vergewaltigung, Mord, all das, was Krafft nicht noch einmal aufschreiben will. „Im Februar so sind sie ankommen und gelegen bis 16. März. So ist der Generalfeldmarschall Lehnart Dorsten Son und Generalfeldzeugmeister Frangel mit dem ganzen Stab in Erfurt [gewesen].“
Die Finanzen der Stadt erlauben jetzt erst recht keine Bezahlung ihrer Musiker. Noch 1665 wird Christoph Volbrecht, Direktor der Stadtmusikanten, schreiben, dass er und seine vier „Cameraden (…) in 26 Jahren keine Besoldung bekommen undt doch unsere Dienste wie bey der Besoldung dreulich und fleyßig verrichten“. Das tun sie – darunter Johann und Christoph Bach – auch beim Erfurter Friedensfest, das wegen fehlender Mittel erst knapp zwei Jahre nach dem Westfälischen Frieden stattfinden kann. Freilich haben die letzten 600 schwedischen Fußsoldaten die Stadt auch erst zehn Tage vor diesem 8. September 1650 verlassen. Erfurt hat jetzt 13 475 Einwohner, gut 5500 weniger als vor dreißig Jahren. Das Fest beginnt mit einem Gottesdienst, bei dem einem Präambulum der Orgel, vielleicht von Johann gespielt, Chormusik folgt, von Studenten und Kantorei gesungen: „Komm heiliger Geist, Herre Gott“. Die Stadtmusikanten verstärken an diesem Tag das Collegium musicum der Universität beim „Academischen Triumph- und Jubelgeschrey“. Die Knaben der Bachs ziehen mit den Musikern durch die Stadt, die an wechselnden Orten anhalten und „allerhand Lob- und Danklieder figuraliter und choraliter“ vortragen.
Abends steigen ihre Väter nacheinander auf die vier höchsten Kirchtürme der Stadt, nah beieinander, Allerheiligen beim Fischmarkt, St. Ägidien an der Kramerbrücke, die Kaufmannskirche und St. Bartholomäi am Anger. Die beiden Cousins Georg Christoph und Johann Christian, acht und zehn Jahre alt, dürfen mit nach oben – immerhin ist es Georgs Tauftag! –, drei Fünfjährige bleiben unten und sehen hinauf. Die Zwillinge Ambrosius und Johann Christoph und ihr Cousin Ägidius hören, kennen und singen mit, was da oben geblasen wird: „Allein Gott in der Höh’sei Ehr“.
Unregelmäßig bezahlt
Dem zuversichtlichen Heinrich, Christophs Bruder, geht es unterdessen in Arnstadt nicht gut. Seine Stelle als Organist an der zum Hof gehörenden Oberkirche verdankt er der Verzweiflung des Hofkapellmeisters und Organisten Christoph Klemse. Dieser Studienfreund von Heinrich Schütz hat in Arnstadt noch goldene Zeiten erlebt, bis hinein in die ersten Kriegsjahre, als Caspar Bach den Dulzian in der Kapelle spielte und dessen ältester Sohn als große Hoffnung nach Bayreuth und Dresden ging. Aber schon ab Mitte der Zwanziger bröckelte kriegsbedingt der Etat, und 1640 hat Klemse, unregelmäßig bezahlt, um Urlaub gebeten, um sich woanders eine Anstellung suchen zu können. Die Grafen lehnen ab, bis ihr bester Musiker Kleider und Hausrat verkaufen muss, um seine Familie durchzubringen – während das gräfliche Geld durchaus noch reicht, die Kirche des Hofs mit neuer Taufe und Kanzel und neuem Altar prunkvoll auszustatten, „alle drey Stück sehr künstlich und von sonderlicher Invention“, wie die Stadtchronik rühmt.
Diese künstlichen Stücke kennt Heinrich gut. Nach Klemses Entlassung hat er im September 1641 das Organistenamt übernommen, während die Leitung der heruntergekommenen Hofkapelle unbesetzt bleibt, und gründet eine Familie, vielleicht in dem kleinen Häuschen, das sein Onkel Caspar seit einigen Jahren in der Jakobsgasse besitzt. Aber seine Besoldung – 52 Gulden jährlich – erhält er nur als Bittsteller, „fast mit weinenden Augen“, wie er den beiden jungen Grafen von Schwarzburg im August 1644 schreibt. Da hat der 28-Jährige schon über ein Jahr lang kein Geld erhalten, ist Vater eines zweijährigen Johann Christoph und sieht mit Sorge der nahen Geburt des nächsten Kindes entgegen. Die gräfliche Kanzlei befiehlt dem Verwalter des „Gotteskastens“, aus dem die Bedienten der Kirchen und Schulen bezahlt werden, Abhilfe zu leisten. Der Kasten, erklärt der Verwalter, sei infolge des Krieges leer und von den dreizehn Jahren seiner Tätigkeit sei dieses das schlimmste. Heinrichs und Evas zweiter Sohn, im Januar 1645 geboren, wird keine zwei Jahre alt. Johann Christoph, der erstgeborene, lernt die Not schon kennen, ehe sich nach Kriegsende zögernd das Blatt wendet. Und er erkundet die Orgel seines Vaters in der Oberkirche, deren Töne, solange die Kalkanten den Blasebalg bedienen, für die Ewigkeit stehen. (…)
Bewerbung mit Erfolg
1654 erfährt Christoph, der Stadtmusiker in Erfurt, von seinem Bruder Heinrich, in Arnstadt werde ein Hofmusikant als «Meister der Haussleute» gebraucht. Er bewirbt sich mit Erfolg. Er wird „alhier in der Kirchen bei der Music und auf dem Chor, wie auch zu Hof, so oft wir es begehren und Ihn erfordern lassen, nebst seinen Adjuvanten, sowohl mit Violen als blasenden Instrumenten, wie es die Kunst mit sich bringet, fleißig und unverdrossen aufwarten, täglich von dem Schloßthurm alhier zweymahl, alss zu Mittag und Abends und auf die Hohe Feste den ersten Tag auch Morgens frühe, abblasen und bey solchem allen keinen Mangel verspüren lassen, sondern sich damit allenthalben, wie einem ehrliebende Musicanten zustehet, verhalten solle …“. Diese Bedingungen unterzeichnet am 17. Mai 1654 Graf Christian Günther, nachdem Christoph „mit Hand und Mundt zugesaget hat“. Die Besoldung ist gering – 35 Gulden jährlich inklusive Mietzuschuss, dazu noch zehn Maß Korn und die Genehmigung zum Bierbrauen. Außerdem darf Christoph auswärts musizieren, und an ihn müssen sich Bürger wenden, die Musiker für Hochzeiten und Kindstaufen engagieren wollen.
Nun steigt also auch er täglich die 162 Stufen hoch, aber in besserer Position als Caspar Bach drei Jahrzehnte zuvor, Caspar, der seit zehn Jahren nicht mehr lebt. Christophs Söhne lieben das Schloss und seine Gärten. Da ist die gewaltige Linde mit ihren Tanzböden auf drei Etagen, durch Leitern verbunden, und die Grotte, mit weißen und blauen Steinen ausgelegt, die durch verborgene Wasserröhren zum Bassin gemacht werden kann. Graf Christian Günther II. von Schwarzburg-Sondershausen zu Arnstadt, ein Jahr jünger als Heinrich, gefallen solche Spielereien, er hat Wasserrohre sogar bis zu den Rasenbänken vor der Grotte legen lassen.
„Setzt euch nieder“, sagt der Gärtner den Zwillingen Ambrosius und Toffel, dann lässt er das Wasser fließen, und sie juchzen auf, als im eben noch trockenen Gras ihre Beinkleider nass werden – so wie die der erwachsenen Gäste, mit denen sich der Graf solche Späße erlaubt. Sie staunen über die Eisgrube, aus der mitten im Sommer das dort verwahrte Eis geholt werden kann, um Getränke zu kühlen, über den Springbunnen im Rosengarten, der allerlei kleine Wasserkünste antreibt, aber viel Zeit ist für solche Entdeckungen nicht neben dem Lernen. Schon machen sich die Zwillinge, jetzt neun Jahre alt, neben dem Schulunterricht auf Instrumenten kundig, wie auch ihr älterer Bruder Georg Christoph. Er neigt zur Orgel, auf der sein Onkel Heinrich ihn unterweist, die Jüngeren sind für die Geige geboren. (…)
Volker Hagedorn