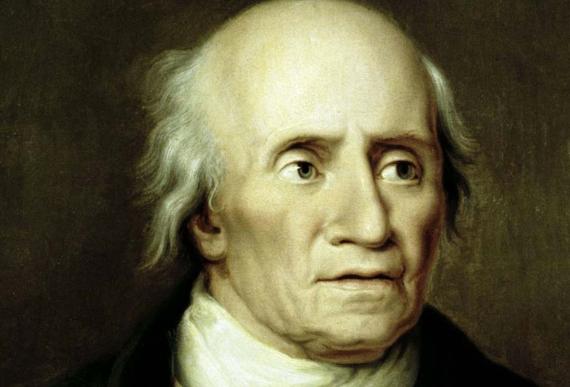Gespenstischer Klang

Ein pittoresker Urlaubsort an der Küste, Les Petites-Dalles im September. Ich sitze vor der Badehütte und lasse die untergehende Sonne nicht aus dem Blick. Sie scheint auf dem Horizont zu balancieren, erinnert an die quietschroten Hüpfbälle, auf denen sich meine Töchter vor zwei Jahrzehnten laut kreischend fortbewegten. Für einen Moment bin ich abgelenkt, weil meine Nachbarin, die unerschrocken bei jedem Wetter schwimmen geht, sich von mir verabschiedet und einige französische Vokabeln aus mir herauslockt, deshalb habe ich nicht genau registriert, wann sich die Sonne am scharfen Horizont verletzt hat, denn plötzlich blutet sie aus, verschenkt ihre ganze rote Farbe an wenige Schleierwolken am Horizont. Sie stirbt sehr malerisch. Große Oper. Dafür muss ich auf ein anderes meteorologisches Wunder verzichten: das grüne Leuchten, den letzten, grünen Strahl der versinkenden Sonne - Le rayon vert, den der französische Regisseur Éric Rohmer in seinem Kinofilm für alle Wunderskeptiker eingefangen hat.
Die Wunde am Himmel wird grau und verschorft sehr schnell. Noch ein Wunder. Ein medizinisches Wunder. Ich drehe mich um. Die Nacht thront bereits auf den Kreidefelsen und lässt ihren schwarzen Rock hinunter. Schwarzer Taft gleitet über mich hinweg und über das blitzende Parkett des regungslosen Meeres. Seidenes Knistern - welch elektrisierendes Geräusch! Man sehnt sich nach Musik, Ballsälen und Umarmungen. Ich reibe mir die Augen, stehe langsam auf, um die Atmosphäre nicht zu zerstören, schließe so leise wie möglich die (immer klemmende) Badehüttentür und gehe zum Parkplatz. Ich warte, bis irgendein anderes Auto als erstes die Andacht zerstört, dann starte ich selbst den Motor und fahre die fünf Kilometer betulich zurück zu meinem Ferienhaus in Theuville aux Maillots, passiere auf dem Weg dorthin viele graugescheckte Kühe, die sich zu schützenden kleinen Grüppchen für die Nacht zusammengeschlossen haben.
Ausgelöster Weihnachtsreflex
Weil ich vergessen habe, ein Licht anzuschalten bevor ich zum Strand aufbrach, muss ich mich zur Haustür vortasten, schrecke kurz auf, weil eine nahezu schwarze Katze vorbeihuscht. Natürlich ist der letzte Schlüssel am Schlüsselbund der passende. Im Haus rieche ich als erstes das frische Holz des Fußbodens, den ich gestern auf der Galerie muskelsauer verlegt habe. Ich schalte ein schwaches Licht an und entzünde mit den Holzresten des Parketts den Kamin, lösche dann wieder das Licht, werfe einen Blick aus dem Fenster. Nur schemenhaft sind auf der nahen Weide noch einige Kälbchen und Färsen zu erkennen.
Der tiefdunkle Rotwein, ein Haut Medóc, schmeckt tatsächlich, wie auf dem Etikett versprochen, samtweich und passt zum Taft der Nacht. Von meinem Schmöker, den ich rezensieren soll, huscht mein Blick immer wieder zum Feuerwerk des Kamins. Gemütlich! - eigentlich ein Wort, vor dem ich mich fürchte und das ich gerne unter der Rubrik Kitsch ablege. Kaminfeuer löst bei mir immer kurzzeitig den Weihnachtsreflex aus. Mir fehlt dann ein Hund, am besten ein blauschwarz-glänzender Labrador. Oder wenigstens ein Esel. Und bei Geräuschen der Nacht, die mich eigentlich mit hämmerndem Herzen aufschrecken lassen sollten, denke ich, es seien die Heiligen Drei Könige, die gleich anklopfen werden und ein paar Geschenke mitbringen.
Da begann das Grausen
Ich lasse das Feuer langsam ausgehen, so gewöhnen sich meine Augen an die Nacht. Einer alten Gewohnheit folgend, mache ich im Bad ein Licht an und lasse die Tür einen Spalt offen, so, wie ich es in Kindertagen gemacht habe, nachdem ich mich vergewissert hatte, dass sich im großen Kleiderschrank und unter dem Bett niemand versteckt hielt, auch nicht der oft beschworene "Schokoladenonkel", der Kindern Schokolade anbot und dann ins Auto zerrte. Diese bernsteingelbe Lichtspalte verstärkt den Glanz des Taftschwarz. Dank dieser Spalte hatte ich Zugang zur Welt im Haus, das in der unteren Etage weiterwogte, ein murmelnder Klangteppich, aus dem mal die sonore Stimme von Mister Tagesschau, Karl-Heinz Köpcke, die Basstiefe meines Vaters, die schnippischen Spitzen meiner Mutter, das leicht vorwurfsvolle Gezeter meiner calvinistischen Großmutter oder ein Juchzer meiner sechs Jahre älteren Schwester Wilma identifizierbar waren.
Gespenstisch wurde dieser Klangteppich, wenn die Schlaflosigkeit stärker war als der Wille, zu schlafen, wenn die Stimmen keine Zuordnung erlaubten und ihren Trostcharme verloren, wenn nur noch das anonyme Murmeln blieb, das auch nicht ganz verstummte, wenn alle geräuscharm schlafen gegangen waren. Da begann das Grausen vor der Nacht.
Die Angst vor dem Nichts
Der französische Philosoph Emmanuel Levinas hat in diesem "Murmeln der Stille" eine unpersönliche Macht entdeckt, das "es gibt" (il y a); ein Sein, das auf die anonyme Schicksalsmacht der Griechen zurückverweist, an die wir verfallen, wenn wir ihr schlaflos ausgeliefert sind. In dieser Situation taucht nicht "die Angst vor dem Nichts" auf, wie Heidegger wollte, sondern das Entsetzen oder der Ekel vor dem Sein, das mit einer Entpersönlichung droht. Die Nacht ist das Sein ohne Welt. "Die Abwesenheit von Perspektive ist nicht bloß negativ. Sie wird zur Unsicherheit. (...) Die Unsicherheit kommt nicht von den Dingen des Tages, die die Nacht verbirgt; sie liegt gerade darin, daß sich nichts nähert, daß nichts kommt, daß nichts droht: Diese Stille, diese Ruhe, dieses Nichts an Empfindungen stellt - absolut - eine dumpfe unbestimmte Bedrohung dar. Die Unbestimmtheit macht das Akute an ihr aus." Für Levinas konnte aus dieser Erfahrung nur die Sehnsucht werden, sich vom unpersönlichen Sein zu entfernen, dem Sein zu entfliehen, letztlich dadurch, dass man sich im Sohn oder der Tochter (nicht nur in einem biologischen Sinn verstanden) verunendlicht und dem Sein ein Schnippchen schlägt.
Die zwei Giganten der hermeneutischen Philosophie, Heidegger und Levinas, versuchen jeweils Erfahrungen zu beschreiben, die eine Wertung des Seins als anonyme Macht oder als Geschenk nachvollziehbar machen. Für Heidegger ist das Sein positiv erfahrbar, für ihn beschreibt das berüchtigte Seinsereignis eine "Lichtung", einen Spielraum, der neue Möglichkeiten erschließt. "Sein" heißt "Möglich-sein". Für Levinas wird im Grausen der Nacht das Sein als drohende Macht der Entpersönlichung erfahrbar. "Sein" heißt: "Ans-Sein-gefesselt-sein". Und für Levinas, der während des Zweiten Weltkrieges in einem Lager für jüdische Kriegsgefangene mühsam überlebte, ist diese Erfahrung der dunkle Unterton aller politischen und religiösen Ideologien, die den einzelnen Menschen mit Entpersönlichung und damit Entmenschlichung bedrohen. Der entmenschlichende Naziterror ist eine Antwort auf dieses dämonische Sein.
Die Nacht selber wacht
Streng genommen darf Levinas nicht den Ausdruck "Erfahrung" benutzen, denn Erfahrung setzt Bewusstsein voraus und damit eine deutlich Distanz zur Anonymität des "Es gibt". Richtiger muss man von der Unmittelbarkeit des Grausens in der Schlaflosigkeit sprechen. "Das Wachen ist anonym. In der Schlaflosigkeit gibt es nicht mein Wachen über die Nacht; es ist die Nacht selber, die wacht. Es wacht. In diesem anonymen Wachen, in dem ich dem Sein völlig ausgeliefert bin, sind alle meine Gedanken, die meine Schlaflosigkeit füllen, an nichts festgebunden. Sie sind ohne Träger. Ich bin, wenn man so will, eher das Objekt als das Subjekt eines anonymen Denkens. (...) Die Rede von dem anonymen Wachen geht über das Phänomen hinaus, das schon ein Ich voraussetzt, entzieht sich folglich der deskriptiven Phänomenologie. (...) Sobald der erste Sonnenstrahl die Nacht zerstreut, lässt sich das Entsetzen der Nacht nicht mehr bestimmen." Alle Denkanstrengung von Levinas zielt darauf, Herrschaft über das dunkle Sein zu erlangen, deshalb auch warnt er - für einen Calvinisten sehr anziehend - vor dem Phänomen der Faulheit, die sich dem dunklen Sein wohlig nähert.
Ich mache die Probe, lösche das Licht im Badezimmer und setze mich in einen unbequemen Stuhl, um der Schlaflosigkeit möglichst nahe zu kommen. Ich versuche damit auch eine Lösung auf ein sehr vertracktes Problem zu finden, die seit der Romantik noch aussteht: E. T. A. Hoffmann hat in seinem berühmten Nachtstück Der Sandmann anhand zweier Protagonisten die Frage aufgeworfen, ob "jeder Mensch, sich frei wähnend, nur dunklen Mächten zum grausamen Spiel diene", oder ob "alles Entsetzliche und Schreckliche" nur im Inneren des Menschen angelegt sei und die "Außenwelt daran wohl wenig" teilhabe.
Leise Botschaften
Dem Reflex, ein neues Glas Wein zu trinken, gebe ich nicht nach, um die beginnende Schläfrigkeit nicht zu forcieren. Und auch der Plattenspieler bleibt ausgeschaltet, obwohl ich vor dem Strandbesuch bereits mein altes Lieblingsvinyl von Randy Newman aufgelegt hatte. Ich liefere mich also der Nacht aus. Bereits dieser Entschluss ruft eine erste Unbehaglichkeit hervor. Von Stille kann keine Rede sein. Die Natur draußen schickt leise, schwer zu deutende Botschaften, und auch das Haus schläft nicht. Offenbar verschafft sich ein Marder, den ich verjagt glaubte, erneut Zutritt. Aber vielleicht ist es auch gar kein Marder. Vielleicht hoffe ich jetzt nur, es sei ein Marder, damit ich die Geräusche benennen kann. Damit die Unbestimmtheit gebannt ist. Je länger ich mich in diese murmelnde Stille hinein phantasiere, umso stärker wird der Wunsch, zu schlafen, um der zunehmenden Unheimlichkeit zu entfliehen. Nicht zufällig wird diese Angst "namenlos" genannt, weil es eben nicht Dinge sind, vor denen ich mich ängstige. Ich hebe immer wieder die Schultern, um eine Verspannung zwischen den Schulterblättern zu lösen. In meinen Nieren sticht es mehrfach heftig. Ich sehne mich immer stärker danach, zu schlafen, und kann und will es nicht. Weil mir nach einer Stunde zunehmend schlecht wird, laufe ich einige Male mit eingezogenem Kopf auf und ab, setze mich wieder, falle kurzzeitig in einen wirren Traum, aus dem ich noch wirrer aufschrecke. Ich halte wenig tapfer aus, bis das Nachtschwarz am Horizont aufbricht und das Grausen eine Richtung hat, in die es abfließen kann.
Die Romantik suchte bekanntlich in den Nachtseiten des Bewusstseins einen Zugang zum Irrationalen. Mir erschließt sich hier eine dämonische Transzendenz. Auch wenn der Selbstversuch mich nicht restlos überzeugt hat: Die Erfahrung des Unpersönlichen in der Nacht, die streng genommen keine Erfahrung im strikten Wortsinn ist, macht mir verständlich, warum Levinas immer gegen mystische Religiosität zu Felde gezogen ist. Und: Ich verstehe jetzt, nach diesem Nachtkater, besser, worin die Pointe der christlichen Weihnachtsgeschichte besteht: In der Heiligen Nacht kommt es zur Geburt eines Menschensohns, von dem gesagt wird, er sei das Licht der Welt und erlaube einen Zugang zu einem persönlichen Gott, der an den Menschen interessiert ist. Kein blindes Schicksal, sondern ein Gott, der innerweltlich zugänglich ist. Das ist tröstlich.
Den nächsten Tag habe ich übrigens dösend im Liegestuhl vor der Badehütte verbracht. Ich bin nicht schwimmen gegangen, der dunklen Untiefen wegen. Meine Nachbarin hat meine Unlust nicht verstanden. Mein Französisch ist nicht gelenkig genug, um es ihr ausführlich zu erklären. Ich habe von einem Kater gesprochen. Sie hat wissend genickt und sich unerschrocken ins dunkle Meer begeben.
Seit dieser Nacht bin ich ein Freund des Hellen.
LITERATUR
Emmanuel Levinas: Vom Sein zum Seienden. Aus dem Französischen von Anna Maria Krewani und Wolfgang Nikolaus Krewani. Verlag Karl Alber, Freiburg/ München 2008, 184 Seiten, Euro 19,-.
Klaas Huizing
Klaas Huizing
Klaas Huizing ist Professor für Systematische Theologie an der Universität Würzburg und Autor zahlreicher Romane und theologischer Bücher. Zudem ist er beratender Mitarbeiter der zeitzeichen-Redaktion.