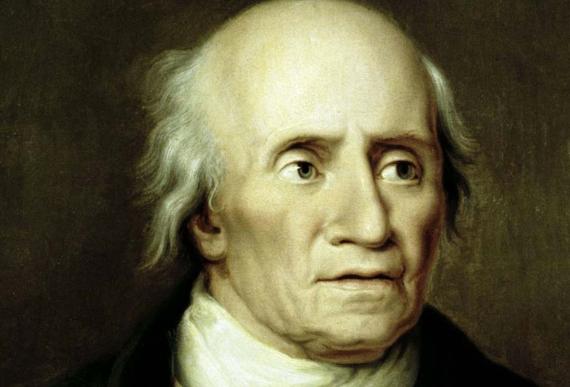Nackt und unschuldig geboren

Sind alle Menschen gleich? Ja, was denn sonst, sagt man schnell und oberflächlich. Aber so einfach ist es natürlich nicht. Worin sind und worin sollen die Menschen gleich sein? An Besitz, an Rechten, vor Gott?
Gleichheit ist Glück heißt ein aktuelles Buch von Richard Wilkinson und Kate Pickett. Der deutsche Titel - im Original heißt es The Spirit-Level (Die Wasserwaage). Why Equality is Better for Everyone – offenbart den Glauben des Verlages, dass das Publikum die Gleichheit liebt. Und das tut es ja auch. Seit die Französische Revolution die Égalité zu einem ihrer drei Schlagworte gemacht hat, war sie eine Antriebskraft der Geschichte. Demokratie hat immer irgendwie mit Gleichheit zu tun. Kaum jemand hat je offen für die Ungleichheit gekämpft.
Unter der Fahne der Gleichheit selten einig
Aber im Namen der Gleichheit floss auch viel Blut. Das liegt wohl auch daran, dass man sich unter der Fahne der Gleichheit selten einig war. Schon der gescheiterte Aufstand des "Bundes der Gleichen" unter Gracchus Babeuf im revolutionären Frankreich zeigt das. Babeuf wollte eine Gleichheit des Eigentums, wofür er 1796 auf die Guillotine musste. Die bürgerlichen Revolutionäre wollten Rechtsgleichheit (für Männer), aber keine ökonomische Gleichheit.
Man redet abstrakt und undifferenziert von der Gleichheit - seit jeher. Das beginnt schon bei der griechischen Philosophie, auf die man gemeinsam mit dem Christentum den Gleichheitsgedanken gewöhnlich zurückführt.
Bei Aristoteles kommt die Idee der Gleichheit nur indirekt vor, als Folge des allgemeinen Begriffs des Menschen. Wenn er in De Anima erklärt, die Seele sei das formale Prinzip des Leibes, so gilt diese Aussage natürlich für den Menschen schlechthin. Daraus kann man, wenn man will, eine Gleichheit aller Menschen herauslesen. Im Konkreten aber, in seiner "Politik", rechtfertigt Aristoteles die Sklaverei: "Denn was von Natur dank seines Verstandes vorauszudenken vermag, ist ein von Natur Herrschendes ... , was dagegen mit den Kräften seines Leibes das so Geplante auszuführen vermag, das ist ein Beherrschtes und von Natur Sklavisches."
Die Verallgemeinerung des Gleichheitsanspruches kritisiert er als politischen Unruhefaktor: "Die Vielheit der politischen Verfassungen rührt daher, dass man übereinstimmend das Prinzip der Gleichheit proklamiert, aber das Prinzip falsch versteht. Die Demokratie ist daraus entstanden, dass man meinte, dass wer in einem bestimmten Stücke gleich ist, es auch schlechthin sei; denn weil alle gleichmäßig frei geboren sind, meinen sie, schlechthin einander gleich zu sein. Die Oligarchie hat ihren Ursprung in der Auffassung, wer in einem Stück ungleich sei, sei es schlechthin; denn weil die Oligarchen den anderen im Reichtum ungleich sind, meinen sie, ihnen schlechthin ungleich zu sein." "Gerechtigkeit", schreibt Aristoteles, "besteht in der Gleichheit für Gleiche, nicht für alle. Und darum ist auch die Ungleichheit gerecht, nämlich für die Ungleichen, nicht für alle."
Jesus und die Gleichheit
Was Aristoteles in De Anima sagt, gilt für einen abstrakten Menschen und hat keine konkrete Bedeutung. Die Scholastik des Mittelalters hat daraus den Mensch als animal rationale gemacht - und ebenso keine egalitären Forderungen abgeleitet.
Jesus spricht nie von Gleichheit. In seiner häufigen Rede von "Herr" und "Knecht" wird dieses Herrschaftsverhältnis nicht kritisiert. Den Verkünder des Heils interessieren die Ungleichheitsverhältnisse unter den Menschen offenbar nicht. Es geht ihm um den Nächsten, aber wer der Nächste ist, bleibt unklar. Erst aus dem Missionsgebot des Auferstandenen "Gehet hin und lehret alle Völker und taufet sie" kann man die Gleichheit aller Völker gegenüber dem Wort Gottes ableiten.
Die weltweite Ausbreitung brachte die Anerkennung aller Bekehrten als Gleiche im Glauben. Aber auch bekehrte Sklaven blieben Sklaven. Am Ausgleich sozialer Unterschiede war die frühe Kirche nicht interessiert. Von Papst Gregor I. berichtet Beda Venerabilis, ihm seien auf dem Markt in Rom versklavte angelsächsische Jünglinge wegen ihrer strahlenden Gesichter aufgefallen. Als er erfuhr, dass sie "Angeli" seien, meinte er wortspielerisch: "Zu Recht, denn sie haben ein engelgleiches Aussehen, und es geziemt sich für sie, Gefährten der Engel im Himmel zu sein." Ihr irdisches Schicksal berührte Gregor dagegen nicht.
Die Trennung zwischen dem abstrakten Menschen mit allgemeinen Eigenschaften und den ungleichen Menschen der Wirklichkeit findet sich auch bei den Aufklärern. Immanuel Kant redet von der allgemeinen Menschenwürde und fällt dennoch in seinen "Beobachtungen über das Gefühl des Erhabenen und Schönen" ein vernichtendes Urteil über "die Neger". Sie hätten "von Natur kein Gefühl, welches über das Läppische stiege". Ähnlich Montesquieu ("Vom Geist der Gesetze", Buch 5): "Da alle Menschen von Geburt aus gleich sind, so muss man sagen, dass die Sklaverei gegen die Natur verstößt, obgleich sie in einigen Ländern auf natürlichen Ursachen beruht, und man muss gut unterscheiden zwischen diesen Ländern und jenen, wo die natürlichen Ursachen ihr entgegenstehen, wie die Länder Europas, wo sie ja glücklicherweise abgeschafft ist."
Gleichheit nur für Europäer
Das ist der Kern des Gleichheitsdenkens der Aufklärer: Die Gleichheit gilt nur für Europäer. Obwohl er im Vorwort die Beseitigung der Vorurteile fordert, lehrt Montesquieu eine diskriminierende Völkerpsychologie: Die Inder seien von Natur aus feige und die Chinesen Betrüger. Am schlechtesten schneiden die Afrikaner ab: "Man kann sich nicht vorstellen, dass Gott, der doch ein allweises Wesen ist, eine Seele, und gar noch eine gute Seele, in einen ganz schwarzen Körper gelegt hat." Das öffentliche Bewusstsein hat sich heute, nach den mörderischen Erfahrungen der Sklaverei, des Kolonialismus und vor allem des Massenmordes an den Juden auf die Leugnung der Unterschiede zwischen Menschengruppen festgelegt. Das Dogma lautet: "Rassen gibt es nicht." Die äußerlich erkennbaren Unterschiede zwischen Menschengruppen seien bedeutungslos, und die anderen nur kulturelle Konstruktionen.
Biologen entziehen sich oft der brenzligen Frage nach den Ungleichheiten. Steven Rose beispielsweise schreibt: "Die Kategorien Intelligenz, Rasse und Geschlecht sind undefinierbar mit den Mitteln naturwissenschaftlicher Forschung". Ob man genetische Unterschiede für unbedeutend hält, ist eine Ermessensfrage. Genetiker wissen jedenfalls, was Kulturwissenschaftler nicht wissen wollen, dass man nämlich die Zugehörigkeit zu Gruppen gemeinsamer geographischer Herkunft am Genom erkennen kann. So zeigte eine Studie in Indien, dass die Angehörigen verschiedener Kasten sich genetisch deutlich unterscheiden. Und die gruppenspezifisch verschiedene Häufigkeit so genannter "Polymorphismen" in den Genomen ist nicht nur relevant für die Ausprägung äußerer Merkmale wie der Hautfarbe, sondern auch für viele medizinische Risiken. Da sich zeigte, dass zum Beispiel manche Medikamente gegen Herzkrankheiten bei schwarzen Amerikanern weniger wirken als bei weißen, ist "Race" für die Pharmaindustrie ein wichtiger Faktor.
"Ein biologischer Egalitarismus wird wohl nicht glaubhaft bleiben, angesichts der wachsenden Zahl empirischer Daten", verkünden der Genetiker Bruce Lahn und der Ökonom Lanny Ebenstein. Sie fordern sogar: "Lasst uns die genetische Vielfalt der Menschen feiern!" Angesichts dieser Erkenntnisse ist es nicht nur verwirrend, sondern auch gefährlich, pauschal von der Gleichheit der Menschen zu sprechen.
Einen Ausweg bietet eine grundsätzliche Kategorisierung, die Gerhard Knauss auf dem Welt-Philosophenkongress in Istanbul 2003 vorschlug. Zu unterscheiden sind demnach zwei prinzipiell verschiedene Weisen von Gleichsein: als ein feststellbarer Sachverhalt und als ein moralisches Postulat, also konstitutive und normative Gleichheit. Eine normative ist eine durch Übereinkunft geschaffene, eine konstitutive ist eine von Natur vorgegebene Gleichheit. Eine Gleichheit kann faktisch sein, wie zum Beispiel die Rechtsgleichheit in Deutschland, aber nicht konstitutiv. Wenn Rechtsgleichheit, also eine normative Gleichheit, herrscht oder gewünscht wird, zum Beispiel der Frauen und Männer, kann man daraus nicht folgern, dass generelle konstitutive Gleichheit besteht oder hergestellt werden kann. Konstitutiv gleich sind alle Menschen, unter anderem in bestimmten physiologischen Bedürfnissen, nach Nahrung zum Beispiel. Aber schon über die Gleichheit psychischer Bedürfnisse kann man streiten. Brauchen alle Menschen Liebe? Als Christ sagt man ja, aber es gibt auch Gründe, daran zu zweifeln.
Gegen "ideologischen Brei"
Eine ähnliches Hilfsmittel gegen den "ideologischen Brei" bietet der Soziologe Rainer Paris an: Er unterscheidet binäre und graduelle Ungleichheit. Binäre Ungleichheit bezieht sich auf Unterschiede zwischen verschiedenen Kategorien von Menschen, die durch Herrschaftsstrukturen festgelegt sind. Was der eine darf, ist dem anderen verwehrt. Es gibt dabei stets nur ein Entweder-Oder. Ein Beispiel ist die Staatsangehörigkeit. Politische Akte können binäre Ungleichheiten aufheben.
Graduelle Ungleichheit dagegen bezieht sich auf "Lebensumstände, die durch einen größeren oder geringeren Abstand des Lebensniveaus und der Bedürfnisbefriedigung als Konsequenz einer ungleichen Verteilung von Ressourcen gekennzeichnet sind". Der Prototyp ist die Kluft zwischen Arm und Reich. Im Gegensatz zu binärer ist graduelle Ungleichheit nie völlig aufhebbar, was die "rigorosen Anhänger der Gleichheit" bei ihren Forderungen durch "strategische Vermischung" der Kategorien verdecken, wie Paris feststellt. Und weil dieser Gleichheitsanspruch unerfüllbar bleibt, "hört der Streit gewissermaßen nie auf".
Paris' Unterscheidung ist eine rein soziologische, die anthropologische Aspekte des Gleichheitsproblems nicht erfasst. Konstitutive und normative Gleichheit oder Ungleichheit sind dagegen sozusagen vorsoziologische Kategorien. Die graduelle Ungleichheit der Einkommen ist eine sozial erzeugte und von völlig anderer Qualität als die graduelle Ungleichheit zwischen musikalischen und unmusikalischen Menschen, die auch eine physiologische, eine leibliche, ist. Menschen werden zwar alle nackt, unschuldig und hilfsbedürftig geboren, aber in anderen konstitutiven Voraussetzungen unterscheiden sie sich bereits. Dass alle Menschen frei geboren werden, ist eine Norm, auch wenn wir sie heute als quasi-konstitutiv betrachten.
Gleichheit als Norm spielt seit jeher die Hauptrolle im Gerechtigkeitsdiskurs. Für egalitaristische Philosophen wie Stephan Gosepath (in seinem Buch Gleiche Gerechtigkeit) bedeutet Gerechtigkeit die gleiche Verteilung aller Güter. Grundsätzlich hat ein arbeitsloser Nigerianer demnach ein Recht auf den gleichen Anteil wie ein deutscher Topmanager. Jede materielle Ungleichheit ist für Gosepath rechtfertigungsbedürftig: "Im Prozess der Rechtfertigung mögen sich Gründe ergeben, diejenigen, die an der Produktion beteiligt waren, zu privilegieren." Eine gerechte Gesellschaft sei auch verpflichtet, körperliche und andere nicht durch "freies Handeln" entstandene Nachteile auszugleichen. Gosepath stellt also die Norm gleicher Güterverteilung über konstitutive Ungleichheiten, die nicht akzeptiert werden.
Bedarf nach Unterscheidung
In der politischen Praxis werden daraus "Gleichstellungsmaßnahmen" und die Forderung nach "Chancengleichheit". Unklar bleibt dabei meist, was genau man eigentlich angleichen will. Müssten ungleich verteilte Begabungen strenggenommen nicht genauso ausgeglichen werden, wie ungleich verteilte körperliche Beeinträchtigungen? Das Dilemma solcher Politik ist, dass sie zur Herstellung abstrakter Gleichheit konkrete Ungleichheit schafft, etwa durch die bevorzugte Einstellung von Frauen und körperlich Behinderten im öffentlichen Dienst. Spätestens bei diesen Fragen werden die Grenzen sinnvoller Gleichheitsnormen offensichtlich.
Westliche Gesellschaften sind geprägt durch den Gegensatz von Gleichheit und individueller Freiheit. Daraus entstehen Konflikte, denn Freiheit bedeutet immer, die eigene Ungleichheit auszuleben. Je gleicher die Menschen sein sollen und wollen, desto größer scheint der Bedarf nach Unterscheidung zu werden, wie der Soziologe Jean-Claude Kaufmann in seiner Identitätstheorie aufzeigt (Die Erfindung des Ich). Der moderne Mensch, den immer weniger Vorweg-Festlegungen binden, der also in mancherlei Hinsicht mit allen anderen gleich sein soll, muss sich umso mehr fragen, wer er selbst ist. Der Wunsch nach Einzigartigkeit wächst mit der normativen Gleichheit. Als derzeit tragfähiger Kompromiss erscheint die Kombination aus Sozialstaat und Konsumgesellschaft. Die Vielfalt des Warenangebots erlaubt dem Konsumenten, wie Andreas Wirsching (Konsum statt Arbeit, Vierteljahreshefte für Zeitgeschichte, 2/2009) feststellt, auch in der Masse Individualität auszuleben. Der real existierende Sozialismus bot diesen Ausgleich zur Gleichheit nicht.
Die Balance zwischen Gleichheit und Freiheit zu halten, ist für demokratische Gesellschaften überlebensnotwendig. Darüber nachzudenken, worin alle Menschen gleich sind und sein sollten und worin sie es nicht sein können, gehört dazu. Unser Leib, zu dem die ungleiche Verteilung von Begabungen und Mängeln gehört, setzt der Gleichheit unüberwindbare Schranken. Dahinter beginnt die Freiheit.
Ferdinand Knauß ist Redakteur beim Handelsblatt.
Ferdinand Knauß