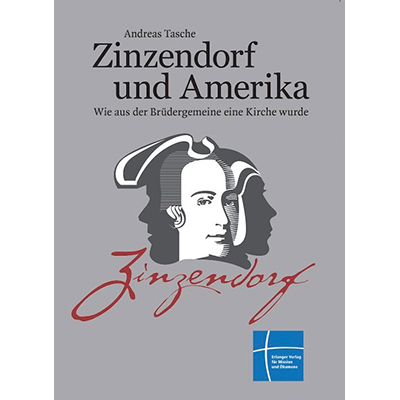Luther, Karl und der Weg nach Europa

Natürlich stritten in Worms 1521 Kaiser Karl V. und Martin Luther, damals noch Augustinermönch, nicht von gleich zu gleich und schon gar nicht laut. Aber die geschichtsträchtige Begegnung vor genau 500 Jahren mündete in großen Kämpfen, aus denen sich das moderne Europa formte, wie der emeritierte Berliner Historiker und bekannte Buchautor Heinz Schilling beschreibt.
Streitkultur meinte im Christentum lange Glaubenskampf. Vorbild waren die Glaubensstreiter des Alten Testaments – Judas Makkabäus, Gideon, David, sogar eine Frau: Judith, die Bezwingerin des Holofernes. Im Kampf gegen die Muslime, vor allem während der spanischen Reconquista, ergänzt um
St. Georg und St. Jago/Jakob, die Patrone der Ritterorden.
Eine Wende schien die Reformation mit Martin Luther zu bringen, dem bis heute prominentesten Glaubensstreiter der Neuzeit für Protestanten wie Katholiken gleichermaßen, wenn auch mit entgegengesetztem, positivem beziehungsweise negativem Vorzeichen. In zwei Momenten offenbarte sich der Wittenberger Mönch als Streiter für den wahren christlichen Glauben – am 31. Oktober 1517 mit der Versendung seiner 95 Thesen, die andere sogleich veröffentlichen sollten, und am 17. und 18. April 1521 in seinem Verhör vor dem Reichstag in Worms. Beide Ereignisse wurden zu einem Mythos des neuzeitlichen Glaubensstreits, beide publizistisch heroisiert – das Wittenberger in der Pose des hammerschwingenden Revolutionärs, die Rede in Worms durch die Zuspitzung des letzten Satzes zum trotzig widerständigen „Hier stehe ich, ich kann nicht anders.“
Im Unterschied zu den genannten Glaubensstreitern war Luther nie ein Kriegsheld und diente auch selten als Ansporn zu militärischen Aktionen. Sein Metier war der Meinungsstreit, konkret der Streit mit dem und um das Wort Gottes. Als sein Landesherr daran ging, die Mauern der Residenzstadt Wittenberg zu einer Festung auszubauen, dichtete Luther „Eine feste Burg ist unser Gott“ und mahnte damit den Fürsten, von seiner militärischen Rüstung zu lassen, denn „es streit für uns der rechte Mann, den Gott hat selbst erkoren.“ Das war ein Aufruf zum geistigen Streit. Zur martialischen „Marseillaise des Protestantismus“ (Heinrich Heine) haben dieses „Glaubenslied“ erst später Generationen gemacht.
Luther selbst, so sehr er einen militanten, ja aggressiven Sprachstil „pflegte“, hielt zeitlebens zu militärischem Austrag der Gegensätze Distanz. Als die protestantischen Stände Anfang der 1530er-Jahre in Schmalkalden über ein Verteidigungsbündnis berieten, hatten die Juristen einige Mühen, den Reformator davon zu überzeugen, dass militärischer Widerstand gegen den Kaiser reichsrechtlich erlaubt sei.
Demonstration und Drohung
Mit seiner Wittenberger Aufforderung, öffentlich über seine wissenschaftlichen Thesen zu disputieren, hatte Luther keinen Erfolg. Der Meinungsstreit blieb aus, weil sich niemand aufgerufen fühlte, über die Lehrsätze des Mönchs und Bibelprofessors zu streiten. Ein Zeichen, dass diese gar nicht so neu und provokativ waren, wie es Rom wenig später verkündete? Umso größer die Erwartung, die der Reformator auf die Einladung nach Worms vor den Reichstag setzte – vor die vornehmste und europaweit beachtete Öffentlichkeit der Christenheit, die 1521 umso glänzender und zahlreicher besucht war, als es sich um den ersten Reichstag des eben in Aachen gekrönten Deutschen Königs und Erwählten Römischen Kaisers Karl V. handelte. Luthers Auftritt stand dann auch in der Tat ganz im Zeichen des geistigen Meinungsstreits, jedenfalls auf der Reichstagssitzung selbst. Außen demonstrierten und drohten teils bewaffnete Lutheranhänger – nicht ganz unvergleichbar mit dem, was neulich zu Jahresbeginn in Washington vor dem Haus einer der vornehmsten modernen Repräsentationsversammlungen geschah. Mit dem entscheidenden Unterschied aber, dass Luther alles daransetzte, seine Anhänger vom gewaltsamen Eingreifen abzuhalten und den geistigen und friedlichen Charakter des Meinungsstreits zu sichern.
Das ist ihm gelungen, aber nur in der von den Politikern zuvor ausgehandelten Form: Eine Gelehrtendisputation, wie er sie nach dem Wittenberger Fehlschlag nun auf dem Reichstag erhofft hatte, fand nicht statt. Der Mönch wurde verhört, konnte aber seine Meinung kundtun, zudem entscheiden, ob er bereit war, sie bis zum Letzten zu vertreten. Und da das alles öffentlich geschah und bald zahlreiche Pamphlete das Geschehen und Luthers Rede verbreiteten, konnten sich die Menschen ein eigenes Bild machen – indem sie die Texte lasen oder sich vorlesen ließen.
Auf dem Reichstag ist es schließlich zwar wenn auch nicht zu einem freien Meinungsstreit, so doch zu einem öffentlichen Austausch gegensätzlicher Einschätzung der aufgeworfenen Glaubensfrage gekommen. Kein Geringerer als Kaiser Karl V. selbst sah sich durch die Antworten des Mönchs, womöglich auch durch dessen Unerschrockenheit, aufgerufen, für sein Verständnis des christlichen Glaubens zu streiten. Nach Ende der Verhandlungen formulierte er in seinem Quartier seinen persönlichen Glauben und ließ dieses Bekenntnis am folgenden Tag auf dem Reichstag verlesen. Das war ein kaiserlicher Hoheitsakt der öffentlichen Glaubensbekundung, nicht etwa eine Rechtfertigung gegenüber dem Bekenntnis des Mönchs. Dazu sah Karl sich kaum veranlasst, gab ihm sein hohes Majestätsbewusstsein doch Gewissheit, dass Gott ihn unmittelbar beauftragt hatte – im Kaiseramt wie nun konkret bei der Bekundung des einzig wahren Glaubens. Luthers Allein-durch-Gnade-Lehre fühlte er sich nicht bedürftig. Ein im Kern asymmetrischer Glaubensstreit also, in dem allerdings beide Kontrahenten sicher waren, die allein wahre Lehre zu vertreten.Wie bekannt, musste der Mönch die drohenden mörderischen Konsequenzen dieser fundamentalen Asymmetrie nicht erleiden, anders als rund 100 Jahre zuvor der Tscheche Jan Hus, der 1415 in Konstanz als Ketzer verbrannt worden war. Luther wurde das zugesagte freie Geleit gehalten – nicht aus Toleranz oder Liberalität, sondern aufgrund politischer Absprachen.
In dieser Hinsicht kann man in Worms 1521 doch einen Moment freier Streitkultur entdecken. Eine Perspektive der Befriedung oder gar des Ausgleichs, der Annäherung eröffnete sich damit nicht. Im Gegenteil: Aus dem in Worms asymmetrisch ausgetragenen Streit entwickelte sich in den darauffolgenden Jahrzehnten ein mörderischer Antagonismus der theologischen Systeme und der politischen und militärischen Blöcke, die sich am Ende des Reformationsjahrhunderts bis an die Zähne gerüstet gegenüberstanden. Es hat zwar nicht an Versuchen gefehlt, die Konfrontation politisch oder rechtlich zu entschärfen. Die Oberhand behielten aber auf beiden Seiten die Hardliner, die die theologischen Streitpunkte fundamentalistisch deuteten und eine gewaltsame Entscheidung betrieben.
Die martialischen Glaubensstreiter traten wieder in den Vordergrund, konfessionell polarisiert – auf protestantischer Seite der Schwedenkönig Gustav Adolf, Oliver Cromwell in England oder der Oranier Wilhelm III. in den Niederlanden als Gideon, Judas Makkabäus oder neuer Moses; bei den Katholiken vor allem Maria, die Gottes Mutter selbst, die als „Maria Victrix“ auf Fahnen oder als bildliche Ikone den Heeren vorangetragen wurde oder 1571 in der Seeschlacht von Lepanto die christliche Flotte zum Sieg führte.
Die verheerenden Glaubens- und Staatenkriege hielten Europa über mehr als drei Jahrzehnte in Atem und trieben die christliche Zivilisation wiederholt an den Rand der Selbstvernichtung. Das war der erste große Zivilisationsbruch Europas, hervorgegangen aus innerchristlichem Streit. Speziell in der deutschen Geschichte hatte sich ein vergifteter Überschuss an Feindseligkeit und gegenseitigem Misstrauen eingenistet, der letztlich erst in der Gegenwart überwunden werden konnte. Das Christentum also ein Agent von Unversöhnlichkeit und fundamentalistischer Gewalt? Nicht Motor, sondern Hindernis auf dem Weg zu friedlichem Ausgleich von Streit und Meinungsunterschieden?
Diese Deutung unseres historischen Befundes wäre entschieden zu kurzschlüssig! Seitdem das Christentum im frühen vierten Jahrhundert eine Allianz mit dem römischen Staat einging, war es auf Wirken in der Welt ausgerichtet. Handeln in der Welt bedeutete aber für Christen wie für jeden andern, dass sie mit der Mentalität und dem politischen Instrumentarium der jeweiligen Zeit operierten – es sei denn, es waren Heilige, die aber damals wie heute selten waren, unter den Führern der Kirchen allemal. Die Jahrhunderte von Reformation und Konfessionalisierung waren eine Zeit außergewöhnlich hohen Konfliktpotentials, in der es zudem strukturell unmöglich war, den Streit über Glaubenswahrheiten allein intellektuell und auf friedlichem Wege auszutragen. Denn anders als heute waren Religion und Kirche integrierter Teil, ja Kern-Element der Staats- und Gesellschaftsverfassung. Es galt die Maxime religio vinculum societatis – ohne das Band ein und derselben Religion ist friedliches Zusammenleben in einer Stadt oder einem Staat nicht möglich. Religiöser Streit war immer zugleich politischer und gesellschaftlicher Streit und vice versa.
Und da in jenem Zeitalter Staat und Gesellschaft nicht anders als Kirche und Religion einem tiefen, konfliktreichen Umbruch von mittelalterlichen zu neuzeitlichen Formen unterlagen, war die Konfrontation um jeden Preis vorprogrammiert. Dementsprechend war auch der Weg zur Überwindung des fundamentalistischen Grundsatzstreites nur gemeinsam von Politik und Religion, Staat und Kirchen zu beschreiten. Die Friedensschlüsse, allen voran der Westfälische Frieden von 1648, die Mitte des 17. Jahrhunderts die militärische Gewalt beendeten und den Glaubensstreit einhegten, gingen nicht nur auf die Entscheidung von Politikern und Juristen zurück.
Vorbereitet und entscheidend legitimiert wurde der Friede von grundlegenden Veränderungen in Religion und Spiritualität. Das Christentum selbst hatte die Wendung vom Willen zur Konfrontation zum Willen zu Verträglichkeit und Frieden vollzogen – von der absoluten Priorität des Dogmas und der unabdingbaren Reinheit der Lehre hin zur inneren Frömmigkeit der „einfältigen“ Christenseele. Aus „Maria von Kampf und Sieg“ war Maria die Friedensgöttin geworden. Man richtete nicht mehr die Spitze des Schwertes gegeneinander, sondern stellte sich gemeinsam unter die Friedenstaube der Arche Noah als Zeichen des säkularen, vor allem aber des heiligen Friedens zwischen Gott und den Menschen wie den Menschen und der Schöpfung.
Schließlich kommen wir nicht umhin, anzuerkennen, dass der Wille des Zeitalters von Reformation und Konfessionalisierung, um die Glaubenswahrheit bis zum Äußersten zu streiten, wesentlich zur Herausbildung des modernen Europas der Differenzierung, kulturellen Vielfalt, Meinungsfreiheit und Sensibilität für die Menschenrechte beigetragen hat, das die „westliche“ Zivilisation vor andern auszeichnet.
Wer das „Werte-Europa“ unserer Tage hochschätzt, darf nicht die Mittel und Wege vergessen, mit denen es sich konkret in einer Zeit der Konflikte und Gegensätze durchsetzte. Geschichte ist ambivalent – in der Zeit von Reformation und Konfessionalisierung nicht anders als heute.
Buchempfehlung
Heinz Schilling: Karl V. Der Kaiser, dem die Welt zerbrach. C. H. Beck-Verlag München, 2020. 457 Seiten, Euro 29,95.
Heinz Schilling
Heinz Schilling ist Professor em. für Geschichte der Frühen Neuzeit und Schriftsteller. Er lebt in Berlin.