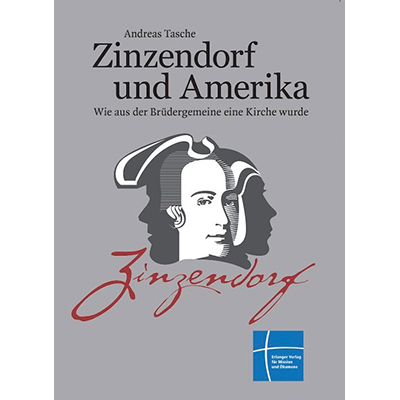Draufgängertum und heiliger Kampf

Das Pilgern hat in der zweitausendjährigen Geschichte des Christentums verschiedene Phasen erlebt. Aber so harmlos touristisch wie heute war es früher meist nicht, meint der Göttinger Kirchenhistoriker Thomas Kaufmann. Er reist in seinem Text durch die Jahrhunderte christlicher Glaubensreisen und Wallfahrten von der Alten Kirche bis zum Vorabend der Reformation.
Spirituell verbrämter Wellness-Körperkult religiöser Leistungssportler ist einer evangelischen Kirche, die sich ihres „Markenkerns“ noch einigermaßen bewusst ist, unwürdig. Rotierte Doktor Martinus in seinem Grab in der Wittenberger Schlosskirche, wenn er des Besucherstroms innewürde, der heute seiner Person gilt? Wie würde der Reformator darüber denken, dass heute frohgemut auf evangelisch gepilgert wird, selbst zu sehr katholischen Orten, legitimiert und flankiert von eigens installierten Wallfahrtssonderpfarrer*innen? Die evangelische Christenheit sollte sich wenigstens dessen bewusst sein, was aus Luthers Sicht gegen das Pilgerwesen seiner Zeit sprach.
Die Attacken, die der aufmüpfige Mönch gegen die Wallfahrten seiner Zeit ritt, reichen in die Frühzeit der Reformation zurück. In seiner Programmschrift An den christlichen Adel deutscher Nation aus dem Sommer 1520 stellte er heraus, dass „walfarten“ nicht an sich „bosze seyn“, dass sie aber „zu disser zeit ubel geratten“ wären. In Rom etwa – und hier stehen die Erinnerungen an die zum Teil wie eine Wallfahrt durchgeführte Romreise des jungen Ordensbruders (1511/12) im Hintergrund – treffe man auf „kein gut exempel sondern eytel ergernisz“.
Ohne dass er dies im Einzelnen ausführte, war klar, was Luther meinte: Eine quantifizierte Leistungsfrömmigkeit, die bestimmte Programmpunkte möglichst schnell und in kalter Routine abriss: So und so viele Ave Maria an den Altären von Santa Maria Maggiore, diese oder jede Menge Vaterunser in Sant Giovanni in Laterno und an den anderen der sieben Kirchen Roms, dann rasch in die Katakomben und schließlich flugs auf den Knien die Scala Santa hinauf. Pilgern als religiöser Zehnkampf in verschiedenen sakralen Stadien der Ewigen Stadt, mit festem Blick auf Heilseffekte für die Ewigkeit – das ist die Praxis, die der junge Mönch übte und der Reformator verachtete.Mit Pilgern für das Heil konnten, so stand Luther vor Augen, soziale Kollateralschäden einhergehen. Anstatt ihren Nächsten zu dienen, ließen Männer ihre Familien allein und brachten Geld durch, das daheim fehlte und dringend gebraucht wurde – wenn das nicht „ein lautter furwitz odder teuffels verfurung“ ist! Durch Wallfahrten konnten Menschen aus ihren sozialen Kontexten fallen und verarmen; oft vertauschten sie den Pilger- mit dem Bettelstab oder schlugen sich schließlich als Räuber und Kriminelle durch – vom Pilgerweg stracks auf die schiefe Bahn. Wer sich durch ein Gelübde an eine Wallfahrt gebunden fühle, so Luther, solle seinen Pfarrer aufsuchen und ihm die Gründe darlegen. Ein fürsorglicher Hirte werde seinem Schäfchen erklären, dass verantwortungsvolle Lebensgestaltung, Arbeit, das Bleibe-im-Land-und-nähre-dich-Redlich tausendmal gottgefälliger seien als der eskapistische Heilstrip ins Ungewisse. Die Absage der Reformation an „heilige“ Orte und an Religionstourismus aller Art ging mit einer religiösen Heiligung des Alltags, der Arbeit, des Standes, der Ehe und Familie, der Nahen und Nächsten, der eigenen Pfarrkirche und der Heilsgaben Wort und Sakrament dort, wohin Gott mich gestellt hat, einher – das unspektakuläre, verantwortungsbewusste Leben eines Christenmenschen im Horizont einer an den Zehn Geboten orientierten Ethik.
Die historischen Umstände, unter denen Rom als Wallfahrtsort quasi erfunden worden war, standen Luther ziemlich deutlich vor Augen: Es seien „die Bepste mit yhren falschen ertichten nerrischen gulden jaren“ gewesen, wusste er. In der Tat: Aus Anlass des runden Jahrhundertdatums 1300 hatte Papst Bonifatius VIII. – allein seiner gigantisch-phallischen Tiara wegen ein Lieblingspapst aller anständigen Kirchenhistoriker*innen! – die tolle Idee eines Goldenen oder Jubeljahres. Es bot denjenigen, die binnen dieses „heiligen“ Jahres als Pilger in die „heilige“ Stadt reisten, die volle Sündenvergebung an, also einen sogenannten Plenarablass. Sollte ihnen auf der Reise nach Rom Unbill widerfahren, sie gar zu Tode kommen – der Heilseffekt als ganzer war ihnen gleichwohl gewiss.
Durch diese produktive und einträgliche Idee rückte Rom als heilstouristischer Wallfahrtsort in jene Liga auf, in der seit dem 11. Jahrhundert zwei Orte gespielt hatten: Santiago de Compostela, der legendarische Grabesort des Herrenbruders Jakobus, und Jerusalem, die Stätte der realen Passion des Jesus von Nazareth. Natürlich hatte es schon früher, vermutlich seit dem 3. Jahrhundert, Reisen nach Rom, den Ort der wirklichen oder vermeintlichen Martyrien der bedeutendsten und miteinander streitenden Apostel, Peter und Paul, gegeben. Denn Besuche an den Gräbern der als Heilige verehrten Blutzeugen waren bereits seit dem späteren zweiten Jahrhundert üblich. Und auch inbrünstige Verehrung ihrer sterblichen Überreste, der Reliquien, war lange bekannt und zum Anlass von Pilgerreisen geworden, freilich meist aus der näheren Umgebung eines Märtyrergrabes. Mit dem ersten Jubelablass 1300 aber rückte das Papsttum und der Mann mit dem großen Hut unübersehbar in den Fokus der religiösen Devotion der lateineuropäischen Christenheit ein.
Beförderter Wallfahrtsboom
Wie das Judentum und die allgemeine Religionsgeschichte kannten auch die christliche Spätantike und das frühe Mittelalter individuelle oder kollektive Besuche von Kultorten außerhalb der eigenen heimischen Umgebung. In konstantinischer Zeit, also jener Epoche, in der das Christentum zur dominierenden und zuletzt quasi einzigen Religion des Imperium Romanum aufgestiegen war, trieb es Asket*innen aus der römischen Aristokratie scharenweise nach Palästina und an „heilige“ Orte wie Bethlehem, Nazareth, das Galiläische Meer oder Jerusalem. Der spektakuläre Fund des Kreuzes Jesu durch die Kaiserinmutter und Pilgerin Helena beförderte einen Wallfahrtsboom und die Ansiedelung monastischer Zentren im „Heiligen Land“, wie es allerdings erst seit der Zeit der Kreuzzüge hieß.
Die tolle Idee, Romreisenden seit 1300 zu den Jahrhundertwenden – und dann bald alle 50, alle 25 oder, nach dem Lebensalter Jesu, alle 33 Jahre einen Plenarablass, also volle Vergebung aller Sünden – plena remissio omnium peccatorum; perdono completo di tutti i peccati– zu gewähren, war von einer anderen papsttums-, wallfahrts- und kirchengeschichtlich epochalen Weichenstellung beeinflusst: Der Gewährung der vollen Vergebung aller Sünden für die Teilnahme an der bewaffneten Pilgerreise nach Jerusalem, die Papst Urban II. 1095 auf einer Synode im französischen Clermont verkündet hatte.In den Jahren zuvor war der immer beliebter gewordene Pilgerzug nach Jerusalem durch die Dominanz der Seldschuken ernsthaft behindert worden. Nun bot der Papst den Rittern ein unglaubliches Aktionspaket zur militärischen Bewährung und heiligmäßigen Erhöhung an: Auf Kreuzzügen gottlose Heiden morden, die Großreliquie Jerusalem zurückerobern, was 1099 gelang, und durch entsprechende Sicherungssysteme den Zustrom weiterer frommer Pilger aus dem Westen schützen. Mit den Ritterorden war ein neuer, zeitgemäßer religiöser Lebensstil geschaffen, der konstitutiv mit Pilgerschaft, Mobilität, Draufgängertum und heiligem Kampf verbunden war.
Als weiterer religiöser Impuls des Pilgerwesens kann das Motiv gelten, die Fremdheit der Christen in der Welt (Hebräer 13,14) und die Wanderexistenz Jesu und seiner Jünger in eine asketische Praxis umzusetzen. Er wurde vornehmlich in monastischen Kreisen praktiziert. Iroschottische Mönche um Kolumban von Iona brachen im 6. Jahrhundert von ihrer Heimat auf, um sich um Christi willen freiwillig in das Exil der peregrinatores, der Pilger, zu begeben.
Die Folgen, die diese peregrinatio propter Christum (Pilgerschaft um Christi willen) genannte asketische Übung für das abendländische Christentum im Ganzen hatte, sind kaum zu überschätzen. Denn die Iroschotten brachten eine individuelle Bußpraxis mit, die vorsah, dass alle Vergehen einem Geistlichen gebeichtet werden mussten. Die Vergebung der Sünden erfolgte aufgrund präzis tarifierter Kompensationsleistungen. Diese bestanden in der Regel in Tagen verschärfter Buße (Nahrungs-, Sexualaskese et cetera) – für eine Lüge vielleicht vierzig Tage (eine sogenannte Quadragene), für einen Ehebruch acht Quadragenen et cetera. Bei einer entsprechenden Lebensführung konnten sich Tage zu Wochen, Wochen zu Monaten, Monate zu Jahren und Jahrzehnten verschärfter Buße auswachsen.
Doch was wird eigentlich aus mir, wenn ich die Bußzeiten, die ich angehäuft habe, gar nicht mehr abbüßen kann? Ist die Hölle dann nicht unvermeidlich? Erst die Erfindung und Systematisierung des Fegefeuers (purgatorium) seit dem 12. Jahrhundert schuf hier eine Entlastung. Denn es diente der Läuterung. Die Dauer, die ich dort zubringen werde, entspricht der Länge der offenen Rechnungen an verschärfter Buße, die ich nicht beglichen habe. Eigentlich eine faire Sache – die purgatorische „Ehrenrunde“, um das Klassenziel, die ewige Seligkeit, doch noch zu erreichen. Aber natürlich eine ziemlich unbehagliche Vorstellung – ein Leiden, Schmachten und Vegetieren, das die Dichter und Künstler seit dem 13. Jahrhundert auszumalen liebten.
Hier schuf nun der gute alte Ablass die definitive Abhilfe. Denn er verkürzte die Fegefeuerpein. Und da man ja nie wissen kann, wie viel wirklich noch offen ist, da man ja die eine oder andere Sünde vergessen haben wird, ist es gewiss das Beste, einen vollständigen Ablass, nicht nur die läppischen vierzig Tage hier, an diesem Altar, und weitere vierzig Tage dort, vor jenem Heiligenbildchen, zu erwerben.
Heilsgeschichtlicher Betriebsausflug
Plenarablässe aber kann nur der Papst gewähren. Seiner wurde man zunächst nur durch die Teilnahme am Kreuzzug habhaft, später auch durch die finanzielle Unterstützung der Kreuzfahrer, in den Jubeljahren und dann im späten Mittelalter durch Kampagnen, in denen ein vom Papst legitimierter Tross geistlicher Funktionäre durch bestimmte Gebiete zog und ihn anbot. Auch an diese Orte musste man pilgern. Pilgerboom und allgegenwärtiger, allerwünschter Ablass verstärkten einander wechselseitig.
Im 15. und 16. Jahrhundert entstanden im Deutschen Reich neue, kleinere Pilgerorte in der näheren Umgebung. Sie dokumentierten, dass Gott hier und jetzt wunderwirkend in die Geschichte eingreift. Interessant waren diese soteriologischen Naherholungsgebiete für all jene Menschen, für die nur ein heilstouristischer Betriebsausflug, keine Weltreise zu den Hotspots Santiago, Rom und Jerusalem in Betracht kam. Diese näheren Wallfahrten waren Teil einer religiösen Eventkultur, deren Bedeutung für Luther und die Reformation kaum zu überschätzen ist. Denn auch der sächsische Kurfürst Friedrich baute den Ort eines Pilgerevents aus: Wittenberg. Zwei Mal im Jahr, an Quasimodogeniti und Allerheiligen, konnte man an der Schlosskirche zu Wittenberg bei Betrachtung exquisiter Reliquien aus einer zügig auf etwa 19 000 Stücke angewachsenen Reliquiensammlung Ablässe erhalten, die sich in toto auf mehrere Millionen Jahre verkürzter Fegefeuerpein summierten. In Halle/Saale entstand ein ähnlicher Pilgerort. Erzbischof Albrecht von Magdeburg und Mainz aus der brandenburgischen Konkurrenzdynastie der sächsischen Wettiner baute ihn auf.
Einige der neu entstandenen Wallfahrtsorte hatten einen judenfeindlichen Hintergrund. Im mecklenburgischen Sternberg war dies der Fall; ein angeblicher jüdischer Hostienfrevel, den der geschmähte Christengott durch wunderbare Blutflüsse aufgedeckt hatte, führte zu einem Pogrom und einer seit den 1490er-Jahren florierenden Wallfahrt. Ähnlich ging es in Regensburg zu, der vielleicht spektakulärsten Wallfahrt unmittelbar vor der Reformation. Ein Steinmetz, der sich bei den Abrissarbeiten der Synagoge verletzt hatte, tauchte am nächsten Tag an der Baustelle auf, was man als ein von Maria gewirktes Wunder verstand und zum Anlass einer Wallfahrt machte. Die jüdische Gemeinde löschte man aus.
Wundertätiges Marienbild
Schon in den 1380er-Jahren war im brandenburgischen Wilsnack die Wallfahrt zu drei Blutwunderhostien entstanden. Im letzten Drittel des 15. Jahrhunderts entfaltete sie eine größere Dynamik. In der Mitte des 15. Jahrhunderts stieg Vierzehnheiligen bei Bad Staffelstein im heutigen Landkreis Lichtenfels in Oberfranken zum Wallfahrtszentrum auf; einem Schäfer war das Jesuskind in einer Gruppe von Helfern erschienen, besonders wackeren Heiligen, die als Konsortium frömmigkeitskulturell reüssierten. Seit 1498 wurde ein wundertätiges Marienbild im thüringischen Grimmenthal zum Ziel einer der Buße oder der Danksagung dienenden Wallfahrt. Auch heilige, wunderwirkende Textilien begründeten Pilgerschaften: In der Aachener Pfalzkapelle Karls des Großen zogen das Kleid Mariens, die Windeln und der Lendenschurz Jesu und ein blutgetränktes Tuch vom Kopf Johannes des Täufers Menschenmassen an, im Trierer Dom der Heilige Rock.
Der Buchdruck beförderte das Pilgerwesen, denn er ermöglichte eine Verbreitung von Werbemitteln, die anlockten, indem sie die Heilsangebote anpriesen und von den am „heiligen“ Ort geschehenen Wundern berichteten. Pilgerzeichen erinnerten, dokumentierten und bewiesen den Besuch eines heiligen Ortes und halfen mit, seine Aura zu verbreiten. Präzise Buchführungen an einigen Pilgerorten dokumentieren, dass die Besucherzahlen bisweilen in die Hunderttausende gingen. Im Zusammenhang der Pilgerschaft gab es immerzu Ablässe; sie waren das religiöse Betriebssystem des Wallfahrtsapparates. Martin Luthers Aversionen gegen die Pilgerfahrten hatten tiefe theologische Gründe.
Wanderungen in Gottes schöner Schöpfung, mit christlichen Liedern auf den Lippen, Gebeten und Gemeinschaftserfahrungen, Besuchen in Herbergen, Kapellen und Klöstern, von denen manche sogar evangelisch sein mögen, geistliche und körperliche Wege, die ihr Ziel in sich selbst und im Nächsten finden und nicht in der vermeintlichen Heiligkeit eines Ortes – denn „heilige“ Orte kann es für evangelische Christenmenschen nicht geben! –, gegen all das muss man nichts haben. Dies freilich „Pilgern“ zu nennen, ist vor dem Hintergrund dessen, was man darunter gemeinhin versteht und in der Geschichte des Christentums verstanden hat, gelinde gesagt sehr irreführend. „Hafer-“ oder „Erbsen-Milch“ sind ja auch keine Milch.
Thomas Kaufmann
Thomas Kaufmann ist Professor für Kirchengeschichte an der Universität Göttingen