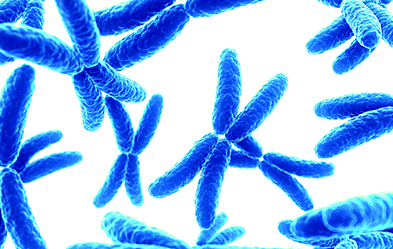
Genderforschung, wie sie an Universitären oder eigenständigen Instituten betrieben wird, ist nicht per se einer bestimmten Gendertheorie verpflichtet. Das widerspräche bereits im Ansatz dem Prinzip der Freiheit von Forschung und Lehre. Faktisch jedoch ist die durchweg konstruktivistische Grundlegung der Gender Studies nicht zu übersehen und wird von ihren Protagonisten auch gar nicht bestritten. Es scheint einen praktischen Konsens darüber zu geben, dass ein Forschungsgegenstand, in diesem Fall: Gender, vom Betrachter selbst im Vorgang des Erkennens konstruiert wird. Es gibt danach, auch hinsichtlich des Geschlechts, keine dem Erkennen vorausliegende objektive Wahrheit, an der eine auf methodisch kontrolliertem Weg gewonnene Theorie auch scheitern könnte. Alles ist relativ, es kann von daher keinen stabilen, kulturraum-invariablen Kernaspekt im Verstehen von Geschlecht geben.
Dass in der Genderforschung Vielfalt und Besonderheit so stark betont werden, steht in deutlichem Kontrast zur Binnenhomogenität dieses Forschungszweiges, die mit kategorischen Abgrenzungen, vor allem gegenüber den empirisch arbeitenden Naturwissenschaften einhergeht. In einer historisch eher unterkomplexen Betrachtung der Wissenschaftsgeschichte werden die modernen Naturwissenschaften als politisch motivierte Strategien identifiziert, um die Vorherrschaft des Mannes und die Benachteiligung von Frauen mit einem Mantel der Legitimation versehen. In ihren härtesten Urteilen wird den Naturwissenschaften überhaupt bestritten, wahre Aussagen über die Wirklichkeit treffen zu können. Der von anderen gegen die Gender Studies erhobene Ideologieverdacht wird so auf die Naturwissenschaften abgelenkt.
Hinter diesem Urteil steht ein ideologiekritischer Ansatz, der die sozialen Konstitutionsbedingungen naturwissenschaftlichen Arbeitens hervorhebt und geltend macht, dass diese von einer Logik der Weltbemächtigung angetrieben werden. Vor allem im Anschluss an Michel Foucault hebt die Genderforschung den Machtaspekt naturwissenschaftlicher Diskurse hervor. Die Biologie, weithin von Männern betrieben, reproduziere im Gewand objektiver Fachsprache die immer schon vorausgesetzte Normativität der heterosexuellen Zweigeschlechtlichkeit und stabilisiere damit das vorhandene Machtgefälle zwischen Männern und Frauen.
Nun sollte man diesen Vorwurf nicht ungeprüft zurückweisen. Immerhin verdanken wir den Naturwissenschaften, deren Segnungen wir in vielen Bereichen heute ganz selbstverständlich nutzen, auch zerstörerische Technologien und Forschungsleis-tungen, die in direktem Interesse von Rüstung, Rassenhygiene und anderen Übeln standen und stehen. Es ist kaum zu bestreiten, dass alle menschlichen Lebensäußerungen für abgründige Ideologien anfällig sind, also auch die Wissenschaften. Das spricht jedoch eher dafür, dass die verschiedenen Wissenschaften untereinander - und darüber hinaus - im kritischen Gespräch bleiben. Den Ideologie-Vorwurf zum Gesprächsabbruch zu gebrauchen, weckt eher den Verdacht, sich selbst gegen Einsprüche von außen immunisieren zu wollen - vielleicht aus der Befürchtung heraus, dass die eigenen Argumente contra Heteronormativität nicht sonderlich belastbar sind und der konstruktivistische Zugang zu viel (andere Wissenschaft!) ausblenden muss?
Es fällt doch auf: Der ideologiekritische Impetus der Genderforschung wird ausschließlich gegen andere Wissenschaften gerichtet und nicht gleichermaßen gegen die eigene Arbeitsweise. Die Frage, wessen Machtansprüche sich in den Gender- und Queer-Wissenschaften artikulieren, ist nicht von der Hand zu weisen, denn es gibt gesellschaftlich relevante Trägergruppen mit Bezug zu Gender Studies, die sich Netzwerke aufgebaut, Zugang zu Ressourcen gesichert und Einfluss gewonnen haben. Braucht es die Genderforschung als eine Strategie, um gesellschaftspolitische Entwicklungen zu legitimieren, Personen mit Statussymbolen zu versorgen und Ressourcen zu allokieren - also im Prinzip nichts anderes zu tun, als was in den Gender Studies anderen Wissenschaftszweigen gerne vorgeworfen wird? Das hieße dann ja, die kritisierten Muster männlicher Machtabsicherung schlicht zu reproduzieren.
Die hier verborgenen Motivschichten freizulegen, dazu regt allein schon der Blick auf das Zahlenverhältnis von Frauen und Männern im Bereich der Gender Studies an, vor allem auf der Ebene der Professuren. Dass im Bereich Gender Studies von über 220 Genderprofessuren mit einer Voll- oder Teilzeitbeauftragung (Stand 2014) ganze zehn mit Männern besetzt sind, spricht für die mangelnde Fähigkeit oder den fehlenden Willen, diesen jungen, die Relevanz von biologischem Geschlecht bestreitenden Wissenschaftsbereich jenseits konventioneller Selektionsmuster zu gestalten. Hier werden doch einfach - im Sinne des Protests? - die Machtverhältnisse umgekehrt: Männer müssen draußen bleiben. Einer politischen Bewegung wäre das durchaus angemessen, aber lässt sich auf solche Weise seriöse Wissenschaft organisieren? Überhaupt will nicht recht einleuchten, warum Ausschreibungen für Professuren in Gender Studies den - nur unter Maßgabe biologischer Zweigeschlechtlichkeit sinnvollen - Vermerk tragen, dass Frauen zur Bewerbung ermutigt und bei gleicher Qualifizierung bevorzugt werden. Entweder ist damit nun doch eine biologische Kategorie bezeichnet - oder Texter und Leser bewegen sich nicht mehr in einem gemeinsamen Sprachkosmos. Wie man es dreht und wendet: Unter ideologiekritischen Gesichtspunkten muss doch ein Fachbereich, dem es gelingt, sich nahezu ausschließlich aus einem Pool von Frauen zu ergänzen, genauso misstrauisch machen wie Fachbereiche, in denen Männer - wie schon der in die Jahre gekommene Feminismus monierte - unter sich bleiben.
Doch es geht hier nicht allein um die Frage, wie eine Forschungsdisziplin sich organisiert. Es geht darum, wie sich weltanschauliche Überzeugungen, überprüfbare Forschung und politische Praxis zueinander verhalten. So vertreten Foucault und jene, die ihm folgen, einen dezidierten Werte- und Wahrheitsrelativismus . Anders gesagt: Wahr und Falsch, Gut und Böse sind keine Kategorien der Wirklichkeit, sondern eine Frage des Erkenntnisstandpunkts. Doch zu bestreiten, dass es einen kategorialen Unterschied zwischen Gut und Böse gibt, ist unvereinbar mit der Überzeugung, dass die verschleierten, Männer privilegierenden Machtverhältnisse, die man aufdecken will, durchaus etwas Böses sind. Hier verstrickt sich der Ansatz in einen Selbstwiderspruch.
Ein weiteres Problem tut sich auf, wenn wir den ideologiekritischen Ansatz der Genderforscher bis auf ihren bei Foucault gelegten Grund zurückverfolgen. Während Genderforscher den Biologen, die das Konzept der Zweigeschlechtlichkeit verteidigen, unverhohlen „Biologismus“ vorwerfen, also die Überhöhung von Wissenschaft zur Weltanschauung, bleibt man für die weltanschauliche Imprägnierung der eigenen Forschungen blind. Zwar trifft der Vorwurf, sie würden nicht sauber zwischen Wissenschaft und Weltanschauung unterscheiden, einige Evolutionsbiologen zu Recht. Das rechtfertigt jedoch nicht, nun seitens der Gender-Forscher einen schmalen Ausschnitt der empirisch erforschbaren Wirklichkeit, zum Beispiel das seltene Phänomen der Intersexualität, zu nehmen und die Betroffenen - auf der Basis ihrer biologischen Beschaffenheit(!) - zu Kronzeugen einer Weltanschauung zu machen, der zufolge es nicht zwei, sondern unzählig viele Geschlechter, genauer: Geschlechtsidentitäten, gibt.
Unerlaubter Ebenenwechsel
Doch zwischen Biologie und Biologismus muss unterschieden werden. Der Ablehnung der Biologie durch die Gender Studies liegt, philosophisch gesprochen, ein unerlaubter Ebenenwechsel zugrunde: Häufig - durchaus plausibel - werden die sozialen Entstehungsbedingungen und Folgewirkungen biologischer Erkenntnisse rekonstruiert. In der feministischen Literatur wird etwa darauf hingewiesen, dass die Erforschung der weiblichen Anatomie, die zu Beginn des 19. Jahrhunderts zur Entstehung der Gynäkologie führte, historisch betrachtet zunächst dazu diente, die Unterteilung der Lebenssphären nach Frauen und Männern zu legitimieren, also männlichem Herrschaftserhalt dienstbar gemacht wurde.
Ein unerlaubter Ebenenwechsel liegt aber dann vor, wenn aus der historischen Rekonstruktion bestimmter Entdeckungszusammenhänge darauf geschlossen wird, dass die im problematisierten Zusammenhang gewonnenen Erkenntnisse keinen Anspruch auf Geltung (mehr) haben. Das kann dann zum Beispiel bedeuten, dass ernsthaft an Geburtsvorbereitungskursen kritisiert wird, sie würden schon von ihrer Anlage her Geschlechterdifferenzen hervorheben und mit ihrer Konzentration auf Vorgänge der Schwangerschaft, Geburt und Mutter-Kind-Beziehung der Naturalisierung von Geschlecht und Geschlechterstereotypen Vorschub leisten. Nach dieser Logik ließen sich die Gesetze der Atomphysik mit dem Hinweis in Abrede stellen, dass wir ihre Entdeckung überwiegend männlichen Physikern verdanken, die bereit waren, ihre Forschungen für militärische Zwecke zur Verfügung zu stellen. Wenn wir die sozialen Entstehungsbedingungen naturwissenschaftlicher Entdeckungen analysieren, dann haben wir damit (hoffentlich zutreffend) die äußeren Gründe erhellt, die diese Entdeckung ermöglichten. Doch mit dieser Analyse ist kein (zwingendes) Urteil über den inneren Grund verbunden, das heißt den Wahrheitsgehalt der behaupteten Entdeckung.
Richtig ist: Die Biologie vermag uns Wichtiges, aber nicht alles zu sagen, was über den Menschen zu sagen ist. In verschiedenen geschichtlichen Epochen sind aus unterschiedlichen Perspektiven Aussagen zur Herkunft des Menschen getroffen worden. Dabei stehen religiöse, philosophische und naturwissenschaftliche Erzählungen nebeneinander. Was die naturwissenschaftliche Erzählung angeht, werden wir jedoch nicht hinter die Einsicht zurückfallen können, dass die natürliche Zeugung ein Vorgang ist, der wesenhaft durch die heterosexuelle Zweigeschlechtlichkeit des Menschen ermöglicht ist.
Die Heteronormativität im Vorgang der Weitergabe des Lebens bleibt der blinde Fleck der Gender Studies. Damit ist nicht gesagt, dass Fortpflanzung und Familienverhältnisse nicht thematisiert werden. Das Interesse dabei ist aber erkennbar politischer Natur. Danach sind biologische Abstammungsverhältnisse ein Modus, Verwandtschaftsverhältnisse zu konstruieren, der jedoch keinen Vorzug vor anderen, sozialen Formen der Verwandtschaft verdiene. Gender Studies wollen dem Ziel einer diskriminierungsfreien Gesellschaft zuarbeiten, in der alle Familienformen gleich behandelt werden.
Das irritiert gleich in mehrfacher Hinsicht. Zum einen liegt der Identifizierung von Diskriminierungen ein wenig anspruchsvolles Gleichheitsverständnis zugrunde: „Werden alle gleichbehandelt, wird niemand diskriminiert“ - was offenkundig Unsinn ist, dafür genügt es, einem Rollstuhlfahrer zu begegnen, der in einen Zug einsteigen will. Bei genauerer Betrachtung irritiert auch, warum nach dem Ausschluss der Biologie aus dem Verständnis von Geschlecht diese doch wieder eine so starke Rolle spielt, wenn für die Vielfalt der Lebensformen Gleichbehandlung eingefordert wird. Obwohl etwa gleichgeschlechtliche Paare natürlicherweise miteinander keine eigenen Kinder haben können, bleibt die biologische Abstammung das Ideal, dem man möglichst nahekommen möchte, weshalb Gleichbehandlung den Zugang zu Samen- und Eizellspende sowie Leihmutterschaft einschließen soll (was innerhalb des Feminismus wiederum strittig ist). Wären biologische Herkunftsverhältnisse wirklich so belanglos, wie man es in den einschlägigen Gender-Publikationen lesen kann, entfiele jeder Grund, für bestimmte Gruppen auf dem Zugang zu Reproduktionstechnologien zu bestehen.
Wenn ich einen Wunsch an die Genderforschung formulieren dürfte, dann wäre es dieser: Wäre es nicht lohnend, möglichst interdisziplinär zu erforschen, welche Geschichte ihrer Mutterbeziehung Genderforscher(innen) in ihre Wirklichkeitskonstruktionen einbringen? Ich konnte dazu trotz intensiver Recherchen nichts finden. Es wäre doch ungemein spannend, besser zu verstehen, was Genderforscherinnen biographisch in einem sensiblen Entwicklungsbereich geprägt hat. In postmodernen Erkenntnistheorien ist das Wissen um die eigene Perspektivität bekanntlich sehr wichtig. Vielleicht könnten die gewonnenen Erkenntnisse dazu beitragen, einander selbstkritischer, verständnisvoller und ehrlicher zu begegnen.
Literatur
Christoph Raedel: Gender - Vom Gender Mainstreaming zur Akzeptanz sexueller Vielfalt. Brunnen Verlag, Gießen 2017, 240 Seiten, Euro 20,-.
Christoph Raedel
