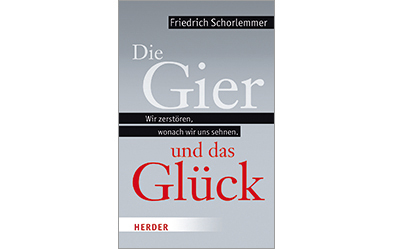
Für den Theologen Friedrich Schorlemmer gehören "Glück und Gier" ebenso zusammen wie "Glück oder Gier". In dieser Dialektik spürt er in 24 essay-haften Abschnitten dem Sinn des Lebens nach. Mit brillanten Wortspielen und klarsichtiger Sprache, die eine wahre Leselust hervorrufen, versucht er Schritt für Schritt zwischen den Extremen die Lebenskunst Glück zu beschreiben. "Glücklich ist nach meiner Auffassung, wer das Intensive und das Extensive als ein Gleichgewicht zu leben vermag" oder "Das Karge schätzen, aber nie das Schöne entbehren... Das Bescheidene bevorzugen, ohne das Genießende zu unterlassen." Wie aber gelingt dies in einer Gesellschaft, die Mehr-haben-Wollen mit Glück verwechselt?
Schorlemmer appelliert an die Willensfreiheit des Individuums, kluges Maßhalten zu verwirklichen. Und er unterstreicht dies mit einer Unmenge von Zitaten (weniger wäre mehr gewesen) aus der Bibel, von Kirchenvätern, Philosophen, Schriftstellern und Künstlern, die alle hilfreich sein mögen, aber nur für ein bestimmtes Bildungsbürgertum ausgewählt wurden. Hier ist der Autor mehr Prediger denn Gesellschaftsanalytiker. Sonst hätte er auch die Ergebnisse der Glücksforschung aufgegriffen, die weiter reichen, als es uns seine Ausführungen zeigen. So mangelt es an einer genauen Begriffsbestimmung von "Gier". In der Psychologie wird eindeutig zwischen "Begehren" und "Begierde" unterschieden, der Schorlemmer nicht folgt, obwohl er intuitiv selbst die Unsicherheit spürt, wenn er schreibt: "Es gibt auch ein Begehren (eine Gier?) nach Reinheit, die in jedem Fall unerfüllt bleiben muss."
Unbefriedigend bleibt, dass der Autor zwar die "Weltrevolution" mit neuen Kriterien für eine gerechte Finanz- und Wirtschaftsordnung fordert, aber nicht über schon bekannte Kriterien berichtet, die die "Transformation der Geld- und Eigentumsordnung" beinhalten, die zum Beispiel Ulrich Duchrow vorgelegt hat. Dies überrascht insofern, da Schorlemmer zwar Duchrow zitiert, aber nicht dessen Kriterien rezipiert. Vielleicht liegt dies daran, dass Schorlemmer nur das Individuum im Blick hat, nicht aber die Wechselwirkung, die zwischen kapitalzentrierter Wirtschaft und menschlicher Psyche besteht. Dennoch zweifelt er selbst an dieser Weltveränderung durch Selbstveränderung, wenn er abschließend schreibt: "Weil wir uns nicht ändern werden, müssen wir eine so gelassene wie exakt vorgehende Praxis entwickeln, welche die große Katastrophe verhindert, ohne an die Grundsubstanz des menschlichen Irrstrebens gehen zu wollen." Ob aber diese Praxis so aussehen wird, bleibt eine offene Frage, die mehr Skepsis als Optimismus beim Rezensenten auslöste.
Friedrich Schorlemmer: Die Gier und das Glück. Herder-Verlag, Freiburg i. Br. 2014, 176 Seiten, Euro 14,-.
Christoph Körner
