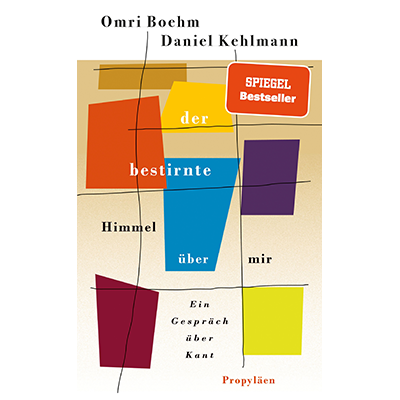Gehört der scharfe Gegensatz zum Judentum zur DNA des Christentums? Am Ende seines Durchgangs durch neutestamentliche und frühchristliche Schriften konstatiert Klaus Wengst: Falls es so wäre, dann hätte Letzteres einen Geburtsfehler, der sich kaum beheben ließe.
Doch Vorsicht bei der Wortwahl. Denn Wengst zeigt auf: Die meisten jener Schriften sind im jüdischen Kontext entstanden und zu verstehen. Und von einem eigenständigen Christentum kann vor dem zweiten Jahrhundert nicht gesprochen werden.
Der Autor rekonstruiert Gruppierungen messiasgläubiger Juden, zu denen zuerst Gottesfürchtige stießen. Gleichwohl beobachtet er ab dem jüdisch-römischen Krieg deren zunehmende Entfremdung von der jüdischen Mehrheit. Die schwerwiegendste liegt wohl – bis heute – in der Perspektive auf Jesus von Nazareth.
Den Gekreuzigten als Messias, gar als den alleinigen Messias, oder hellenistisch vergöttlicht zu glauben und zu denken: Darin liegt eine geschichtliche wie auch dogmatische Differenz. So empfiehlt Wengst den Christen, auf Absolutheitsansprüche zu verzichten. Denn der historische Jude Jesus habe keinerlei Einzigartigkeit gehabt. Besonders mache ihn allein das Handeln Gottes an ihm nach seinem Tod, so wie es Jüdinnen und Juden infolge eines bestimmten Sehens glaubten und als Gegenwart eines Lebendigen erlebten.
Auch wer dieser Prämisse nicht folgen mag, wird das konsistent und klar, zwar ohne Fußnoten geschriebene, aber fachlich fordernde Buch mit Gewinn lesen. Maßstab der Schriftenkritik von Wengst ist das Verhältnis der Verfasser zum Jüdischen. Paulus oder das lukanische Werk bieten für ihn Brücken der Verständigung, da hier die Völker zum Volk Israel hinzukommen und beiden die Verheißung gilt.
Im spätdatierten Kolosserbrief dagegen sieht er den Israel-Bezug aus dem Blick geraten. Im Clemensbrief erkennt er eine Beerbung Israels als Enterbung. Über den Verfasser des Barnabasbriefs ist er ehrlich empört, da dieser Jüdisches verzerrt darstellt. Und in der Apostellehre (Didache) findet er „eine gewisse Ironie“ in der Kontrastierung von jüdischem Achtzehngebet und dem „durch und durch jüdischen Vaterunser“.
Immer hat Wengst die Sozialgeschichte im Blick. Deutlich präferiert er eine Sicht von unten. Mit Sympathie beschreibt er die Widerständigkeit der Offenbarung des Johannes. Sie enthülle „die Grausamkeit imperialer Gewalt“ und symbolisiere „die Hoffnung auf endlich humanes Regieren.“ Auch die „Menschen in den Jesusgemeinden“ des 1. Petrusbriefs seien keine „Mitläufer“ und übten Distanz zur Macht. Den Geist des Clemensbriefs, dem „am Messianischen nichts liegt“, kritisiert Wengst dagegen als Unterwerfungsideologie unter die Pax Romana.
Im Vorwort kündigt der Autor an, er verfolge in seinem Buch mehr als ein historisches Interesse. Am Schluss fragt er auf zehn Seiten: „Was nun?“ Die Konsequenzen fallen eher vorsichtig aus. Denn der Bruch zwischen Judentum und Christentum sei nicht revidierbar. Gleichwohl sei die Gegnerschaft zwischen Christentum und Judentum nicht „essenziell“, der „Geburtsfehler“ mithin behebbar. Am hinderlichsten für eine Annäherung bleiben wohl die Kennzeichnung Jesu als einziger Messias und die griechisch-philosophische Ausformung von Gotteslehre, Christologie und Trinitätslehre. Das wechselseitige Interesse an religiösen Riten und Praktiken zu wecken, erscheint dagegen leicht.
Es ist exegetischer Standard, dass jüdische Schriften nicht nur und exklusiv auf Jesus hin auszulegen sind. Kein Standard ist der praktische Vorschlag, tatsächlich „mit Jüdinnen und Juden gemeinsam die Bibel zu lesen und so miteinander und voneinander zu lernen“. Wengst endet mit der Aussicht auf ein Gespräch, in dem „es keinen Schlusspunkt geben“ wird.
Sebastian Kranich
Sebastian Kranich ist Direktor der Evangelischen Akademie Thüringen.