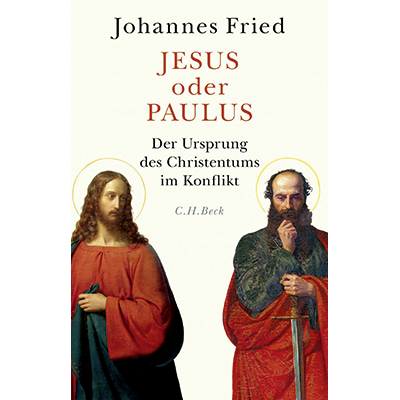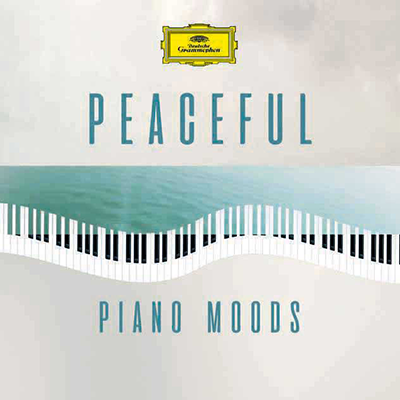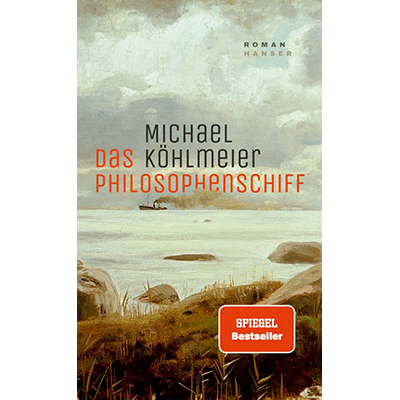Diesmal ist es also ein renommierter Historiker, wissenschaftlich zu Hause im Mittelalter und ausgezeichnet durch hohe Preise, der eine alternative Geschichte Jesu und der frühen Kirche entwirft. Wenn man die biblische Vorstellung einer Auferstehung des Gekreuzigten für unvorstellbaren Unsinn hält, gibt es ja im Grunde nur zwei Möglichkeiten. Entweder ist der Leichnam von den Jüngern versteckt worden (so etwa Reimarus) oder Jesus ist gar nicht gestorben, schien nur irgendwie tot zu sein und hat munter weitergelebt. Das ist der für Fried nicht ernsthaft bezweifelbare Ausgangspunkt aller seiner Überlegungen.
Diese Sicherheit kommt aus der Kombination zweier ihm „zugespielter“ Möglichkeiten. Da ist zum einen die moderne medizinische These, wonach Jesus am Kreuz durch einen massiven Pleuraerguss in eine todesähnliche Ohnmacht fiel und dann durch den Lanzenstich zufällig eine rettende Punktation erhielt. Dem liegt der Passionsbericht des Johannesevangeliums zu Grunde, und der wiederum wird zum anderen als Augenzeugenbericht des sogenannten Lieblingsjüngers betrachtet. Beide Fälle wird man zunächst für möglich halten.
Problematisch wird es, wenn Fried davon als unbezweifelbar ausgehend mögliche Folgen erfindet: Der „Grabflüchtling“ muss sich verbergen und hat danach noch lange an verschiedenen Orten im Ostjordanland und in Ägypten weitergelebt. Für diese Fortexistenz gibt es keine Quellen; und die jeweils behaupteten „Spuren“ geben das Erwünschte nicht her. Mit seiner Erdichtung bewegt er sich auf den Spuren der ersten romanhaften Leben-Jesu-Darstellungen.
Das alles steht schon in seinem ersten Buch "Kein Tod auf Golgatha. Auf der Suche nach dem überlebenden Jesus" (siehe zz 4/2019). Es war wohl die heftige Kritik an seinem Vorgehen, die ihn zu dem zweiten Buch veranlasst hat. „Es rekapituliert und schärft die wichtigsten Argumente, um dann den harten Konflikten innerhalb der frühen Jesus-Bewegung und ihren langfristigen Konsequenzen“ nachzugehen.
Es ist ein nicht untypisches Vorgehen in der Geisteswissenschaft, eine neue Sicht zunächst für einen begrenzten Bereich zu gewinnen, um dann mögliche Folgerungen nur noch zu skizzieren. Gerade dabei aber zeigt sich, wie weit man diese Gebiete und den aktuellen Stand ihrer Erforschung beherrscht. Nicht zuletzt weil Fried den Anspruch erhebt, als Erster überhaupt mit den Mitteln der Geschichtswissenschaft die objektive „Wahrheit“ statt der kirchlichen Lehre entdeckt zu haben – und das nach dreihundert Jahren historisch-kritischer Bibelwissenschaft! –, muss man ihn an diesem Anspruch auch messen. Und der zielt auf das Ganze des Urchristentums und der frühen Kirche. Dabei zeigt sich, dass Fried an keiner einzigen Stelle selbstständig gearbeitet hat, keinen der vielen Texte wirklich kennt, sondern stets ihm passend erscheinende Thesen ohne Einsicht in Problematik, Alternativen und den Stand der Diskussion herausgreift, sich daraus ein Bild zimmert und dieses dann zur historischen Wahrheit erklärt.
Natürlich kann er Paulus und seine Theologie nicht von diesem Scheintod her verstehen. Ihm schreibt er ein singuläres „Visionserlebnis“, „eine intime psychische Erfahrung“ zu, woraus eine Theologie erwuchs, die Fried im Hymnus von Philipper 2 zusammengefasst sieht und in der kein Platz ist für „undurchschaubare Erinnerungen“ vieler Zeuginnen (1.Korinther 15,3–8). Dazu kommt, dass diese Erfahrung von Auferstehung alle kanonischen Evangelien und letztlich die Kirchenlehre prägt, also „Erfolg“ gehabt hat. Sogar die Jünger, die dem Scheintoten halfen und begegneten, mussten dies als „Erscheinen des endzeitlichen Messias“ ausgeben.
Doch nicht diese Linie beherrscht das Buch, sondern der angebliche Konflikt zwischen den beiden differenten Erfahrungen des Aufgestandenen. Und hier liegt eines der beiden großen Probleme des Buches. Denn dass die Konflikte, von denen das Neue Testament erzählt, und die dann ihre Fortsetzung in späteren Quellen finden, auf diese Differenz zurückgehen, kann nicht wahrscheinlich gemacht werden. Insbesondere die unterschiedlichen Weisen des Umgangs mit den hinzukommenden Menschen aus den Völkern durch Paulus, Petrus und den Herrenbruder Jakobus lassen sich nicht auf differentes Wissen um den Nicht-Tod zurückführen. Auch das häufige Reden vom angeblichen „Schweigen“ mal der einen, mal der anderen Seite hilft da nicht weiter.
Der zweite Punkt, der fast durchgängig kritisch auffällt, betrifft die Sprache, die verwendete theologische Begrifflichkeit. Es ist die einer vergangenen theologischen Generation, wenn Fried immer wieder von „Heiden“ spricht, von einem Gegensatz von Messias, Christus und Gottes-Sohn, vom „späten Judentum“ oder davon, dass Paulus einen „neuen Gott“ verkünde. Darin zeigt sich unübersehbar, dass die neuere Forschung (man denke nur an das veränderte Paulusbild) samt allen ihren Konflikten auf einem so anderen Fundament steht, dass hier kein Beitrag zu ihr vorliegt.
Frank Crüsemann
Dr. Frank Crüsemann ist emeritierter Professor für Altes Testament. Er lebt in Bielefeld.