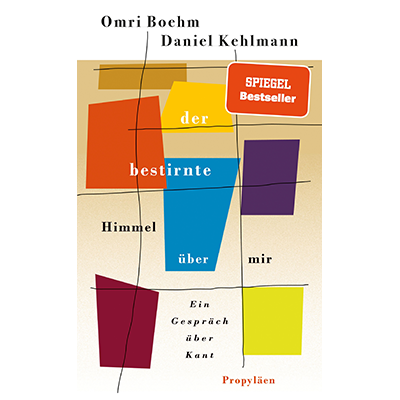Welcher Tod ist schon schön? Der durch Hitze sicher auch nicht. 1921 plagt die Schweiz ein Hitzesommer, in Genf sind es Ende Juli 38,3 Grad, ein Rekord – für den Schriftsteller Charles Ferdinand Ramuz Anstoß zum Roman Présence de la Mort (Gegenwart des Todes), der 1922 erscheint, kaum Leser findet und auch nicht ins Deutsche übersetzt wird. In einer herrlichen Edition hat das nun Steven Wyss nachgeholt, mit der Fassung von 1941 als Grundlage und einem Titel, den er in Ramuz’ Notizen fand: „La terre qui retombe au soleil“. Ein andrer wäre „La fin du monde“ gewesen, das Ende der Welt. Auf die Mega-Aktualität des Romans ist außer AfD- und ähnlich Gesonnenen heute niemand mehr eigens hinzuweisen. Und er ist ein literarisches Juwel.
Auslöser der Katastrophe ist darin nicht der Mensch. Zu Beginn verbreitet sich von Kontinent zu Kontinent evangeliumsgleich „die große Nachricht“: Die Erde stürze durch einen Unfall im Gravitationssystem schnell in die Sonne, „um darin zu zerschmelzen. Alles Leben wird enden“. Zeitungen verbreiten die Botschaft. „Gehört, allerdings, wurde sie nicht.“ Stattdessen Stille, denn „noch sieht man nichts“. Hier beginnt Ramuz zu erzählen, wie die Menschen um den Genfer See auf die Monate anhaltende Hitze und extreme Trockenheit reagieren. Ein wenig litte man zwar schon, aber noch war‘s auszuhalten. Es geht ja Wind, heiß zwar, doch dafür werde der Wein bestimmt gut. Man badet im See – und empfindet die Meldungen als übertrieben.
Der öfters auftauchende Ich-Erzähler schildert Situationen in einer Bäckerei – Gleichgültigkeit, Belächeln. Er erzählt vom Meister auf dem Bauernhof, der die Zeitung beiseitelegt: „Er hat es nicht verstanden, es ist zu groß. Das ist nicht für uns. Unsere Welt ist so klein. Unsere Welt geht so weit, wie unser Auge reicht; die Unruhe verschwindet wieder.“ Lebensecht imaginierte Szenen und Figuren ergeben einen faszinierend allzu menschlichen Reigen mit tödlichem Gefälle. Es sind Aperçus, Anekdoten, Episoden. Und „die große Nachricht“ wird mehr und mehr zur Realität. Das Sterben beginnt. Gletscher schmelzen, und der See bleibt trügerisch Zuversicht. Die Ordnung zerfällt, es gibt Plünderungen und Morde, in der Summe einsam-individuelle Tode, deren letale Körperakrobatik aber immer ähnlich ist. Endlich stellt sich die lange geforderte Gleichheit ein, im Sterben. Manche nennen das Unausweichliche beim Namen und provozieren Gegenrede: „‚Schweigen Sie, habe ich gesagt!‘ Mit böser Stimme, wie jemand, der Angst hat.“ Die Gespräche und Monologe sind dem Alltag abgelauscht, oft lakonisch und gerade darin bestürzend.
„Schauen, was ist, und nichts anderes hintun als das, was ist.“ So lässt Ramuz den Ich-Erzähler auch seine Methode benennen. Deren Sog ist immens: „Ich schaue, solange ich noch kann.“ Die Erzählfallhöhe erinnert an die dystopische Dichte des Romans The Road (Die Straße) von Cormac McCarthy, wirkt trotz des gewusst ausweglosen Endes aber nicht genauso niederschmetternd. Und das erstaunt. Sturz in die Sonne bietet insofern ein paradoxes Leseerlebnis. Zwar raubt es den Atem, wirkt jedoch beinahe tröstlich. Das ist begeisternd, so sehr es auch verwirrt. Einige Partien haben gar einen elegischen Walt-Whitman-Tonfall. Doch statt um die Feier des Lebens geht es hier um dessen Untergang. Vielleicht ist es gerade die Lakonie, die berückt: „Man wollte es nicht glauben, aber man musste es doch.“
Solche Sätze gibt es viele. Man folgt gebannt Dialogen in den da noch fahrenden Straßenbahnen, die banales Kleinreden der Zeitungsnotizen ebenso in den Blick nehmen wie das Kontern mit nicht weniger haltlosen Weisheiten: „Der einzige Unterschied ist, dass wir alle gemeinsam gehen, statt jeder für sich.“ Man staunt, wie intensiv Literatur noch im Untröstlichen bewegt, und fragt, ob es wohl daran liegt, dass das Ende hier so unverstellt, ja fast vertraut daherkommt. Der Roman ist ein literarisches Ereignis mit sehr langem Nachhall, der zudem beträchtliches Vergnügen bereitet. Das klingt ungehörig, ist es aber nicht. Man sollte ihn nicht verpassen: „Ich schaue, solange ich noch kann.“
Udo Feist
Udo Feist lebt in Dortmund, ist Autor, Theologe und stellt regelmäßig neue Musik vor.