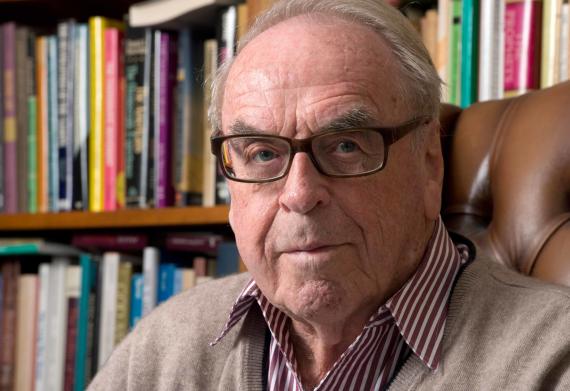Wie das Reh im Lichtkegel, so stehen derzeit manche kirchlich Aktive vor der Aufgabe, die Reduktion der kirchlichen Gebäude zu organisieren, die vor dem Hintergrund der Umbildungsprozesse notwendig werden. Dass der kirchliche Gebäudebestand sich in den kommenden Jahren deutlich reduzieren wird und aus wirtschaftlichen Gründen muss, steht außer Frage. Wer gegenwärtig synodale und gemeindliche Beratungen zu diesem Thema wahrnimmt, die kann sich mitunter wundern, mit welcher Unermüdlichkeit sich die Illusion hält, es habe ja alles noch Zeit und man solle jetzt nichts überstürzen.
Diese Wahrnehmung mit kollektiver Ignoranz zu erklären, wäre zu kurz gegriffen. Vielmehr fällt uns jetzt auf die Füße, dass wir viel zu lange die Frage nach dem Verhältnis des Christentums zu seinen Räumen weitgehend unbeachtet gelassen haben. Dogmatisch gehören Kirchengebäude bei Luther zu den Adiaphora, allein in ihrem praktischen Nutzen für die religiöse Kommunikation sind sie von Relevanz, geistlich aber grundsätzlich verzichtbar. Programmatisch formuliert Luther dies in der Weihnachtspostille von 1522 mit einer Gegenthese zum mittelalterlichen Sakralbau. Thomas Erne hat darauf hingewiesen, dass diese Ablehnung nicht grundsätzlich ist, sondern eher vor dem Hintergrund eines extremen Stiftungswesen zu verstehen ist, welches Luther als Phänomen der Werkgerechtigkeit brandmarkt.
Religion und Raum
Adiaphora mögen nicht wesentlich sein, völlig ohne Relevanz sind sie deshalb noch lange nicht. Diese Spannung nimmt der Soziologe Richard Sennet präzise wahr, wenn er in seinem Buch „Flesh and stone“ beschreibt, wie sich die christlichen Gemeinden, die ihrem Ursprung nach in Erwartung des nahenden Gottesreiches indifferent waren gegenüber Räumen mit dem Zeitpunkt der konstantinischen Schenkung in einen führenden Akteur der Architekturgeschichte verwandeln. Seit diesem Zeitpunkt ist die christliche Religion, die dem Kern ihrer Idee nach den Raum immer schon überwunden hat, bleibend auf Räume bezogen. Ihre Räumlichkeit ist gewissermaßen die grundlegende Darstellungsform ihrer Öffentlichkeit.
Macht man sich dieses Spannungsverhältnis klar, so wird deutlich, warum die Organisation der anstehenden Reduktionsprozesse so schwierig ist und so viel Verzagtheit produziert. Alle Hinweise etwa auf das biblische Zeugnis des wandernden Gottesvolkes, die gegenwärtig nicht selten in den Debatten rund um den Umgang mit dem Immobilienbestand auftauchen, sind ja richtig, allerdings ist diese grundsätzliche Bezogenheit auf Raum eben genauso richtig.
Perspektive wechseln
Um auch diese Seite in die Überlegungen zur Reduktion des kirchlichen Gebäudebestandes zu integrieren, müsste zunächst mal begonnen werden, die richtigen Fragen zu stellen. Im Moment lautet die Frage vielerorts: Wie können wir möglichst viele Gebäude erhalten? Vor allem natürlich unsere eigene Kirche und unser eigenes Gemeindehaus hier bei uns im Ort. Damit wir wegkommen von einer bloßen Reduktion der Gebäude hin zu einem intelligenten Transformationsprozess müsste die Frage allerdings lauten: Welche Räume braucht der Protestantismus der Zukunft? Wie stellen wir uns die kirchliche Wirklichkeit in 40 Jahren vor und welche Raumbedarfe entstehen dadurch? Welche bauliche Gestalt soll diese Kirche haben und wie soll sie öffentlich wahrnehmbar werden durch ihre Gebäude in den Städten und Dörfern? Es geht darum, von einer Reduktionslogik in eine Gestaltungslogik zu kommen.
Dieser notwendige Perspektivwechsel ist für Kirchengemeinden anspruchsvoll, denn er erfordert das Verlassen einer rein parochialen Perspektive auf den eigenen Kirchturm und das Einnehmen einer regionalen Perspektive. Darüber hinaus wird der Gestaltungsprozess nur gelingen, wo Kirchengemeinden sich sozialräumlich vernetzt verstehen und auch die Frage nach den kirchlichen Gebäuden in einem sozialräumlichen Kontext begreifen und nicht allein als kircheninternes Thema. Kurzum: das Unternehmen ist hoch komplex. An vielen Stellen wird es sicher auch nicht zu guten Lösungen kommen können. Denkbar werden sie da, wo Gemeinden sich jetzt auf den Weg machen, das Thema beherzt angehen und versuchen erste Schritte zu wagen.
Katharina Scholl
Dr. Katharina Scholl ist Studienleiterin am Evangelischen Studienseminar Hofgeismar. Zuvor war sie Gemeindepfarrerin in Hanau-Großauheim.