
Seit Veröffentlichung der neuen Kirchenmitgliedschaftsuntersuchung der EKD, kurz KMU 6, gibt es lebhafte Diskussionen um die angemessene Deutung der Ergebnisse und etwaige Handlungsoptionen. Albrecht Grözinger, emeritierter Professor für Praktische Theologie in Basel, macht dabei Frontstellungen aus, die im Kern mehr als hundert Jahre alt sind. Angesichts der Lage sind diese aber völlig überholt, so seine These.
Merkwürdiges tut sich gegenwärtig in der deutschsprachigen protestantischen Theologie im Nachklang zu der kürzlich der Öffentlichkeit vorgestellten Kirchenmitgliedschafts-Untersuchung 6. Angesichts der in einzelnen Punkten durchaus dramatischen Resultate scheint der theologische Ausnahmezustand zu herrschen. Und souverän ist derjenige, der - so bekanntlich Carl Schmitt - den Ausnahmezustand beherrscht. Und diese Beherrschung konkretisiert sich darin, dass der Feind klar beim Namen benannt wird. Und dieser Feind hat einen eindeutigen Namen: Liberale Theologie.
Als erster meldete sich in diesem Zusammenhang Detlev Pollack, einer der wissenschaftlichen Begleiter der KMU, mit einem Artikel in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung vom 15. November (€)zu Wort. In einem Rundumschlag von Schleiermacher bis hin zu Wilhelm Gräb wird mit der Liberalen Theologie abgerechnet. Sogar Karl Rahner wird in dieses Kästchen gepackt. Sie alle sängen „den hellen Sopran der Unvergänglichkeit des Religiösen“ abseits aller aktuellen religionssoziologischen Erkenntnis. Als Gegenmittel wird ein Réduit „auf die Sinnformen innerkirchlicher Religiosität“ empfohlen.
Dieser Perspektive stellte sich Ralf Frisch in einem Artikel auf zeitzeichen.net an die Seite. Er sieht in den Kirchen der EKD eine „palliative Ekklesiologie“ am Werk, die sich hauptsächlich um die „Entsorgung metaphysischen Muffs“ kümmert. Und wiederum muss die Liberale Theologie als Akteur solch verwerflichen Handelns herhalten: „Da die liberale Theologie nicht von starken christlichen Überzeugungen lebt, muss sie an die Stelle des Missionsbegriffs, den diese Theologie naturgemäß scheut wie der Teufel das Weihwasser, eine einladende Offenheit in Sachen Spiritualität und Lebenskunst setzen.“ Als Gegenmittel empfahl Frisch bereits Ende Juli - ebenfalls in einem Artikel in zeitzeichen - das „Oberlicht“ Barth’scher Theologie.
Offensichtlich werden im ersten Drittel des 21. Jahrhunderts die alten theologischen Kampflinien des ersten Drittels des 20. Jahrhunderts gegen das 19. Jahrhundert reaktiviert. Was ist von diesem Ruf in die alten Schützengräben der Theologie zu halten?
Zunächst einmal sollten wir sehen, dass Daniel Friedrich Ernst Schleiermacher, der liberale Kirchenvater des 19. Jahrhunderts, an einem entscheidenden Kipppunkt der europäischen Geistesgeschichte für die Religion und die Theologie ein neues Fundament gebaut hat, auf dem wir auch heute noch agieren. In seinen Reden „Über die Religion“ von 1799 hat er mit dem Gedanken von der Religion als „eigenständiger Provinz“ im Humanum auf die Kant’sche Religionskritik mit einem grandiosen Gegenentwurf geantwortet und damit zugleich die Argumentationslinien bis hin zur frühen Dialektischen Theologe vorgespurt. Schleiermacher hat damit ein Paradigma für den theologischen Diskurs geschaffen, an dem auch noch diejenigen partizipieren, die heute als Kritiker der Liberalen Theologie auftreten.
Recht naives Fortschrittsdenken
Natürlich hat Schleiermacher damit zugleich einer Individualisierung der Religion Vorschub geleistet. Wenn Religion eine eigenständige Provinz im Gemüt des Menschen ist, dann ist damit zunächst einmal das Gemüt jedes einzelnen individuellen Menschen gemeint. Aber so neu ist das nun auch wieder nicht – gerade in einer Theologie und Kirche der Reformation. Schon Martin Luthers Pathos galt einer Verkündigung und einem Verständnis von Predigt, die Glauben und Vertrauen im je individuellen Menschen weckt und stärkt.
Gewiss hat dann die Liberale Theologie des 19. Jahrhunderts über Albrecht Ritschl bis hin zu Adolf von Harnack dieses Lob des religiösen Individuums auf die Spitze getrieben und vor allem verbunden mit einem – aus der Rückschau betrachtet – recht naiven Fortschrittsdenken. Exemplarisch wird dies in den Worten, mit denen Adolf von Harnack seinen berühmten Vorlesungszyklus über „Das Wesen des Christentum“ aus dem Wintersemester 1899/1900 beendet: „Wenn wir aber mit festem Willen die Kräfte und Werte bejahen, die auf den Höhepunkten unseres inneren Lebens als unser höchstes Gut, ja als unser eigentliches Selbst aufstrahlen, wenn wir den Ernst und den Mut haben, sie als das Wirkliche gelten zu lassen und nach ihnen das Leben einzurichten, und wenn wir dann auf den Gang der Geschichte der Menschheit blicken, ihre aufwärts sich bewegende Entwicklung verfolgen und strebend und dienend die Gemeinschaft der Geister in ihr aufsuchen – so werden wir nicht in Überdruss und Kleinmut versinken, sondern wir werden Gottes gewiß werden, des Gottes, den Jesus Christus seinen Vater genannt hat, und der auch unser Vater ist.“ (Das Wesen des Christentums, Leipzig 1929, S. 188f.)
Diesem Pathos der Liberalen Theologie hat dann Karl Barth 1919 beziehungsweise 1922 das Pathos seiner Römerbriefkommentare entgegengesetzt – mit den starken bekannt-berüchtigten Metaphern von der „unmöglichen Möglichkeit“, dem Menschen als „Einschlagtrichter“ für die Offenbarung, und so weiter.
Schützengräben der Pathosformeln
Ich bin nun der Ansicht, dass es uns heute nicht weiterhilft, in den Schützengräben dieser Pathosformeln zu verharren - auf welcher Seite auch immer. Unsere postvolkskirchliche Situation, die uns die KMU6 noch einmal drastisch vor Augen gestellt hat, eröffnet meines Erachtens neue Perspektiven auf den Wahrheitsgehalt beider theologischen Grundoptionen.
Aus der Rückschau lassen sich bereits in der ersten Auflage des Römerbriefkommentars von Karl Barth Weichenstellungen erkennen, die heute mehr denn je aktuell sind. Wo finden wir heute die einzelnen, individuellen Menschen an ihrem Ort? Das ist die Frage, vor die uns die KMU6 stellt, und die – wie wir gegenwärtig sehen - sehr kontrovers beantwortet wird. Die Römerbriefkommentare warnen vor einem eindringlich – nämlich sich an Religion, wie auch immer geartet, zu orientieren. „Meinet nur nicht, ihr müsset überall nippen, wo der religiösen Neugier und Nervosität wieder ein neues Tränklein geboten wird!“ (An die Römer 1919, Zürich 1985, S. 577) Darauf zielen ja die kritischen Einsprüche der Kollegen Pollack und Frisch ab.
Wobei die Lage keineswegs so eindeutig ist, wie es diese Kritiker suggerieren. Als meine Generation mit dem Studium um 1968 begann, war praktisch-theologisch die Perspektive der klassischen Säkularisierungsthese bestimmend. Das Buch von Harvey Cox „The Secular City“ (1966 – im Deutschen hatte das Buch den Titel „Stadt ohne Gott?“) war für uns Studierende damals Kultbuch. Ein Spitzensatz in diesem Buch lautete: „Wir müssen die Säkularisation lieben!“ Die Sicht der Säkularisierungsthese war bis in die frühen 1980er-Jahre hinein vorherrschend. Dann begannen wir plötzlich überall wieder Religion zu entdecken, vielleicht sage ich sogar besser: Religion zu „erschnüffeln“ bis hin zum Museum als „heiligem Ort“ und dem Samstagnachmittag als „heiliger Verehrungszeit des Fussball-Gottes“.
Buntheits-Paradigma der Postmoderne
Dieser Wandel hatte ihre zeitgenössischen Hintergründe: Die zu dieser Zeit vor allem durch Ulrich Beck entwickelte Theorie der Individualisierung, das Buntheits-Paradigma der Postmoderne, sowie das Erstarken der Religionswissenschaft mit ihrem eigenen Blick auf Phänomene des Religiösen.
Diese Sicht wurde nun wiederum in den vergangenen zehn bis 15 Jahren fraglich, was die genannten Kritiker so wohl nicht in den Blick bekommen haben. Haben wir nicht ein Zuviel an Religion „erschnüffelt“? Als ein schönes und tröstliches, aber eben doch Gedanken-Narkotikum?
Ich war im Herbst auf dem Jahrestreffen des Arbeitskreises „Empirische Theologie“ in Arnoldshain zu Gast. Und es war beeindruckend zu sehen, dass die überwiegende Mehrheit der promovierenden und habilitierenden jungen praktisch-theologischen Forscher*innen gegenwärtig an Themen arbeiten, die sich allesamt am Schnittpunkt von Religion und Kirche ansiedeln. An Kirche – und sei es nur locker – orientierte Frömmigkeit ist Gegenstand gegenwärtiger praktisch-theologischer Forschung.
Und vielleicht hat ja der Römerbriefkommentar doch recht, wenn er uns in dieser Situation entgegenruft: „Laßt wimmeln das religiöse Gewimmel!“ (S. 577)
Tun ohne Absicht
Was aber wäre die Alternative? Geben uns Barths Römerbriefkommentare darauf eine Antwort oder bieten sie uns nur die Polemik gegen den religiösen Anknüpfungspunkt? Genau dazu finde ich Überlegungen, die – so denke ich – auch ganz unmittelbar in unsere heutige Situation hinein zu sprechen vermögen. Barth schreibt: „... das Reden von Gott gehört wie das Liebhaben, das Spiel und die Kunst zu dem Tun, das keine Absicht hat und mit dem Erfolg nicht rechnet. Es ist sich selber Absicht und Erfolg.“ (S. 570) Es ginge also – und es geht heute: so sage ich – um das Reden von Gott, der um seiner selbst willen interessant ist. So wie die Liebe, das Spiel und die Kunst. Wenn es uns gelänge, uns von allen Zwecken zu befreien, wenn wir von Gott reden, bekämen wir – so sagt es uns der Römerbriefkommentar – eine neue Freiheit, die uns das krampfhafte Suchen nach Anknüpfungspunkten (damals uns heute!) offensichtlich verweigert. Rede von Gott ist menschliche Rede in absichtsloser Freiheit! Dies ist der Wahrheitskern des an der Dialektischen Theologie orientierten Denkens, das – davon bin ich überzeugt – gerade in unserer postvolkskirchlichen Situation neue Bedeutung gewinnt.
Barths Polemik gegen den „Anknüpfungspunkt“ überzeugt mich jenseits aller systematisch-theologischer Aspekte gerade auch praktisch-theologisch. All die sekundären Begründungskurse, warum eine Gesellschaft Religion braucht, und warum Kirche dem Zusammenhalt der Gesellschaft dient! All dies mag sinnvoll und manchmal auch notwendig sein, das will ich gar nicht bestreiten. Diese Diskurse laufen aber letztlich doch irgendwo ins Leere, wie nicht zuletzt der ernüchternde Befund der neuen KMU6 zeigt. Durch sekundäre Begründungsdiskurse lässt sich Religion nicht begründen. Oder in Abwandlung von Franz Overbeck: Nur durch Verwegenheit lässt sich kirchlich-religiöse Praxis in einer post-volkskirchlichen Gesellschaft begründen!
Die Mischung macht’s
Man muss den Menschen nicht sagen, dass es gut und notwendig ist, wenn sie Kuchen essen. Sondern man muss solch gute Kuchen backen, dass den Menschen der Mund danach wässrig wird. Das ist – etwas salopp gesagt – der Kern der Barth’schen Offenbarungstheologie praktisch-theologisch gewendet. Dass das nicht einfach ist, das weiß ich wohl. Aber das verwegene Kuchenbacken kann vielleicht auch Spaß machen und Mut generieren: im Behalten des Bewährten, im Dahinten-Lassen des Nicht-Bewährten, in der Freude des Entdeckens am Neuen. Da sollte der gerade der Praktische Theologe und wohl auch der Systematische Theologe den Praktikerinnen und Praktikern vor Ort nicht allzu sehr regulativ ins Handwerk pfuschen: Gute Praxis entsteht aus einer Mischung von Bewährtem und einer Freude am Ausprobieren von Neuem.
Bereits im ersten Band der „Kirchlichen Dogmatik“ findet Karl Barth zu solcher Praxis Worte, die für mich zum Klarsten und Schönsten gehören, was zur Aufgabe und zur Gestalt der kirchlichen Praxis gehört: „Das Zeugnis im christlichen Sinn des Begriffs ist der Gruß, mit dem ich [...] meinen Nächsten zu grüßen habe, die Bekundung meiner Gemeinschaft mit dem, in welchem ich einen Bruder [sc. eine Schwester] Jesu Christi und also meinen eigenen Bruder [sc. meine eigene Schwester] zu finden erwarte [...] Ein Zeuge ist weder ein Fürsorger noch Erzieher. Ein Zeuge wird seinem Nächsten gerade nicht zu nahe treten. Er wird ihn nicht ‚behandeln’. Er wird ihn sich nicht zum Gegenstand seiner Tätigkeit machen, auch nicht in bester Absicht. Zeugnis gibt es nur im höchsten Respekt vor der Freiheit der göttlichen Gnade und darum auch im höchsten Respekt vor dem Anderen, der von mir gar nichts, sondern Alles von Gott zu erwarten hat.“ (KD I/2, S.487)
Das ist Offenbarungstheologie, die sich nicht mehr ängstlich gegen Liberale Theologie abgrenzen muss. Vielleicht können wir sogar pointiert sagen: Das ist Offenbarungstheologie in Gestalt Liberaler Theologie.
Gruß hinzufügen
Warum sehe ich das so? Wenn ich einen Anderen oder eine Andere aufrichtig grüße, dann bin ich an ihm/ihr interessiert, so wie er/sie ist. Der Gruss bekundet mein Interesse am Sein des/der Anderen - etwas emphatisch gesagt. Ich füge meinen Gruß seinem/ihrem So-Sein hinzu. An diesem So-Sein von Frömmigkeit in ihren vielfältigen Gestalten ist die Liberale Theologie interessiert. Dem „Hinzu-Fügen“ des von außen kommenden Grußes galt das besondere Interesse der Dialektischen Theologie. Und genau dieses spannungsreiche Gefüge spiegelt auch die alltägliche Arbeit von Pfarrerinnen und Pfarrern wieder. In der Predigt versuchen wir die erfahrungsgesättigten Geschichten der biblischen Überlieferung mit den alltäglichen Erfahrungen der Menschen heute zu verknüpfen. In der Seelsorge versuchen wir, die biblische Verheißung eines erfüllten Lebens in den Fragmenten unserer individuellen Lebensgeschichten zu entdecken.
Der große Liberale Theologe Ernst Lange wusste um diese Spannung von „Sprache der Verheißung“ und „Sprache der Tatsachen“. Aber er hat darauf vertraut, dass es uns – wie vorläufig auch immer – gelingt, beides miteinander ins Spiel verbringen. Dazu müssen wir aber mit beiden Sprachen vertraut sein. Das macht die Professionalität der Tätigkeit von Pfarrerinnen und Pfarrern aus.
Der Blick auf die alltägliche pfarramtliche Praxis zeigt zugleich auch, dass der Ruf zur Konzentration auf die „Sinnformen innerkirchlicher Religiosität“ keineswegs so eindeutig ist, wie er klingt. Denn diese Sinnformen sind ja selbst stets fluid. Ich kann das angesichts meines Alters an meinen eigenen biografischen Erfahrungen festmachen. Ich kenne sie sehr gut die „Sinnformen innerkirchlicher Religiosität“ der Hoch-Zeiten etablierter Volkskirchlichkeit in den Jahren 1955-1975, und ich habe begeistert an diesen Sinnformen partizipiert.
«Sehr festlich anlachen»
Aber bereits ab den 1970er-Jahren war der Rückzug vieler Menschen aus diesen Sinnformen am Werk. Das kräftige Festhalten an diesen Sinnformen konnte den Auszug vieler Menschen nicht verhindern und ein weiteres Festhalten daran hätte den Auszug daraus nur verstärkt. Die heutigen Sinnformen innerkirchlicher Religiosität unterscheiden sich wesentlich von den Sinnformen, die noch vor 40 Jahren als selbstverständlich galten. Und deshalb ist der Ruf nach einem Réduit in die gegenwärtigen Sinnformen innerkirchlicher Religiosität nicht sehr verheißungsvoll. Gerade hier gilt das Diktum der Theaterregisseurin Ruth Berghaus, Traditionen ließen sich nicht durch reine Wiederholung, sondern nur durch Innovation am Leben erhalten. Auch die Sinnformen innerkirchlicher Religiosität sind nicht einfach da, sondern sie entstehen in einem fortlaufenden Prozess des Austausches auch mit den religiösen Erfahrungen außerhalb des binnenkirchlichen Bereichs.
Auch ein Blick in die wechselhafte Geschichte der Frömmigkeit zeigt dies. Und Pfarrerinnen und Pfarrer erleben dies tagtäglich, wenn sie nach dem richtigen Wort, nach der richtigen Form suchen, um in einer konkreten Situation dem Evangelium lebensdienliche Gestalt zu geben. Traditionelle Sinnformen innerkirchlicher Religiosität können ein Geländer sein. Das ist unbestritten. Aber dieses Geländer wird in dem Augenblick morsch, wo es sich von den Sinnformen außerkirchlicher Religiosität abschottet.Der späte Karl Barth hat sich in seinem Nachwort zu einem kleinen Bändchen mit Texten von Schleiermacher aus dem Jahr 1968 eine kleine Vision erlaubt: „Mir bleibt als sicherer Trost nur übrig, mich darauf zu freuen, mich mit Schleiermacher im Himmelreich in dessen erst kommender Gestalt über alle diese Fragen… sagen wir einmal: ein paar Jahrhunderte lang ausgiebig zu unterhalten… Ich stelle mir vor, daß das für beide Teile eine sehr ernste Sache werden wird, dass wir uns aber auch gegenseitig sehr festlich anlachen werden.“ (Schleiermacher-Auswahl, hg. Heinz Bolli, München/Hamburg 1968, S. 310) Ich weiß nicht, an welcher Stelle die beiden alten weißen und weisen Männer gegenwärtig in ihrem himmlischen Gespräch stehen. Ich empfehle jedenfalls - getreu dem Motto Heinrich Heines „Wir wollen hier auf Erden schon …“ - dieses Gespräch in unserer irdischen Gegenwart unter uns aufzunehmen. Wir brauchen sie beide - die liberale Bodenhaftung individueller lebensgeschichtlicher Frömmigkeit und das Oberlicht Barth’scher Theologie.
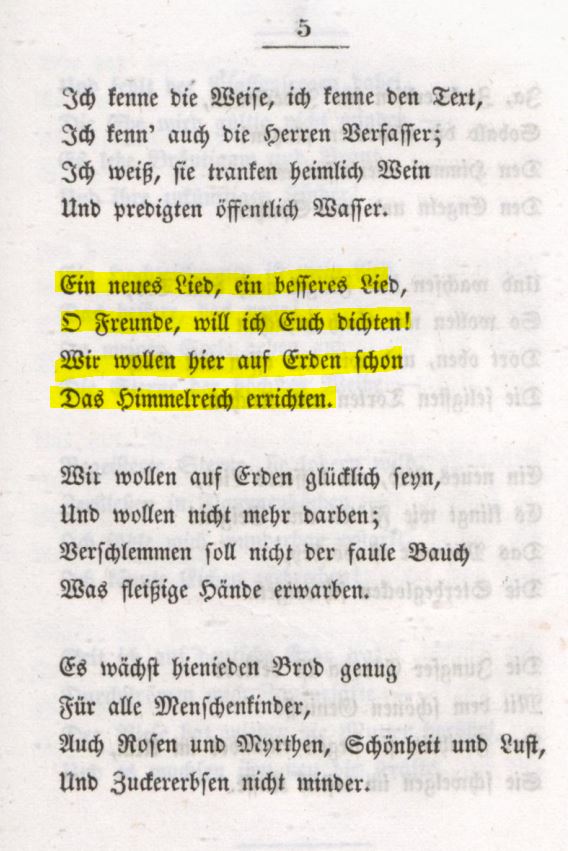
Ausschnitt aus Heinrich Heines Werk: Deutschland ein Wintermärchen (1844).
Albrecht Grözinger
Dr. Albrecht Grözinger ist Professor em. für Praktische Theologie an der Universität Basel.


