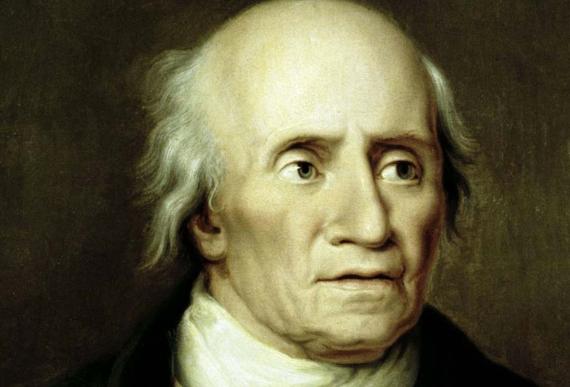Staatlich finanzierter Judenhass

„Initiative GG 5.3 Weltoffenheit“, „Historikerstreit 2.0“, die „documenta fifteen“ und so weiter: Seit kurzem häufen sich in der deutschen Kulturszene die Vorfälle eines israelbezogenen Antisemitismus‘ und offenen Judenhasses, auch wenn dies viele nicht wahrhaben wollen. Auf einer Konferenz im Haus der Wannsee-Konferenz versuchten bedeutende Organisationen der Erinnerungspolitik und Menschenrechtsarbeit, die Lage auszuloten und diesem Trend etwas entgegenzusetzen. Alle waren sich in der Analyse einig: Judenfeindschaft und Israelhass ist durch die Kunstfreiheit nicht gedeckt.
In diesen strahlenden Maitagen wird man im Park dieser Villa am Großen Wannsee im Südwesten Berlins fast überwältigt von der Schönheit des Zusammenspiels von Sonne, Wasser und der aufblühenden Natur. Zugleich ist dies einer der schrecklichsten Orte der Hauptstadt. Denn in diesem 1914/15 gebauten Herrenhaus fand am 20. Januar 1942 die so genannte „Wannseekonferenz“ statt, bei der die Spitzen der NS-Staatsapparats die systematische Ermordung von Millionen europäischer Juden während des Zweiten Weltkriegs eiskalt bürokratisch umsetzten. An diesem so ambivalenten Ort über die Folgen von Judenfeindlichkeit zu sprechen ist sinnvoll. Genau dies geschah Ende vergangener Woche in einem großen Zelt am Rande des Wassers auf einer Tagung mit dem Titel „Von der Kunstfreiheit gedeckt? Aktuelle Herausforderungen im Umgang mit Antisemitismus in Kunst und Kultur".
Wie drängend diese „Herausforderungen“ sind, ließ sich nicht zuletzt an der relativ großen Menge und dem gesellschaftlichen Gewicht der Organisationen ermessen, die zu dieser Tagung eingeladen haben. Es waren die Amadeu Antonio Stiftung, das American Jewish Committee Berlin, die Gedenk- und Bildungsstätte Haus der Wannsee-Konferenz und der Zentralrat der Juden in Deutschland. Auch die „Keynote“-Rede des Zentralrats-Präsidenten Josef Schuster unterstrich die Bedeutung, die dieser Konferenz von den genannten zivilgesellschaftlichen Organisationen beigemessen wurde. Es ging darum, etwas überspitzt gesagt, einen Schock zu verarbeiten, sich gegenseitig zu bestärken – und auch die eigenen Wunden zu lecken.
Denn in den vergangenen Jahren ist etwas Verstörendes passiert oder zumindest unverhohlen öffentlich geworden in der deutschen Gesellschaft: ein meist verdrängter Antisemitismus auch in der Kunst- und Kulturszene, die dieses Problem mehrheitlich vor kurzem noch weit von sich gewiesen hätte. Die Judenfeindlichkeit in der angeblich so aufgeklärten Szene manifestierte sich vor allem in drei Debatten, die mit den Schlagworten „Initiative GG 5.3 Weltoffenheit“, „Historikerstreit 2.0“ und besonders „documenta fifteen“ öffentlich Resonanz fanden. Hinzu kamen noch die Diskussionen um den kamerunischen postkolonialistischen Theoretiker Achille Mbembe, um das derzeit ziemlich oft aufgeführte Theaterstück von Wajdi Mouawad „Vögel“ und um den jüngsten Auftritt des „Pink Floyd“-Mitgründers und BDS-Unterstützers Roger-Waters in Frankfurt am Main.
Umweg über Erinnerungskultur
Während der platte Antisemitismus aus der Mottenkiste des 19. Jahrhunderts im vergangenen Jahr bei der weltweit beachteten Kunstschau „documenta“ in Kassel bei mehreren dort gezeigten Kunstwerken geradezu ins Auge stach, war er beim „Historikerstreit 2.0“ in den Feuilletons großer Zeitungen etwas schwerer auszumachen, weil er nur über den Umweg der deutschen Erinnerungskultur funktionierte. Es ging dabei im Wesentlichen um die Thesen des Genozidforschers A. Dirk Moses. Der hatte behauptet, die Deutschen folgten in der Erinnerung an den Holocaust einem „Katechismus“ mit geradezu quasireligiösen Zügen, wonach selbst ernannte „Hohepriester“ über den richtigen Umgang mit der Geschichte wachten.
Ein in gewisser Weise noch versteckterer, da indirekter und israelbezogener Antisemitismus wurde in der Debatte um die „Initiative GG 5.3 Weltoffenheit“ sichtbar. Diese Erklärung unterschrieben die Chefs zahlreicher großer und öffentlich finanzierter Kultureinrichtungen, etwa wichtiger deutscher Stadttheater. Sie nahm, mit gehöriger Verspätung, eine 2019 verabschiedete Resolution des Bundestags sehr kritisch auf. Das Parlament hatte darin die weltweite israelfeindliche Boykottbewegung „Boycott, Divestment and Sanctions (BDS) verurteilt, nämlich als antisemitisch. Zugleich verbot die Volksvertretung die finanzielle Hilfe für diese Bewegung, jedoch nur bei Bundesmitteln.Die mehr als ein Jahr lang vorbereitete „Initiative GG 5.3 Weltoffenheit“ vom Dezember 2020 reagierte auf diesen Beschluss des Bundestags. Einerseits betonten die führenden Kulturschaffenden: „Da wir den kulturellen und wissenschaftlichen Austausch für grundlegend halten, lehnen wir den Boykott Israels durch den BDS ab.“ Andererseits erklärten die Intellektuellen, das Boykott-Argument geradezu umdrehend, sie hielten „die Logik des Boykotts, die die BDS-Resolution ausgelöst hat, für gefährlich. Unter Berufung auf diese Resolution werden durch missbräuchliche Verwendung des Anstisemitismusvorwurfs wichtige Stimmen beiseitegedrängt und kritische Positionen verzerrt dargestellt.“ Das war kaum anders zu lesen als: Wir wollen weiter mit BDS-Künstlerinnen und Künstlern, ob judenfeindlich oder nicht, zusammenarbeiten – und auch Geld vom Bund dafür bekommen.
Postkolonialismus vs. Antisemitismus
Samuel Salzborn, außerplanmäßiger Professor für Politikwissenschaft an der Justus-Liebig-Universität Gießen und seit August 2020 Antisemitismusbeauftragter des Landes Berlin, sprach angesichts dieser gesellschaftlichen Debatten, es gebe „viele Probleme mit Antisemitismus im Kunst- und Kulturbereich“. Und die Aufarbeitung dieser Probleme stehe noch am Anfang. Auch angesichts neuer identitätspolitischer und postkolonialer Ansätze werde von vorhandener Judenfeindlichkeit abgelenkt, sie werde verharmlost und de-thematisiert. Tatsächlich gebe es ein Problem mit der Kunstfreiheit, nämlich dann, wenn israelische Künstlerinnen und Künstler wegen BDS-Kampagnen nicht die Möglichkeit hätten, in Deutschland aufzutreten oder auszustellen. Mehrfach wurde auf der Tagung an die Tatsache verwiesen, dass auf der riesigen „documenta“ zwar mehrere judenfeindliche Werke gezeigt wurden, aber kein israelischer Künstler ausstellen durfte.
Angesichts des historischen Umfelds der Konferenz erinnerte Salzborn daran, dass Antisemitismus am Ende immer mit Gewalt zu tun habe. Die Kulturszene müsse endlich, ähnlich der Bundesregierung, die mittlerweile weltweit anerkannte und von der „International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA)“ verabschiedete Arbeitsdefinition von Antisemitismus übernehmen, die auch bestimmte Formen der Verurteilung Israels als jüdischer Staat als antisemitisch wertet. Außerdem: Wer keine staatlichen Gelder vom Bund mehr erhalten sollte, erleide dadurch noch lange keinen Eingriff in seine Kunstfreiheit, so Salzborn. Angesichts der genannten Debatten gehe es offenbar um eine Normalisierung des Hasses gegen Israel, dem man sich entgegenstellen müsse. Nötig sei mehr Selbstkritik in der Kulturszene. Sie habe das Problem mit dem Antisemitismus, nicht die, die dies Problem benennten – das zum Schlagwort „Antisemitismusvorwurf“.
Wie sich diese Stimmung in der Kulturszene konkret auswirkt, das machte bei der Tagung im Park der Wannseevilla Mia Alvizuri Sommerfeld, eine junge Künstlerin in der Theaterszene, deutlich. Als „jüdische, israelsolidarische Person“ sei eine Arbeit im Theaterbetrieb kaum mehr möglich. Sie sei, das als Beispiel, in einem großen deutschen Theaterhaus mit über 80 Angestellten mehrfach von der Arbeit ausgeschlossen worden. Seit langem gehe es immer nur um Postkolonialismus, während Themen des Antisemitismus oder der deutschen Erinnerungspolitik seit etwa einem Jahrzehnt in der Intendanz kein Gehör mehr fänden.
Stiller Boykott
Mia Alvizuri Sommerfeld sagte, sie habe sich im Theater ungewollt als Jüdin bekennen oder outen müssen - und sich zugleich zur israelischen Siedlungspolitik und zur „Initiative GG 5.3 Weltoffenheit“ positionieren müssen. Das war übrigens ein Papier, das die Intendantin mit unterschrieben habe. Immer mehr habe sie sich wie in einer „strukturellen Ausgrenzungssituation“ gefühlt, die sie am Ende gezwungen habe, zu kündigen. Nach ihren Erfahrungen finde in der Theaterwelt ein „silent boycott“ jüdischer und israelischer Künstlerinnen und Künstler statt. Deswegen plane sie mit anderen Betroffenen und mit Unterstützung des Zentralrats der Juden die Gründung eines Netzwerks mit dem Namen „Reclaim Kunstfreiheit“, um dieser Entwicklung etwas entgegen zu setzen. Im Internet ist zu erfahren, dass nach Vernetzungstreffen in Mühlheim (Ruhr), Potsdam, München, Frankfurt/Main und Hamburg ein künstlerischer Kongress an der Volksbühne Berlin im Oktober 2023 vorbereitet werden soll.
Wie dringend die Sache ist, zeigten auf der Tagung auch die Erlebnisse, die Katja Lucker vom „Musicboard Berlin“ schilderte. Dies ist eine Förderorganisation für Popmusik, die 2013 durch eine gemeinsame Initiative der Berliner Musikszene und des Landes Berlin ins Leben gerufen wurde. Seit 2017, so Katja Lucker, habe sie unter Kampagnen der BDS-Bewegung zu leiden. BDS habe etwa die unwahre Behauptuung verbreitet, ein vom Musicboard organisiertes Popkulturfestival sei von Israel finanziert worden. Die Folge: Viele arabische Künstler würden absagen. Wenn das „Musicboard“ in Tel Aviv etwas organisiere, würden Musiker aufgefordert, dort nicht hinzugehen. Immer wieder erlebe sie Dialoge wie diesen: „Macht ihr was mit Israel?“ „Ja, natürlich.“ „Dann kommen wir nicht zu euch.“ Auch innerhalb Deutschlands bekomme sie zu hören: „Hör doch mal auf mit Israel, dann hast du keinen Stress mehr.“ Die BDS-Hetze ging sogar so weit, dass ein ägyptischer Künstler in seiner Heimat bedroht worden sei, weil er im Rahmen eines Musicboard-Programms aufgetreten sei.
Israelische Künstler ausgegrenzt
Voll Bitterkeit war auch die Keynote-Rede von Josef Schuster, des Präsidenten des Zentralrats der Juden in Deutschland. Mit Blick auf die „documenta“ sagte er: „Verantwortungslosigkeit wurde zum Prinzip gemacht, und das machte in der Illusion einer schönen heilen Welt nicht nur öffentlich zur Schau gestellten israelbezogenen Antisemitismus, sondern ganz plumpen ‚klassischen‘ Antisemitismus möglich.“ Dies sei aber nicht „aus heiterem Himmel“ gekommen. Es scheine vielmehr so, „als hätten es einige geradezu als Chance wahrgenommen, entsprechende Narrative auf deutschem Boden zu setzen, finanziert durch deutsche Steuergelder.“ Aber: „Wenn man gewollt hätte, hätten diese Auswüchse verhindert werden können. Die Warnungen waren da.“ Es habe sich gezeigt, „dass es sich hier auch um ein strukturelles Problem handelt. Was beispielsweise von den Unterzeichnern der „GG 5.3. Weltoffenheit“ noch als Meinungsfreiheit idealisiert wurde, bestätigte sich bald als Form struktureller Ausgrenzung und als ein Vehikel für antisemitische Denkweisen.“ Und dies: „BDS gibt es nicht ohne Antisemitismus.“
Schuster sagte, es sei irritierend, dass es anscheinend auch in Deutschland einen Boykott israelischer oder jüdischer Künstlerinnen und Künstler gebe. „Ich habe sicher kein Interesse, an einem identitätspolitisch aufgeladenen Kunstbetrieb, aber gerade israelische Künstler werden offensichtlich systematisch ausgegrenzt.“ Die Gesellschaft müsse dem Antisemitismus im Kulturbetrieb entgegenwirken, damit es nicht zu weiteren „Entgleisungen“ komme. Aber: „Ich glaube, Kunst- und Meinungsfreiheit und der Ausschluss von Antisemitismus sind keine Gegensätze. Es sind miteinander im Einklang stehende Verfassungsprinzipien, die selbstverständlich nebeneinanderstehen müssen.“
Olaf Zimmermann, Geschäftsführer des Deutschen Kulturrats und ein Herausgeber von „zeitzeichen“, sagte in aller Klarheit, es gebe einen Antisemitismus im Kulturbetrieb und die „documenta“ sei gescheitert. Judenhass sei selbstverständlich nicht von Kunstfreiheit gedeckt. Zugleich blickte Zimmermann in die Zukunft: Der Kulturbereich müsse mit seinem Versagen bei der Aufarbeitung der Judenfeindlichkeit in seinen Reihen eigenständig und kritisch umgehen. Und wie? Etwa durch eine gemeinsame Erklärung, wonach es in den deutschen kulturellen Institutionen keinen Antisemitismus geben dürfe. Das wäre eine ähnliche Initiative wie „GG 5.3. Weltoffenheit“. Nur mit ganz anderen Vorzeichen.
Philipp Gessler
Philipp Gessler ist Redakteur der "zeitzeichen". Ein Schwerpunkt seiner Arbeit ist die Ökumene.