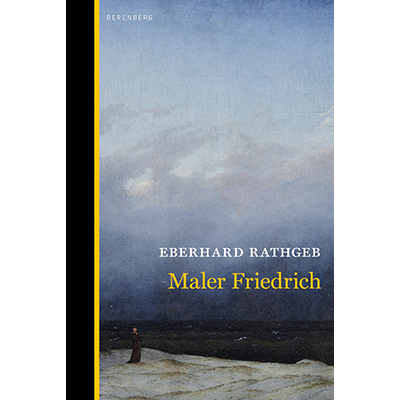Die Gedanken zu den Sonntagspredigten für die nächsten Wochen stammen von Jürgen Wandel. Er ist Mitarbeiter von zeitzeichen.
Über Paulus hinaus
2. Sonntag nach Epiphanias, 16. Januar
Meine Brüder und Schwestern, als ich zu euch kam, kam ich nicht mit hohen Worten oder hoher Weisheit, euch das Geheimnis Gottes zu predigen. Denn ich hielt es für richtig, unter euch nichts zu wissen als allein Jesus Christus, ihn, den Gekreuzigten. (1. Korinther 2, 1–2)
Damit ist scheinbar alles klar: Denn Gott hat sein Geheimnis enthüllt, indem er sein Wesen am Kreuz offenbart hat. Martin Luther stellte das Kreuz in den Mittelpunkt seiner Theologie. Evangelische Pfarrerinnen und Pfarrer sollen das auch tun. Und im Zweifelsfall erinnert sie daran das Kreuz, das oft als Kruzifix mit der leidenden Jesusfigur in lutherischen Kirchen steht oder hängt.
Aber allein die unterschiedlichen Kreuze, die in Kirchen zu sehen sind, illustrieren, wie verschieden der Tod Jesu interpretiert werden kann. Schon allein im Mittelalter gab es zwei Prototypen, die im Laufe der Kirchengeschichte immer wieder aufgetaucht sind: Einmal hängt Jesus am Kreuz, der Kopf ist geneigt und der Körper von den erlittenen Qualen gezeichnet. In Kirchen, die von der byzantinischen Kunst beeinflusst sind, wird Jesus dagegen als Herrscher dargestellt, der den Betrachter ernst und würdevoll anschaut. Nur der Heiligenschein, der sein Antlitz umgibt, zeigt ein Kreuz. Und das ist nicht mit Blut bespritzt, sondern mit Perlen besetzt.
In Kirchbauten, die um 1933 herum entstanden, hängt am überdimensionierten Kreuz oft ein Christus, der heroisch geradeaus blickt und dessen Arme nicht schlaff runterhängen, sondern parallel zum Querbalken ausgestreckt sind. So wirkt der Gekreuzigte nicht als Opfer, sondern als Herrscher. In der Nazizeit konnte das durchaus als Gegenbild zum „Führer“ verstanden werden.
Als Jugendlicher beeindruckte mich das Kruzifix in einer Kirche meiner Heimatstadt, die 1966 eingeweiht wurde. Der Gekreuzigte blickt mit offenem Mund und verzweifelter Miene nach oben. Diese Bronzeskulptur spiegelt das Empfinden der damaligen Zeit. Der Künstler hatte wie der Großteil der Gottesdienstbesucher die Nazizeit und den Krieg noch bewusst erlebt. Und Theologen bemühten sich damals um eine Christologie, die unten ansetzt, beim historischen Jesus von Nazareth, soweit er in den Evangelien zu erkennen ist.
Künstlerinnen und Künstler verstehen vielleicht besser als andere, dass in jeder Zeit neu gefragt werden muss, was das Kreuz bedeutet. Christen hoffen darauf, dass ihnen dies der Geist Gottes erschließt. Und dabei kann es geschehen, dass sie Aspekte des Kreuzes entdecken, die Paulus (noch) nicht bewusst waren. Anders als er lehnen heutige Christen zum Beispiel die Institution der Sklaverei ab. Denn im Kreuz solidarisiert sich Gott mit den Leidenden. Und Christen sollen das auch tun und alles bekämpfen und beseitigen, was den nahen wie den fernsten Nächsten das Leben zur Hölle macht.
Solche und solche
3. Sonntag nach Epiphanias, 23. Januar
Wahrlich, ich sage euch: Solchen Glauben habe ich in Israel bei keinem gefunden. (Matthäus 8, 10)
Jesus erstaunt das Vertrauen, das ihm, einem Juden, ein Nichtjude, der römische Hauptmann in Kapernaum entgegengebracht hat. Diese Erzählung des Matthäusevangeliums spiegelt die Ausein-andersetzungen zwischen Christen und Juden und den Beginn der christlichen Mission unter den „Heiden“, sprich: den Nichtjuden. Aber über diesen historischen Sitz im Leben hinaus vermittelt die Geschichte vom Hauptmann von Kapernaum eine zeitlose Wahrheit. Manche wollen die ökumenische Zusammenarbeit von Protestanten und römischen Katholiken zum Aufbau einer christlichen Einheitsfront gegen diejenigen instrumentalisieren, die sie als Feinde des Christentums betrachten, Atheisten und Agnostiker. Dabei sollten Christen genau hinschauen, wer sich als „Atheist“ bezeichnet. Denn auch unter ihnen gibt es solche und solche. Und beim genauen Hinschauen und Hinhören muss man dann mitunter feststellen: „Solchen Glauben habe ich in der Kirche bei keinem gefunden.“
Der hessische Generalstaatsanwalt Fritz Bauer ist in Deutschland einer breiteren Öffentlichkeit durch den Spielfilm Der Staat gegen Fritz Bauer bekannt geworden. Als er 1968 gestorben war, bezeichnete ihn ein Nachruf als „gläubigen Atheisten“. Bauer, der in einer jüdischen Familie aufgewachsen war, belegte neben dem Jurastudium in Tübingen an der Evangelisch-Theologischen Fakultät Vorlesungen in Dogmengeschichte und Neues Testament. Später bekannte er, ihm seien „metaphysische Zugänge verwehrt“. Aber 1963 schrieb Bauer über die amerikanische Bürgerrechtsbewegung und ihren Kampf gegen den Rassismus: „Erinnern wir uns, daß alle Menschen nach dem Bilde Gottes geschaffen sind, daß alle Völker und Rassen gleich nah zu Gott und seinen Gedanken sind. Sie alle sind wie Du.“ Der letzte Satz erinnert an Martin Bubers Übersetzung: „Liebe deinen Nächsten, er ist wie du.“
Als Fritz Bauer die Patenschaft für die Tochter eines befreundeten evangelischen Ehepaares übernehmen sollte, fragte der Taufpfarrer, an was er denn glaube. „An die Bergpredigt und an die Zehn Gebote“, antwortete Bauer.
Natürlich sollten Christen Atheisten nicht vereinnahmen, sondern ihre Sicht der Welt ernst nehmen und respektieren. Aber wer an die Bergpredigt glaubt, steht Jesus näher als die Getauften, denen ihre Nächsten gleichgültig sind.
Geschenke Gottes
Letzter Sonntag nach Epiphanias, 31. Januar
Als nun Mose vom Berg Sinai herabstieg, hatte er die zwei Tafeln des Gesetzes in der Hand und wusste nicht, dass die Haut seines Angesichts glänzte, weil er mit Gott geredet hatte. (2. Mose 34, 29)
Das Ergebnis des Gespräches, das Mose mit Gott führte, sind die Gebote, die er auf die beiden Tafeln schreiben sollte (2. Mose 27–28). Das „Gesetz“ oder die „Weisung“ (wie Martin Buber besser übersetzt) spiegelt wie das Antlitz des Mose göttlichen Glanz. In den Synagogen haben die Schriftrollen mit den Geboten einen Ehrenplatz. Und über dem Toraschrein brennt ein ewiges Licht wie in einer römisch-katholischen Kirche über dem Tabernakel.
Beim jüdischen „Gesetz“ denken Christen vor allem an das Ritualgesetz, die Pflicht, Knaben zu beschneiden, den Sabbat zu halten und bestimmte Speisen zu meiden. Nach christlicher Überzeugung ist es Gott egal, ob man Fleisch vom Schwein oder vom (geschächteten) Rind isst. Aber nicht gleichgültig kann es Christen lassen, wie Tiere gehalten werden. Und Juden dürften das erst recht so sehen. Denn für das Judentum spielt der Tierschutz eine wichtige Rolle. So gehört zum Halten des Sabbats auch, dass das Vieh ruht.
An diesem Punkt berührt das jüdische Ritualgesetz die Ethik. Der ethische Monotheismus ist das große Geschenk, das das Judentum der Welt gemacht hat. Er spiegelt sich auch in dem Gebet, das der Jude Jesus gelehrt hat. So beschränkt sich die dritte Bitte des Vaterunsers „Dein Wille geschehe“ nicht darauf, dass man sich seinem Schicksal ergibt. Gottes Wille soll vor allem getan werden (Thy will be done on earth as it is in heaven).
Judentum und Christentum unterscheiden sich fundamental von heutigen Ersatzreligionen, deren Anhängerinnen und Anhänger um sich kreisen und vor allem spirituelles Wohlbefinden suchen. Aber es gibt auch Christen, die sich vor allem um einen Platz im Himmel sorgen. Ethisch interessiert sie nur, was unterhalb des Bauchnabels geschieht, während ihnen die politische Unterdrückung und wirtschaftliche Ausbeutung ihrer Mitmenschen gleichgültig ist.
Vor sieben Jahren betonten orthodoxe (!) Rabbiner in der Erklärung Den Willen unseres Vaters im Himmel tun, das Christentum sei Gottes „Geschenk an die Völker“ (sprich: die Nichtjuden) und beide Religionen verbinde der „ethische Monotheismus Abrahams“. Bleibt zu hoffen, dass Christen dem gerecht werden durch das, was sie sagen und tun.
Nur als Team
4. Sonntag vor der Passionszeit, 6. Februar
Petrus stieg aus dem Boot und ging auf dem Wasser und kam auf Jesus zu. Als er aber den starken Wind sah, erschrak er und begann zu sinken und schrie: Herr rette mich! Jesus aber streckte zugleich die Hand aus und ergriff ihn und sprach zu ihm: Du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? (Matthäus 14, 29–31)
Während eines Sturmes sitzen die Jünger im Boot. Jesus geht ihnen auf dem Wasser entgegen und beruhigt sie mit dem Hinweis, dass er es ist, nicht ein Gespenst, wie sie fürchten.
Das Boot steht bei Matthäus für die christliche Gemeinde. Aber das ist auch heute so. Sehr anschaulich beschreibt dies im württembergischen Regionalteil des Evangelischen Gesangbuches das Lied 595: „Ein Schiff, das sich Gemeinde nennt, fährt durch das Meer der Zeit“.
Für die Gemeinde, an die sich gegen Ende des 1. Jahrhunderts das Matthäusevangelium wandte, galt, was vom Boot der Jünger erzählt wird: „Der Wind stand ihm entgegen“ (Matthäus 14, 24). In einem demokratischen Gemeinwesen geht es den Kirchen zwar wesentlich besser als der Urgemeinde. Aber auch ihnen weht der Wind ins Gesicht. Die Zahl der Mitglieder nimmt ab, die älteren sterben weg, andere treten aus, und in der nachwachsenden Generation kommt es zum Traditionsabbruch. Das lässt engagierte Laien und Geistliche grübeln und resignieren. Um es mit Matthäus auszudrücken: Ihr Glaube weicht umständehalber einem Kleinglauben. Aber damit befinden sie sich in guter Gesellschaft, in der des Apostelfürsten Petrus. Dieser geht Jesus auf dem Wasser zwar voller Vertrauen entgegen, aber er versinkt in dem Augenblick, als der starke Gegenwind seinen Blick gefangen hält und von Jesus ablenkt. Und so könnte es Kirchenleuten gehen, die nur noch auf die Zahlen schauen.
Tröstlich ist, dass Jesus Petrus nicht nur aus dem Wasser zieht. Zwei Kapitel später erzählt das Matthäusevangelium, dass Jesus dem Apostel sogar zusagt, auf ihn wolle er die „Gemeinde bauen, und die Pforte der Hölle sollen sie nicht überwinden“ (Matthäus 16, 18).
Aber die Zukunft der Kirche kann nur im Team gestaltet werden. Denn: „Im Schiff, das sich Gemeinde nennt, … muss eine Mannschaft sein, sonst ist man auf der weiten Fahrt verloren und allein.“ Jedes Besatzungsmitglied muss an Bord tun, was seine Berufung und Aufgabe ist. „Und was die Mannschaft auf dem Schiff ganz fest zusammenschweißt in Glaube, Hoffnung, Zuversicht, ist Gottes guter Geist.“
Jürgen Wandel
Jürgen Wandel ist Pfarrer, Journalist und ständiger Mitarbeiter der "zeitzeichen".