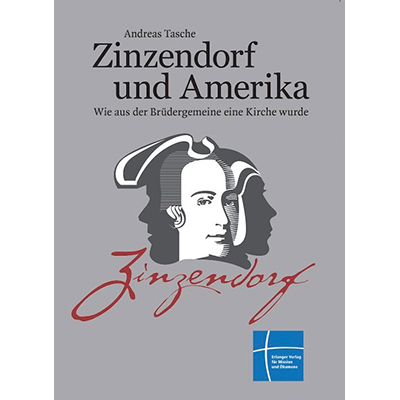Die christliche Freiheit weist die drohende Forderung zurück. Sie setzt stattdessen auf die authentische Liebe zum Nächsten, und zwar dem jeweils eigenen Urteil gemäß. Von diesem Gedanken Martin Luthers ausgehend, beschreibt Gesche Linde, Professorin für Systematische Theologie an der Universität Rostock, den lutherischen Freiheitsbegriff. Dieser führt sie auch zu Nachfragen im Blick auf das kirchliche Handeln vor dem und während des Corona-Lockdowns.
Unter den zahllosen Texten Luthers sind es zwei, die ihr Autor als von besonderer Bedeutung kennzeichnete, und auffälligerweise sind beide dem Freiheitsthema gewidmet: der kurze Traktat De libertate christiana, deutsch Von der Freiheit eines Christenmenschen, entstanden 1520 im Rahmen des gegen Luther eingeleiteten Exkommunikationsverfahrens, und die ausführliche Streitschrift De servo arbitrio, Vom unfreien Willen, verfasst 1525 als detaillierte Entgegnung auf Erasmus von Rotterdams De libero arbitrio. Bereits die Überschriften lassen erkennen, dass Luthers Interesse nicht einem philosophischen, sondern einem theologischen, in erster Linie an Paulus geschulten Freiheitsbegriff gilt. Die christliche, nämlich die aus dem Glauben an das Evangelium erwachsende und daher alles andere als „natürlich“ zu klassifizierende Freiheit besteht darin, dass der Glaubende, der sich selbst als unabhängig von allen Frömmigkeitsleistungen vor und durch Gott gerechtfertigt versteht, von der erdrückenden, da unerfüllbaren Forderung „guter Werke“ – in Luthers (historisch betrachtet so nachvollziehbarer wie unglücklicher) Terminologie: dem „Gesetz“ – befreit ist.
Weshalb ist die Forderung guter Werke als Voraussetzung des Gerechtfertigtseins vor Gott unerfüllbar? Weil sie es, vereinfacht gesagt, verhindert, die Interessen des Nächsten in authentisch uneigennütziger Weise in den Blick zu nehmen, und stattdessen lediglich einen gut getarnten Egoismus evoziert.
Daher ist es konsequent, wenn Luther im zweiten Teil des Freiheitstraktats als Folge der christlichen Freiheit vom „Gesetz“ den rechtverstandenen Dienst am Nächsten thematisiert: Erst der befreiende Glaube an das eigene Gerechtfertigtsein unabhängig von religiösen Leistungen – und, so die radikale These, nur dieser Glaube – erlaubt die genuine Zuwendung zum Nächsten. Eine solche Zuwendung, daran lässt Luther keinen Zweifel, ist der Christenmensch seinem Nächsten schuldig: Doch erst der Glaube ist es, der sie ermöglicht.
Auf diese Weise ist der Kontext abgesteckt, in dem nach Luther ein christlicher Freiheitsbegriff zu verorten ist: Die christliche Freiheit erlaubt die Zurückweisung einer jeden heteronomen Forderung im Modus der Drohung, der ihrerseits nur mit einem angstmotivierten Akt des Gehorsams zu entsprechen wäre; sie manifestiert sich als authentische, spontane, unbelastete und geradezu fröhliche Liebe zum Nächsten, und zwar dem jeweils eigenen Urteil gemäß: im Sinne von Gewissensfreiheit. Dieser Kontext unterscheidet sich erkennbar von dem bereits in der griechischen Antike debattierten philosophischen Problem der menschlichen Willens- oder Handlungsfreiheit. Diesbezüglich vertritt Luther gegenüber Erasmus die extreme Position, dass dem Menschen keinerlei Vermögen der Wahl zukomme.
Gut oder böse
Diese schon damals anstößige These wird nur dann verständlich, wenn man berücksichtigt, dass für Luther erstens Wahl die Wahl zwischen Gut und Böse bedeutet und dass für ihn zweitens jedwede Wahl und jedwede Handlung ethisch besetzt sind, sich also stets die Frage nach dem Guten oder Bösen stellt. In diesem Sinne entlehnt Luther im Sermon von den guten Werken, ebenso wie der Freiheitstraktat 1520 entstanden, ein Beispiel des Thomas von Aquin, um seine von Thomas abweichende Haltung zu verdeutlichen: Ob man, so Thomas, in die Stadt gehe oder nicht, ob man einen Grashalm aufhebe oder nicht, sei ethisch irrelevant. Dem hält Luther entgegen, dass es sich bei dem Aufheben des Strohhalms dann um ein gutes Werk handele, wenn es von der „zuvorsicht“ begleitet sei, „das es gote gefalle“ (WA 6, 206, 9f.). Umgekehrt gilt dementsprechend: „ist die zuvorsicht nit da odder tzweifelt dran, szo ist das werck nit gut“ (WA 6, 206, 11f.).
Luthers Überlegung, dass es aus theologischer Perspektive keine ethisch neutralen Handlungen gebe, stellt eine direkte Konsequenz aus der These dar, dass es allein der Rechtfertigungsglaube sei, an dessen Vorliegen sich entscheide, ob eine gegebene Handlung als Liebe (und damit als gut) gelten dürfe oder nicht. Da nun aber der Rechtfertigungsglaube nicht in der Macht des Subjekts steht – da es nicht in der Macht des Subjekts steht, an das eigene Gerechtfertigtsein vor Gott jenseits aller Werke zu glauben –, steht es auch nicht in der Macht des Subjekts, sich zum Guten zu entscheiden: zur Liebe dem Nächsten gegenüber. Anders gesagt: Der natürlicherweise auf die Durchsetzung seiner eigenen Interessen fixierte Mensch ist deshalb nicht in der Lage zu wählen – und das heißt: das Gute als das dem Bösen Entgegengesetzte zu wählen –, weil sein Wille immer schon ein auf ihn selbst ausgerichteter ist, also immer schon das Böse gewählt hat, und gegen den so ausgerichteten Willen kein zweiter Wille als Korrektiv in Stellung gebracht werden kann. Vielmehr ist es Gott, der die Ausrichtung des Willens bestimmt und damit über Glaube oder Unglaube sowie über die Güte des jeweils korrespondierenden Werkes entscheidet.
Dass dieser facettenreiche Freiheitsbegriff nicht für den Schreibtisch entworfen wurde, sondern für Luthers Praxis handlungsorientierend war, zeigt sich auch an seinen Empfehlungen anderen gegenüber im Jahre 1527, als wieder einmal die Pest in etlichen Gebieten auftrat. Vom Breslauer Reformator Johann Heß, Pfarrer an der dortigen Magdalenenkirche, schriftlich befragt, Ob man vor dem Sterben fliehen möge, ob also Christen bei Seuche die Stadt verlassen dürften, antwortet Luther unter dem Leitaspekt der Verpflichtungen anderen gegenüber: Es war ein Leitaspekt, den er in seinem Freiheitstraktat thematisiert hatte, nämlich dass die Dienstbarkeit dem Nächsten gegenüber aus dem Glauben resultiert. Privatpersonen haben Verpflichtungen gegenüber Angehörigen, Freunden, Nachbarn; Amtspersonen – Pfarrer wie Magistrat, ebenso Ärzte et cetera – haben Verpflichtungen ihren Gemeinden gegenüber. Dort, wo ihre Aufgaben nicht durch andere wahrgenommen werden können, wo also eine Flucht Not und Schaden verursachen würde, sind sie es den Gefährdeten schuldig zu bleiben: „Denn wo einer […] liesse seinen nehesten so ligen ynn nöten und flohe von yhm, der ist fur Gott ein mörder“ (WA 23, 353, 14f.). Dort hingegen, wo sie ersetzbar sind oder sich vertreten lassen können, liegt es in der Freiheit der Gewissen, sich zur Flucht zu entscheiden oder nicht. Der Maßstab für die Entscheidung besteht in dem Wohl Anderer; ist das Wohl Anderer nicht betroffen, darf auch der Christenmensch sich der Gefahr entziehen, wenn er dies für richtig hält: zumal dann, wenn sein Glaube nicht stark genug ist, um sich der Angst um sich selbst entledigen zu können.
In diesem Sinne sollte Luther selbst sich im Frühling 1530 zwar nicht zu einer Flucht entschließen, doch immerhin zu der Unterlassung einer Reise an das Sterbebett seines – von seiner Mutter und seinem Bruder Jacob versorgten – Vaters in Mansfeld (einer Reise, die je nach Wetterlage zwei bis vier Tagesreisen in Anspruch genommen hätte), und zwar aus Vorsicht angesichts seiner politischen Gefährdung. Bei aller geschichtlichen Distanz erscheinen an Luthers Replik auf die Anfrage Heß’ doch folgende fünf Punkte als bedenkenswert.
Achtsam sein
Erstens: Die Sorge um Leib und Gesundheit ist nichts Verwerfliches. Diesen Aspekt hatte Luther bereits im Freiheitstraktat angesprochen: Mit dem eigenen Leib, als einem Medium der Sozialbeziehungen, ist achtsam umzugehen; das Verhältnis zu ihm hat der Christenmensch, abermals im Sinne der Gewissensfreiheit, aktiv zu gestalten. Auch deshalb gehört Flucht vor physischer Gefahr, sofern Andere nicht geschädigt werden, durchaus zu den Handlungsoptionen eines Christenmenschen. Gegenüber Heß empfiehlt Luther zudem öffentliche Maßnahmen, etwa die Einrichtung von Spitälern, um die Notlazarette in den Privathäusern der Bürger zu vermeiden (auch Luther selbst hatte Kranke aufgenommen), oder die Verlegung der Friedhöfe außerhalb der Stadt.
Zweitens: Luther kann die Absonderung der Kranken unter Berufung auf 3. Mose 13, 46 durchaus empfehlen – dies jedoch so, dass die Kranken dabei nicht zu stummen Objekten behördlicher Anordnungen werden, sondern Subjekte selbstverantworteten Handelns bleiben: „das so sie [sc. die Krankheit] yemand kriegt, sich als balde von den leuten selbst thu odder thun lasse“ (WA 23, 369, 23f.). Ein solcher Appell an das Einverständnis der Betroffenen mit Isolationsmaßnahmen setzt immerhin die Möglichkeit als real voraus, dass sich das Einverständnis auch verweigern lässt. Luther rechnet sogar mit der Möglichkeit, dass die Kranken Hilfe bewusst ablehnen: „Da acht ich, sey es frey beyde zu fliehen und zu bleyben.“ (WA 23, 347, 1.) Dieselbe Selbstverantwortlichkeit mutet Luther andernorts den Sterbenden zu. Es obliegt einem jedem, beizeiten – und nicht erst in der letzten Lebensstunde – Abschied zu nehmen: seine Hinterlassenschaft so zu regeln, dass keine Zwistigkeiten entstehen, sich mit denen zu versöhnen, mit denen man sich überworfen hat, und sich regelmäßig der Predigt des Evangeliums und dem Empfang des Abendmahls auszusetzen.
Drittens: Die (Selbst-)Absonderung der Kranken bedeutet nicht die Verweigerung von Hilfe oder die Isolation der Kranken von Helfern. Luther selbst, der ebenso wie seine Zeitgenossen um die Gefährlichkeit physischer Kontakte in Zeiten der Pest genau wusste und jede Mutwilligkeit mit scharfen Worten als Versuchung Gottes ablehnte, kam es offenbar nicht in den Sinn, sich mit der Begründung von Kranken fernzuhalten, dass er auf diese Weise sich selber schütze oder eine Weitergabe des Erregers an Andere verhindere. Den Primat hat vielmehr der Anspruch des bereits Erkrankten auf Zuwendung: „Da sol man yhm helffen und ynn solcher not nicht lassen“ (WA 23, 369, 25f.).
Zwar bezieht Luther sich hier auf körperliche Pflege und medizinische Behandlung, die im Erfolgsfall ebenso der Gemeinschaft zugutekomme; doch in einer Zeit, in der die Phase des Alterns sich weitaus länger hinzieht und in der sehr viel mehr Menschen Hochaltrigkeit erreichen als im 16. Jahrhundert, lohnt die Erinnerung daran, dass Not auch andere Formen annehmen kann als die der bloßen Pflegebedürftigkeit. Die Kontakteinschränkungen unserer Tage treffen am empfindlichsten die Bewohnerinnen und Bewohner von Alten- und Pflegeheimen, die infolge der Isolation das Sprechen verlernen, deren geistige Auffassungsgabe leidet, die ihren Angehörigen und Freunden entfremdet werden und die zuletzt einsam und ungetröstet sterben. Angesichts einer solch offenkundigen Inhumanität bleibt es eingestandenermaßen unbefriedigend, „unauflösliche Zielkonflikte“ zwischen Wunsch nach Nähe und Lebensschutz zu konstatieren (so der EKD-Ratsvorsitzende Heinrich Bedford-Strohm in der FAZ vom 25.5.2020).
Viertens: Luther vertritt keinen Determinismus von Handlung und Handlungsfolge, sondern rechnet mit dem Unkalkulierbaren. Wer sich in die Nähe von Kranken begibt, muss nicht zwangsläufig selbst krank werden, und wer umgekehrt die Stadt verlässt, um sich in Sicherheit zu bringen, mag dennoch umkommen. Der Gedanke an die Allwirksamkeit Gottes, den Luther in De servo arbitrio so sehr in den Vordergrund gestellt hatte, führt auf diese Weise keineswegs zu Fatalismus – Luther besteht auf aller gebotenen Vorsicht –, wohl aber zu Gelassenheit: „Darnach wil ich auch reuchern, die lufft helffen fegen, ertzney geben und nemen, meiden stet und person, Da man mein nichts darff, auff das ich mich selbs nicht verwarlose und dazu durch mich villeicht viel andere vergifften und anzunden möchte und yhn also durch meine hinlessickeit ursach des todes sein. Wil mich mein Gott daruber haben, so wird er mich wol finden: so hab ich doch gethan was er mir zu thun gegeben hat, und bin widder an meinem eigen nach ander leute tode schuldig. Wo aber mein nehester mein darff, will ich widder stet noch person meiden, sondern frey zu yhm gehen und helffen […]. Sihe das ist ein rechter Gottfurchtiger glaube, der nicht thumkune [dummdreist] noch frech ist und versucht auch Gott nicht.“ (WA 23, 365, 31 – 367, 9.)
Und fünftens: Luther hält trotz Ansteckungsgefahr oder gerade „ynn solchen sterbens leufften“ (WA 23, 371, 8) an Gottesdiensten fest, weil ihm zufolge nur hier Menschen „Gotts wort [lernen], wie sie leben und sterben sollen“ (WA 23, 371, 371, 11f.). Angesichts einer solchen Unbeirrbarkeit fällt die Bereitwilligkeit auf, mit der kirchlicherseits während der Coronakrise mancherorts noch vor den staatlichen Verboten auf Gottesdienste verzichtet wurde. Trotz unleugbar bester Absicht befremdet diese Bereitwilligkeit nicht nur insofern, als Gesundheitsschutz und Gottesdienst sich bei entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen zu keiner Zeit hätten ausschließen müssen, sondern sie wirft auch die Frage auf, wie die Kirchen ihre Gottesdienste heute verstehen und welchen Sinn sie ihnen beimessen. Der Feststellung der EKD-Orientierungshilfe zu Verständnis und Praxis des Gottesdienstes in der evangelischen Kirche aus dem Jahre 2009 wird jedenfalls kaum zu widersprechen sein: „[…] bei allen Veränderungen im Lebensrhythmus vieler Menschen bleibt der verlässlich gefeierte Gottesdienst an Sonn- und Feiertagen von großer Bedeutung.“
Gesche Linde
Gesche Linde ist Professorin für Systematische Theologie an der Universität Rostock.