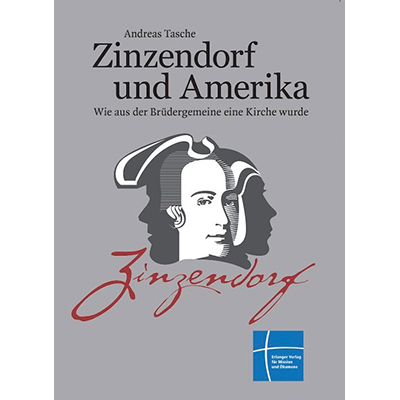Parade für eine Heilige Schrift

Neulich war in Berlin etwas ganz Besonderes auf der Straße zu erleben: Die Entgegennahme einer neuen Torarolle durch Mitglieder der jüdischen Chabad-Lubawitsch-Bewegung. Die Berliner Religionswissenschaftlerin Liane Wobbe war dabei und führt in ihrem Beitrag in die Welt dieser besonderen, aber auch umstrittenen religiösen Gruppe ein.
Vor den Räumen eines jüdischen Gemeindehauses in Berlin-Mitte warten viele festlich gekleidete Gäste: Frauen mit langen, schicken Kleidern, Männer mit schwarzem Anzug, Bart und schwarzem Hut oder einer Kippa auf dem Kopf. Kinder rennen aufgeregt umher. Heute wird hier Hachnasat Sefer Tora gefeiert, die Einweihung einer neuen Torarolle, der Heiligsten Schrift im Judentum.
Ein Mann, der aus Israel stammt, erklärt: „Unsere Gemeinde erhält heute eine neue Tora. Bisher hatten wir nur geliehene.“ Bei der Ankunft einer neuen Torarolle ist es üblich, dass die letzten Buchstaben des 5. Buches Mose von einem Sofer, einem zertifizierten Schreiber, gesetzt werden. Dabei dürfen volljährige Männer, die eine Bar Mizwa hinter sich haben, an dieser Vollendung mitwirken, indem sie den Arm des Sofers berühren. Nun geht es los, alle schauen gebannt auf den Sofer, der behutsam die Feder auf das Blatt setzt und den Buchstaben kunstvoll zu Papier bringt. Ein 15-jähriger Junge begleitet ihn dabei. Ihm folgen mindestens zwanzig weitere Männer, so dass sich das Vollenden der Tora zwei Stunden lang hinzieht.
Währenddessen strömen immer mehr Menschen herbei, unterhalten sich in Englisch, Hebräisch und Russisch, wenige in Deutsch. Frauen und Männer begrüßen sich, Kinder spielen, lachen, schreien, schlafen auf den Armen ihrer Mütter oder Väter.
Mein Gesprächspartner zeigt auf eine Familie, die gerade den Raum betritt und sagt: „Diese Familie ist aus der Ukraine. Zu uns kommen alle, wir sind hier eine Gemeinde.“ Im Hintergrund läuft moderne israelische Musik. Die Torarollen werden nun in ein Samtgewand gerollt, unter Zurufen hochgehalten und zum Ausgang getragen. Auf dem Arm eines Rabbiners und beschirmt von einem Baldachin prozessiert die ummantelte Schriftrolle jetzt durch die anliegende Straße, umringt von weiteren Rabbinern, die dazu singen und tanzen, sich um die Schulter fassen, im Kreis drehen und in die Höhe hüpfen. Einige kleine Jungen führen den Prozessionszug mit Fackeln an, die mitlaufenden Besucher klatschen dazu.
Wieder im Gebetshaus angelangt, erfolgt die zeremonielle Einweihung, bei der die alten Torarollen symbolisch die neue begrüßen. Wieder tanzen die Männer im Kreis, sie springen und singen, immer schneller, immer höher, die Torarollen tanzen mit. Im Nachbarraum haben sich die Frauen und Kinder versammelt, essen Kuchen, plaudern, schauen den Männern beim Tanzen zu und klatschen, bis eine Frau die anderen Frauen an den Händen fasst und sich auch hier ein tanzender Reigen bildet. Nach einer Bonbonschlacht der Kinder wird die Zeremonie mit einem großen Festmahl beendet.
Getragen wie eine Königin
Eine Prozession tanzender und singender Rabbiner auf der Straße – ein seltenes Bild der Berliner Juden, die sich sonst, meist streng bewacht auf Hinterhöfen und hinter Synagogenmauern versammeln. Doch wer sind die jüdischen Frauen, Männer und Kinder, die eine Schriftrolle wie eine Königin durch die Straße tragen und freudig begrüßen? Es handelt sich dabei um Mitglieder der orthodoxen und mystisch ausgerichteten Chabad-Lubawitsch-Bewegung. Ihre Anhänger werden weltweit auf 200 000 geschätzt. Sie gehören zu den international einflussreichsten jüdischen Gruppen und sind in über 100 Ländern aktiv, während sich ihre Zentrale in New York befindet. In Deutschland existieren etwa 70 Gemeinden.
Der Name selbst ergibt sich aus Chabad, einem hebräischen Akronym der drei göttlichen Attribute Chochma-Weisheit, Bina-Vernunft und Da’at-Wissen, und Lubawitsch ist abgeleitet von dem russischen Dorf Ljubawitschi (heute Oblast Smolensk), einst Hauptzentrum der Bewegung. Der osteuropäischen Gemeinschaft zugrunde liegt der Chassidismus (hebräisch: hassidut, Frömmigkeit), eine Frömmigkeit, die eher auf ekstatische und spontane Gottesverehrung als auf ein regelmäßiges Schriftstudium setzt. Unter dem Einfluss des Rebben Baal Schem Tov und seines Schülers Dov Bär breitete sich der Chassidismus im 18. Jahrhundert in Litauen und Zentralpolen aus. Die Rebben wanderten umher, predigten den Juden ein mystisches Verständnis der Tora und ermunterten sie zu einem fröhlichen, ekstatischen Lobpreis Gottes, der sich in Liedern und Tänzen ausdrückt. Aus ihrer Schülerschaft entwickelte sich die Chabad-Bewegung mit einer Dynastie von sieben Rebben, die ihr Amt an den Sohn, Schwiegersohn, Neffen oder Enkel weitergaben und ihren Hauptsitz in Ljubawitschi hatten. Mit der Flucht des sechsten Rebben, Yossef Yitzak Schneerson (1880 – 1950) nach New York endete 1915 die Lubawitscher Zeit, und Hauptsitz ist seitdem der Eastern Parkway 770/Crown Heights in Brooklyn. Siebenter Rebbe wurde hier 1951 Schneersons Schwiegersohn Menachem Mendelssohn Schneerson (1902 – 1994). Dieser erlangte weltweite Berühmtheit mit nächtlichen Empfängen von Besuchern, die mit persönlichen Anliegen zu ihm kamen und denen er mit einem Rat oder Segen half. Auch sandte er tausende Rabbiner und ihre Frauen als Paare (Schluchim) in andere Länder, um „Jüdischkeit“ in die Welt zu tragen. Für sein Engagement in Bezug auf Bildung, Moral und Wohltätigkeit erntete Schneerson außerhalb jüdischer Gemeinden so hohe Anerkennung, dass ihm 1994 der US-amerikanische Kongress die Congressional Gold Medal verlieh. Schneersons Vorträge zum Judentum werden heute weltweit zur täglichen Erbauung im Internet verschickt. Sein Grab in New York gilt als Heiliger Ort (Ohel), an dem die Pilger Briefe mit ihren Bitten niederlegen und immer noch auf seine Hilfe hoffen.
Die Lehren Menachem Mendelssohn Schneersons haben höchste Priorität bei den Lubawitschern, und 10 Gebote (Mizwot), die er in einer Kampagne ausrief, bilden bis heute deren Verhaltenskodex: Im ersten bis dritten Gebot ist davon die Rede, wie der Mensch mit zahlreichen Zeremonien sein Haus heiligen und als Tempel Gottes behandeln soll. Zur Erinnerung an den Feiertag der Woche rät Schneerson allen Mädchen und Frauen, die Schabbatkerzen anzuzünden. Zum Zeichen des Bundes mit Gott sollen Männer sich zum Morgengebet Tefilin (Lederboxen mit Heiligen Versen) an Kopf und Oberarm binden. Und zur Heiligkeit des Hauses empfiehlt der Rebbe das Anbringen einer Mesusa, einer Schatulle mit einem Segensspruch, am Eingang der Haustür. Denn: „Eine Tür ist ein Durchgang von einem Gebiet zum anderen. Die Mesusa ist das Manuskript für diesen Durchgang.“
Im vierten und sechsten Gebot legt Schneerson den Juden nahe, viele jüdische Bücher zu besitzen, mindestens aber die Tora, den Talmud (Kommentar zu 613 Geboten der Tora) und den Siddur, das Gebetbuch. Als Basiswerk für Chabad-Juden empfahl er das Buch Tanja, das vom ersten Rebben Schneur Zalman verfasst wurde und auf der Basis jüdischer Mystik die Verbindung zwischen Gott und Seele erklärt. Im siebten Gebot geht es um die rituelle Reinheit (Kaschrut). Im Judentum Teil des Gesetzes, erfährt sie bei den Chabadniks zudem eine mystische Dimension. So werden alle rituellen Waschungen, sei es das Händewaschen vor dem Essen oder das Tauchbad in der Mikwe, als spirituelle Erneuerung gesehen. In seinem siebten Gebot empfiehlt der Rebbe, sich ausnahmslos koscher zu ernähren, damit die Gesundheit an Leib und Seele erhalten bleibt und das Judentum Teil der eigenen Existenz wird. Mit dem Segen über die Speisen erhöht der Mensch die Nahrungsaufnahme außerdem zu einer göttlichen Erfahrung.
Ehe mit göttlichem Status
Die Ahawat Jisrael, die Liebe zum Mit-Juden, erklärte Schneerson zum achten Gebot. In diese Rubrik fällt auch die Zedaka, das fünfte Gebot der Wohltätigkeit und Gerechtigkeit. Danach sollte jeder regelmäßig mit großzügigen Geldspenden zu einer gerechten Verteilung in der Welt beitragen. Im neunten und zehnten Gebot ermutigt schließlich Schneerson Menschen jüdischer Herkunft, den Familienalltag nach jüdischen Gesetzen zu leben. Das betrifft die Kindererziehung wie die Ehe. Kinder sind ein Segen, die meisten Chabad-Familien haben sechs bis zehn. Sie sollten eine jüdische Ausbildung genießen. Paare sollten eine jüdische Ehe führen, damit diese einen göttlichen Status erhält.
Im Unterschied zu anderen jüdischen Traditionen geht es den Chabad-Gläubigen um das Verstehen der inneren Dimension der Tora. Ihrem Menschenbild zufolge gehört der Mensch mit seinem Körper zur materiellen und mit seiner Seele zur himmlischen Welt. Die Seele, welche ewig als Funke des unendlichen göttlichen Lichtes (Or Ein Sof) existiert, wird in einen Körper geboren mit dem Auftrag, Fehler aus vergangenen Leben zu korrigieren und bestimmte Aufgaben zu erfüllen, bis sie sich vervollkommnet hat. Dieser Glaube an eine stufenweise Wanderung der Seele (Gilgul) kann dazu dienen, sich individuelle Lebenssituationen zu erklären.
Ein Hauptanliegen der Chabad-Bewegung ist die Vorbereitung auf das Erscheinen des Messias, eines Königs von Israel, der den Tempel in Jerusalem wieder aufbauen wird. Chabad-Anhänger sollten während ihres Daseins alles daransetzen, mit dem Halten der jüdischen Gebote an einer besseren Welt mitzuwirken, um das Kommen des Messias zu beschleunigen.
Mit ihren Gebetshäusern grenzen Chabad-Juden sich von den Synagogen ab, die ihrer Meinung nach die Liturgien christlicher Gottesdienste adaptieren. Chabad-Häuser sind täglich von morgens bis spät in die Nacht geöffnet und laden die Gläubigen ein, sich jederzeit dort aufzuhalten, Gott zu preisen, sich auszutauschen und Heilige Schriften zu studieren. Die Atmosphäre ist offen und familiär. Während Erwachsene beten, flitzen Kinder durch die Räume. Frauen und Männer sitzen getrennt, essen aber anschließend gemeinsam. Der wöchentliche Schabbat, der am Freitagabend beginnt und am Samstagabend endet, ist ein wahrer Feiertag. Zwei Gottesdienste finden statt, am Freitagabend und am Samstagvormittag. Festlich begangen wird auch der Kiddusch, das gemeinsame Essen danach. Gäste aus Israel, Einwanderer aus Russland, Geflüchtete aus der Ukraine, Touristen aus New York sitzen dann gemeinsam an einer langen Tafel und plaudern angeregt bei einem Drei-Gänge-Menü mit osteuropäischen und orientalischen Speisen. Dann stimmt der Rabbiner ein Lied an, und die Gäste singen mit, klatschen in die Hände oder klopfen im Takt auf den Tisch. Es wird Wodka und Wein eingeschenkt, gegessen und getrunken und Gott gelobt in der sie alle vereinenden Sprache: Hebräisch.
Seit Menachem Mendel Schneerson gehen tausende junge Rabbiner mit ihren Frauen als Gesandte (Schluchim) in die Welt, um säkulare oder liberale Juden zu ermuntern, mehr „Jüdischkeit“ in einer nichtjüdischen Umgebung zu praktizieren. Sie gründen Chabad-Zentren in den entlegensten Gegenden, sei es in Alaska, China, Ghana oder Bahrain. Während der Rabbiner die rituellen Aufgaben innehat, leitet dessen Frau den Religionsunterricht für Kinder und bietet Kurse an für die Frauen der Gemeinde. So gelang es den Lubawitschern, für weltweite Präsenz zu sorgen. Auch in Deutschland ziehen Chabadfamilien jedes Jahr im Dezember die Aufmerksamkeit auf sich, wenn sie in Städten zu den Chanukkafeiertagen haushohe Chanukkaleuchter aufstellen, sieben Tage lang bei Sonnenuntergang die Lichter zünden und dazu hebräische Lieder singen, so vor dem Brandenburger Tor in Berlin.
Mit reichhaltigen Schabbat-Mahlzeiten und Mizwot-Kampagnen werben Chabadanhänger damit, den Juden verschiedener Richtungen eine religiöse Heimat zu bieten. Damit alte Gesetze zu einem leicht anwendbaren Lifestyle werden, informieren Kurse, Bücher und Onlineinformationen, wie man die Küche koscher hält, den Kindern spielerisch jüdische Traditionen vermittelt oder eine jüdische Ehe führt. Auch karitatives Engagement zeigen die Lubawitscher mit eigenen Wohltätigkeitsverbänden, die den Menschen in Krisengebieten bei Versorgung, Flucht oder Aufnahme helfen.
Beharrlichkeit und Charisma
Chabad-Juden pflegten seit Gründung der Bewegung gute Beziehungen zu Regierungsvertretern eines Landes und genossen deshalb meist auch deren Wohlwollen und finanzielle Unterstützung. Dies ist bis heute so geblieben. Sie treten als Repräsentanten eines zwar konservativen, aber doch weltoffenen Judentums auf. Vielleicht sind es gerade die Beharrlichkeit und das Charisma so vieler Chabad-Rabbiner, mit denen es der Bewegung gelingt, Menschen zu überzeugen und weltweit Fuß zu fassen.
Das Engagement der Lubawitscher sorgt aber nicht nur für den eigenen Erfolg, sondern auch für Kritik säkularer, liberaler, ja auch orthodoxer jüdischer Vereine. Als Grund wird oft die Vereinnahmung anderer Gemeinden angegeben. Einige jüdische Richtungen werfen den Chabadniks Personenkult der Rebben vor, der Zentralrat der Juden wiederum bemängelt deren unwissenschaftliche und an der Mystik orientierte Rabbinerausbildung. Diese Kritikpunkte mögen ihre Berechtigung haben. Von außen betrachtet, kommt mit den Chabad-Anhängern aber erstmalig etwas zum Tragen, was im Judentum außerhalb Israels lange verborgen blieb: nämlich die Unterstützung einer selbstbewussten jüdischen Alltagspraxis in einer nichtjüdischen Mehrheitsgesellschaft sowie die Sichtbarkeit jüdischer Volksfrömmigkeit auf der Straße.
Liane Wobbe
Dr. Liane Wobbe ist Religionswissenschaftlerin und Indologin. Sie lebt in Berlin.