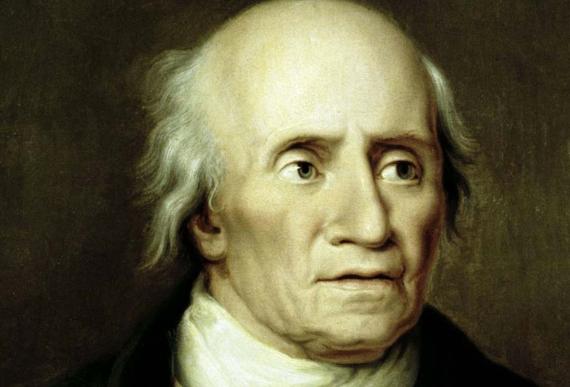Am 30. Juli 1865 kommt die Nachricht des Tages aus Rom. Als sie durch ist, mit Balken, Kapitälchen, Ausrufungszeichen eingerückt in die Gazetten und Mitteilungsblätter der kulturell Interessierten, ist Europa, das geistige Europa, für einen Moment sprachlos. Und fragt sich schon im nächsten Moment, ob es nun lachen oder weinen soll? Franz Liszt ist in den geistlichen Stand getreten. "Von Liszt, dem Tonkünstler", kommentiert betreten der zeitgenössische Musikhistoriker August Wilhelm Ambros, "war man plötzliche Ausweichungen in fremdeste Tonarten gewohnt, bei denen Musiker strenger Observanz in die Höhe fuhren, aber die Modulation, welche Liszt jetzt auch in seinem Leben so plötzlich machte, hatte kein Mensch erwartet."
An so etwas wie Berufung glaubte jedenfalls kein Mensch. Liszts Beinahe-Ehefrau, die fanatisch katholisierende Carloyne von Sayn-Wittgenstein ausgenommen, gab es eigentlich niemanden, selbst nicht Liszts tief erschütterte, in Tränen aufgelöste Mutter, der bereit gewesen wäre, ihm besagte "Modulation" abzunehmen. "Maskerade", tuschelte man hinter mehr oder weniger vorgehaltener Hand. So etwa Kurd von Schlözer, der als Sekretär des preußischen Gesandten am Heiligen Stuhl jedenfalls nah genug an Liszt dran war und dem wir so manche Schlüsselloch-Perspektive verdanken. Am 20. April glaubte von Schlözer sogar, im Palazzo Barberini Liszts letztes öffentliches Konzert gehört zu haben. Das anspielungsreiche Programm, Schuberts Erlkönig und Webers Aufforderung zum Tanz in eigenen Transkriptionen, dechiffrierte er, nicht anders wie Ferdinand Gregorovius, als "Abschied von der Welt". "Bald wird er Monsignore sein", orakelte der Diplomat.
Umzug in den Vatikan
Gewiss, der immer katholischer anmutende Auftritt und Lebenswandel des wie Gregorovius sagt "Clavier-Centauren" war in Rom Stadtgespräch: Einzug ins Kloster Madonna del Rosario, Intensiv-Lektüre frommer Werke wie des Katechismus der Beharrlichkeit, schließlich sogar Umzug in den Vatikan, in eine Wohnung im Palast des Bischofs und späteren Kardinals Gustav Adolf zu Hohenlohe-Schillingsfürst. Nur eben, dass keiner so wirklich an diese Neuorientierung glauben mochte. "Eine seiner Bizzarrerien - für die Welt - damit sie sich mit ihm beschäftigt", meinte Gesandtschaftssekretär von Schlözer. Ein Marketingtrick im heutigen Sprachgebrauch also, den sich, so die Mutmaßung, der Künstler Liszt da herausnahm, was als Urteil über die römische Episode seines Lebens (1861 bis 1868) im Grunde bis heute Bestand hat. Liebend gern nämlich, weil es in den sensationell-aufbauschenden Duktus passt, tippen vor allem die pünktlich auf den Liszt-Jahr-Markt drängenden Biographen, diejenigen, die das "Musikgenie", den "Frauenschwarm", den "Superstar" sehen, auf Selbstinszenierung. Abbé Liszt mit römischem Kragen? Eine Lachnummer! Wirklich?
Einmal abgesehen von Liszts nicht zu bestreitender Vorliebe für den vestito, den Theater-Sinn um Kleid und Verkleidung - an der psychologisierenden Attitüde der Entlarvung, wonach im Grunde alles doch nur Show sei, kann man durchaus seine Zweifel haben. Zunächst wäre ja festzuhalten, dass Liszt auf seinem Pilgerweg einige nicht unwichtige Staustufen eingebaut hat. Die vierte, die unterste der heute nicht mehr vergebenen "niederen Weihen", die er im Juli 1865 in Tivoli, vor den Toren Roms, empfängt, machten ihn jedenfalls nicht zum Monsignore. Mit besagter Entscheidung war Liszt nicht Sub-, nicht Diakon, schon gar nicht Priester geworden. Er durfte weder Messen lesen noch Beichten abnehmen.
Vielmehr war er einzig berechtigt, dem Priester am Altar zu assistieren. Und der Klerikerstatus, den er damit erwarb, verpflichtete ihn zwar zu frommem Lebenswandel, zu angemessener Kleidung, zum Tragen der Soutane, aber nicht zum Zölibat. Und noch das Scheren der Tonsur, fünf Tage nach dem vermeintlich letzten Konzert, war bei näherer Betrachtung ein Akt von sehr diskretem Charme. Man sieht es ja auf den Fotos. Die Haarpracht, dieses Samson-Zeichen seiner Künstlernatur, ist zwar insgesamt kürzer geworden - von Schlözer meinte sogar, es stehe ihm gut -, aber einen Kranz hat sich Liszt vom Bischof zu Hohenlohe, der seine Ehepläne so kräftig hintertrieb, eben auch nicht verpassen lassen. Was entfernt wird, ist eine Fläche schätzungsweise in der Größe einer Zwei-Euro-Münze. Dass sich dieses Inselchen auf dem Haupte des Centauren problemlos überkämmen ließ, sorgt dann allerdings wiederum für reichlich Wasser auf die Mühlen der Selbstinszenierungstheoretiker.
Wozu das Prozedere?
"Da sieht man es ja!", heißt es. Was, bitteschön, sieht man? Dass Liszt noch in seinem Katholizismus ein Scharlatan ist? Umgekehrt könnte ein Schuh daraus werden, sofern wir zuzugestehen bereit wären, dass Liszt - Soutane hin, Tonsur, niedere Weihen her - an seinem Künstlertum festgehalten hat, festhalten wollte. Denn dass es ihm mit dem Eintritt in das "Haus", wie sich der zwielichtige Monsignore zu Hohenlohe ausdrückte, nicht ernst gewesen ist, sieht man ja gerade nicht.
Bliebe die Frage: Wozu das Prozedere? Was hatte es auf sich mit der ebenso offensiv wie ostentativ vorangetriebenen Wende im Habitus, im Auftreten? Was wollte, worauf hoffte und wovon träumte Liszt, als er 1861 seinen Lebensmittelpunkt von Weimar nach Rom verlegt? Kurz: Wie hängt der Abbé mit dem Künstler Franz Liszt zusammen?
Eine Frage, auf die man antworten können sollte, will man dem Menschen Liszt gerecht werden. Ein Mensch, der nun einmal wie die Dinge liegen, von seinen Wunderkindtagen an ein Künstler war. Und es blieb bis zum Lebensende, nur eben, dass er dieses Künstlertum an bestimmter Stelle seiner Vita mit seinem ererbten Katholizismus zusammenbringen, besser: auf eine neue Stufe heben wollte.
Selbst hat er darüber - vielleicht um das Schicksal nicht herauszufordern - nur vage, in Andeutungen gesprochen. "Der römische Aufenthalt", so einmal brieflich, "ist für mich kein beiläufiger; er bezeichnet sozusagen den 3. Abschnitt - wahrscheinlich den Abschluss - meines oft getrübten, doch immerhin arbeitsamen und sich aufrichtenden Lebens." Abschluss? Einiges spricht dafür, dass Liszt mit seinem römischen Aufenthalt einen Plan verfolgt hat. Einen, in dem dem lieben Gott, dem Papst zu Rom und, nota bene, ihm selbst eine wichtige Rolle zugedacht war. Denn hatte er dem an seinem Schicksal so interessiert sich zeigenden preußischen Diplomaten, als ihn dieser, gerade frisch gebacken zum Abbé, im Vatikan aufsuchte, nicht folgenden Satz gesagt? "Je leur montrerai ce que c'est que la musique en soutane." "Ich werde ihnen schon zeigen, was eine Musik in der Soutane ist." Ein Zaunpfahlwink, ohne Frage. Musik in der Soutane. Was das ist, was das sein kann und für wen, möchte man wissen? Und: Wem will er es zeigen? Schließlich: Von welchem Platz aus?
Auf den Spuren Palestrinas
Um mit der letzten Frage zu beginnen: Haargenau von dort gedachte Liszt seinen Plan zu entfalten, wo er von Schlözer seinen kleinen Rätselkanon aufgibt - im Vatikan, worauf sein Denken und Trachten geht, seitdem er 1861 in der Stadt anlangt. Bezeichnenderweise interessiert ihn ja weder das antike noch das Rom der Renaissance oder des Barock, nicht das säkulare, nicht das Rom Goethes - es ist vielmehr der Kirchenstaat, St. Peter und die Sixtinische Kapelle, die es ihm angetan haben. Was er dort, sofern man das bei so großem Abstand überhaupt noch nachvollziehen kann, werden wollte, war die Übernahme eines Postens, für den es bei Lichte besehen gar keine Ausschreibung gab noch geben konnte. Oder wie sollte das auch annonciert werden - eine Musikdirektion beim Vatikan? Damit aber, als Konzertmeister, als Organist-Pianist, vor allem aber - sein künstlerisches Lebensziel - als Komponist, im dritten Abschnitt seines Lebens als Komponist katholischer Kirchenmusik, wollte Liszt sein Lebenswerk krönen. Er wollte zwar nicht in der Nachfolge des Apostels stehen, wohl aber in der Palestrinas, der im 16. Jahrhundert als Komponist der päpstlichen Kapelle und Kapellmeister der Peterskirche wirkte und die Kirchenmusik erneuerte. Katholisch sein und Künstler bleiben, mit Musik, die an der Gregorianik, an Palestrinas Höhe Maß nimmt. Mit der Kunst für die Kirche - in der Kirche für die Kunst.
Ein ehrgeiziges Programm, eine Vision, deren Verwirklichung ihm aber nicht beschieden war. Doch Liszt versucht es, umso mehr da ihm das kompositorische Feld nördlich der Alpen durch seinen späteren Schwiegersohn Richard Wagner und dessen musikdramatische Revolution schon bestellt erschien. Dagegen, daneben ließ sich, soviel war Liszt klar, nichts ausrichten.
Also nach Rom, sagte er sich. Unterstützt, ermuntert von der Fürstin Sayn-Wittgenstein trug er dazu das Seine bei. Nach Kräften. Und, aus solcher Perspektive betrachtet, erscheint seine auf den ersten Blick so rätselhafte römische Zeit auf den zweiten weit weniger rätselhaft. Liszts viel belächeltes, nicht selten verspottetes Abbé-Werden könnte sich so als Teil einer höchst sublim in die Wege geleiteten Bewerbung entpuppen. Denn was lag, derartige Absichten unterstellt, näher als sich bei der Kurie, beim Papst in Empfehlung zu bringen?
Am besten mittels einer die Person nicht ausklammernden Anverwandlung einerseits, mit einer nach Qualität und Quantität dem Erbe Palestrinas ebenbürtigen Kirchenmusik andererseits - natürlich aus eigener Kompositionswerkstatt. Als Liszt von Schlözer gegenüber das Wort von der musique en soutane fallen lässt, ist er denn auch längst mitten in der Arbeit. Schon im August desselben Jahres 1865 dirigiert er im neuen Redoutensaal im ungarischen Pest, selbstredend in der Soutane, die Uraufführung seines Oratoriums Legende von der Heiligen Elisabeth.
"Zu einer Hälfte Zigeuner, zur andern Franziskaner."
Im Januar des Folgejahres, zurück in Rom, erlebt Liszt die Uraufführung des "Stabat mater" aus dem Oratorium Christus, seinem katholischen opus summum, das er im Herbst 1866 abschließen wird. Dessen erster Teil, ein zweifellos auf Bach anspielendes Weihnachtsorartium, wird erstmals in Roms Sala Dante im Juli 1867 musiziert. Doch so sehr Papst Pius IX. davon Kenntnis nimmt, wie er überhaupt begeisterter Zuhörer mehrerer Privatkonzerte mit dem Pianisten Franz Liszt ist, die Bestellung zum Palestrina-Nachfolger unterbleibt. Warum, wissen wir nicht. Vielleicht, dass dem Heiligen Stuhl die heilige Kehrtwende des Franz Liszt am Ende doch nicht geheuer war - trotz römischem Kragen, Soutane und Soutanen-Musik.
Wofür Liszt schließlich selber Einiges beigetragen hat. Der fürstlichen Lebensgefährtin gesteht er jedenfalls einmal: "Zu einer Hälfte Zigeuner, zur andern Franziskaner." Hinzu kam, dass Pius in jenen Jahren des Risorgimento wahrlich andere Sorgen hatte. Schon wenige Jahre später, im Oktober 1870, sollte es mit der Autonomie seines Kirchenstaates zu Ende sein, geschluckt vom Königreich Italien.
So kam am Ende manches zusammen, dass die Sache für Liszt im Endeffekt nie richtig konkret wurde, was an dessen Christus-Oratorium nach Texten aus der Heiligen Schrift und der katholischen Liturgie sicher am wenigsten gelegen hat. Dessen vollständige, im Übrigen viel gerühmte Uraufführung erlebte im Mai 1873 denn auch nicht Rom, sondern Weimar, unter Leitung des Komponisten. Ironie der Geschichte: Nicht St. Peter, nicht die Sixtinische Kapelle sah und hörte Liszts katholische Soutanen-Musik zum ersten Mal, sondern die Weimarer Herderkirche. Und die war protestantisch.
Georg Beck