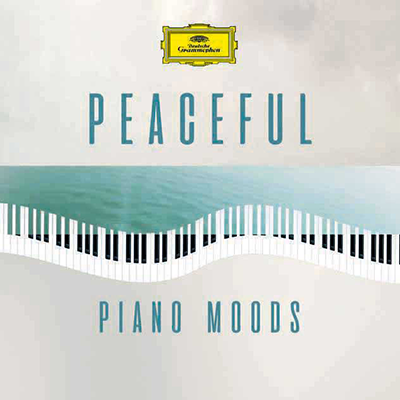Die Schrecken des Banalen

Nachdem die Philosophin Hannah Arendt den NS-Massenmörder Adolf Eichmann vor Gericht in Jerusalem erlebt hatte, formulierte sie 1963 die These, man könne an Verbrechern wie diesem Bürokraten sehen: Das extreme Böse sei weder etwas Tiefes oder Tragisches noch etwas Bemerkenswertes und Faszinierendes. Vielmehr sei das Böse in seiner äußersten Form eigentlich banal. Wie Arendt mit dieser These der Philosophie neue Türen öffnete, erklärt Christian Schäfer, Professor für Philosophie an der Universität Bamberg.
Wie die meisten philosophischen Theoriefelder unterliegt auch die Beschäftigung mit dem Bösen ständigen Präferenzenwechseln. Die Berliner Philosophin Susan Neiman hat vor einigen Jahren in einer vielbeachteten Wortmeldung zwei davon anschaulich an Ortsnamen zu binden versucht: Lissabon und Auschwitz. Das gewaltige Erdbeben, das im Jahr 1755 Lissabon zerstörte und seine Bevölkerung dezimierte, ließ, so Neiman, die davon tief beeindruckte und fassungslos zurückgelassene Schul-philosophie deprimiert vom Vorhaben einer Erklärung physischer Übel wie Naturkatastrophen oder Krankheiten abrücken. Es sollte fürderhin nur noch um die aus menschlicher Warte erreichbare Erklärung des Erklärbaren gehen, nämlich des moralischen, eben menschengemachten und daher dem Menschen einsehbaren Bösen. Doch die Illusion, wenigstens dieses vernünftig aufklären zu können, habe mit Todesfabriken wie Auschwitz ihr Ende gefunden: Nach Neimans virtuos vorgetragener These sei also die der philosophischen Disziplin als Konsensbasis dienende normalwissenschaftliche Auffassung von einer Einheitstheorie, die (wie noch bei Leibniz) physische und moralische Übel gleichermaßen angehen ließ, seit dem 18. Jahrhundert verloren gegeben worden. Das Projekt Kants und seiner Nachfolger wiederum, das Thema des Bösen auf die transzendentale Untersuchung des moralischen Bösen im Rahmen des Problems menschlicher Freiheit zu beschränken, musste seit den Schrecken des 20. Jahrhunderts, wie sie von Auschwitz emblematisiert werden, als undurchführbar angesehen werden. Nicht ganz zu Unrecht sieht Neiman seither einen neuen „negativen“ Konsens der verwirrten Kapitulation und hochkompetenten Ratlosigkeit in der Philosophie. Einen normalwissenschaftlichen Zustand gebe es nicht mehr, und es wird noch nicht einmal das Problem diskutiert oder die Hoffnung geäußert, dass dieser wohl wiedergefunden werden müsse.
Interpretationen wie die Neimans zeigen am Beispiel der Frage nach dem Bösen recht gut, wie und warum bestimmte vorgefasst konsensuale Einstellungen in der Philosophie von Interessenslagen, historischen Konstellationen und konkreten Befürchtungen bedingt und dann zum charakteristischen Standpunkt ganzer Epochen der Philosophie erhoben werden können – oder eben Epochen der Orientierungslosigkeit bezüglich bestimmter Grundfragen einläuten können. Und so haben die letztvergangenen Jahrzehnte zwar eine beträchtliche Anzahl von genialen philosophischen Einlassungen und Aphorismen zum Thema des Bösen hervorgebracht, ja, das Thema wird in zu erwartender Eintönigkeit angesichts von Terrorgeschehen, Kriegen und Massakern nachgerade zur Obsession der Veröffentlichungslandschaft – doch gleichzeitig gerät die Beschäftigung der Philosophie mit dem Bösen immer mehr ins Stocken und entwickelt sich zusehends zu einer Art Peinlichkeit des Denkens. Daher womöglich all das Aphorismenhafte und Obsessionale.
Der Grund für diese Misere liegt unter anderem darin zu glauben, der Philosophie gehe – durch historische Gegebenheiten, Konsensverluste, Interessenslagen oder was auch immer – tatsächlich etwas verloren, weil es irgendwann als schlechterdings überholt zu gelten habe. Eine der besonderen fachidentifizierenden Vorgehensweisen, die der Philosophie im Vergleich mit vielen anderen Wissenschaften eignet, ist jedoch gerade die der Rückbesinnung. Diese Vorgehensweise geht Hand in Hand mit der philosophiegeschichtlichen Erfahrung, dass im Bereich grundlegender Wirklichkeitsdeutungen nichts als via facti überholt und mittlerweile wertlos angesehen werden kann. Er würde doch ständig nur das Gleiche vorbringen, lässt Platon einen avantgardistischen Sophisten dem Sokrates vorwerfen, und der Philosoph verteidigt sein Geschäft bezeichnenderweise mit dem provokanten Hinweis: Nicht nur ständig das Gleiche, sondern ständig das Gleiche über das Gleiche – statt jedes Mal etwas Anderes vorzubringen und zu glauben, es gehe dann nicht mehr über das Gleiche, sondern über etwas ganz Neues.
Selbstbescheidung der Philosophie
Eine der wenigen bedenkenswerten philosophischen Theorien nach Auschwitz bezüglich des Bösen hat Hannah Arendt vorgelegt, und ihre Theorie kann als Schaustück solch einer methodischen Rückbesinnung, eines erneut und unbeirrt das Gleiche zur Sprache Bringens, gewertet werden. Um in Neimans Raster zu bleiben: Die Selbstbescheidung der Philosophie vor Auschwitz greift Arendt unbeirrt durch ihre Konzentration auf das menschliche Böse auf; und auf die Grundlagen vor Lissabon geht sie insofern zurück, als sie erneut das Böse als etwas primär Defizientes auffasst, nicht als etwas Effizientes, machtvoll Wirksames – also auf eine Defizienz- oder Privationstheorie des Bösen, wie sie in Leibniz ihren letzten großen Vertreter hatte. Dabei lassen sich in Arendts Theorie Kant, Sokrates und Auschwitz als Motive der Rückbesinnung durchaus wiederfinden. Und nicht nur sie.
Eine Gedankenlosigkeit
Im Jahr 1961 hatte Arendt als Berichterstatterin für The New Yorker dem Prozess gegen Adolf Eichmann, den ehemaligen Leiter des für die Durchführung der Vertreibung und Deportation der Juden zuständigen Referats des NS-Reichssicherheitshauptamtes, beigewohnt. In ihrem Buch Eichmann in Jerusalem unterbreitete sie 1963 die These, man könne an Verbrechern wie Eichmann ersehen, das extreme Böse sei weder etwas Tiefes oder Tragisches noch auch etwas Bemerkenswertes und Faszinierendes, es sei auch nichts Radikales und dem Menschen als damokleischer Hang Innewohnendes, wie Kant das gewollt und seither eine lange Reihe von Philosophen es wiederholt hatten. Vielmehr sei das Böse in seiner äußersten Form eigentlich banal, es entspringe im Grunde einer Gedankenlosigkeit und Vergessenheit, die den Menschen zu Schlimmerem verleite als bewusstes Wollen und gezieltes Handeln. Wiederum zwei Jahre später führte Arendt diese Ansicht in einer Vortragsreihe mit dem Titel Some Questions on Moral Philosopy (Deutsch erschienen als Über das Böse) näher aus. Den lautstarken Einwänden, die ihr vorwarfen, sie verharmlose das Böse durch die Loslösung vom Willen, von der Absicht und vom Motivationszusammenhang, entgegnete sie dabei durch eine geduldige Erklärung, die von Platons Gorgias ausgeht und von der gegenintuitiven These, die Sokrates dort äußert: Unrecht zu tun, sei schlimmer als Unrecht zu leiden. Arendt plädiert für die Überzeugungskraft dieses zunächst einmal unplausibel erscheinenden Gedankens, den sie so ausdeutet: Wer auch immer Übles tut, ist – und das ist das Schlimme – „dazu verdammt, in unerträglicher Intimität mit einem Übeltäter zusammenzuleben“.
Der Mensch, so Arendt in ihren Vorträgen weiter, ist nämlich „Zwei in Einem“, ein Wesen im fortwährenden Dialog mit sich selbst. Dass er von sich selbst geistig zurücktreten und sich gleichsam wie einen anderen betrachten und in Frage stellen kann, ist sogar die Grundlage dafür, dass wir Menschen als moralische Wesen ansehen: Jedes personale Miteinander wurzelt in diesem innerpersonalen Gegenüber des Menschen mit sich selbst. Und in der Tat greift Arendt hier einen Gedanken auf, der in Platons Schriften häufig wiederkehrt: Moral hat darin ihre Grundlage, dass der Mensch sich von sich selbst im Geiste distanzieren kann und sich wie ein Gegenüber ins Auge zu fassen und nach den Motiven für sein Handeln zu befragen vermag – als sei er ein anderer und doch gleichzeitig unvergessen immer er selbst. Als „Zwei in Einem“ schläft der Mörder also jede Nacht mit einem Mörder im selben Bett, so Arendt veranschaulichend, der Giftmischer nimmt jede Mahlzeit mit einem Giftmischer ein, der Betrüger verbringt sein ganzes Leben mit einem Betrüger, und welcher Mensch wäre wachen Geistes von solchen schlimmen Aussichten nicht abgestoßen?
Was das extreme Böse ausmacht und im Grunde bedingt, ist nach Arendt die eher langweilige Aufgabe dieser Zwei-in-Einem-Struktur, es ist das keineswegs furchtbare oder abgründige, sondern vollkommen reizlose Unvermögen, mit sich selbst in diesen Dialog treten und sich selbst als Gegenüber wahrnehmen zu können. Das Böse manifestiert eine geistige Eindimensionalität, die schlicht und banal verhindert, auf sich selbst blicken zu können und sich dann zu fragen, ob man damit einverstanden sein kann, dieser Mensch, den man da vor sich sieht, zu sein. Wie Sokrates plädiert Arendt hier akzentuiert intellektualistisch und setzt sich damit von der ethischen Tradition der Zeit seit Neimans Lissabon-Epochenschwelle ab. Es geht Arendt nicht darum, ob man so oder so handeln will oder dieser oder jener Mensch sein möchte, es geht um einen Akt der vernünftig betrachtenden Zustimmung, der anstelle von Absicht und Willen eher ein Können setzt: Sie habe bei denen, die sich heldenhaft gegen den Totalitarismus gestellt haben, nie den Satz gehört, es sei geschehen, weil sie sich so verhalten wollten, bemerkt Arendt an anderer Stelle einmal, wohl aber häufig die Bemerkung, sie hätten eben nicht anders gekonnt, das heißt, sie hätten sich selbst nicht anders zu akzeptieren vermocht.
Der schlimmste Übeltäter, für den in Arendts Ausführungen Eichmann herhält, hat diese Selbstbeziehung, diese Fähigkeit, „Zwei in Einem“ zu sein, nach Arendts Darstellung nicht, er hat sie aufgegeben oder nie gesucht, und er gilt ihr daher genau betrachtet auch nicht als „richtiger“ Mensch. Das Böse fußt in der schlimmsten seiner Formen auf einer Selbstvergessenheit, der Mensch versäumt sein geistiges Potenzial, sein eigenes Gegenüber zu sein. (Volker Gerhardt hat einmal dieses Potenzial in einer Studie zur moralischen Dimension von Öffentlichkeit anhand von Kants Besinnungsaufruf „publice age!“ psychologisch zu plausibilisieren versucht: Handle so, als sei dein Handeln öffentlich betrachtbar, denke daran, wie du dächtest, wenn du andere so handeln sähest, wie du dich jetzt anschickst zu handeln, und lege diese Vorstellung deinem Handeln zugrunde.)
In diesem Sinne also ist das Böse nach Arendt banal, und nicht tief, tragisch oder staunenswert kraftvoll. Das Böse ist die Manifestationsform von Verlassenheit als einer eindimensionalen, von sich selbst entkoppelten Grundbefindlichkeit – als „innerer Leere“, wie Arendt in gesuchtem Kontrast zur „Einsamkeit“ in dem Sinne, den sie bei dem mittelalterlichen Denker Meister Eckhart liest und ausdeutet, sagt: „Einsamkeit bedeutet, daß ich, obwohl allein, mit jemandem (das heißt, mir selbst) zusammen bin. Sie bedeutet, daß ich Zwei-in-Einem bin, wohingegen Verlassenheit und Isoliertheit diese Art von Schisma, diese innere Zweiheit, in der ich mir selbst Fragen stellen und von mir Antworten erhalten kann, nicht kennen.“ Zwei in Einem zu sein, hat bei Arendt somit nichts Schizophrenes an sich, wie man angesichts des Ausdrucks „Schisma“, den sie hier wählt, vielleicht schnell bei der Hand wäre zu vermuten. Im Gegenteil: Erst das Verfehlen eines Dialogs mit sich selbst als Gegenüber führt eine fatale Spaltung herbei. Der Riss geht durchs eigene Ich. Das Einstellen des Dialogs mit sich selbst entgrenzt die Handlungen, weil man sich selbst aus dem Blick verliert. Nach Arendt ist dadurch die Auflösung der Persönlichkeit unmittelbar bedingt, und zwar die der moralischen Persönlichkeit. Vielleicht sollte man Arendts Hinweis, Menschen wie Eichmann seien gar keine „richtigen“ Menschen, kein „jemand“ mehr, auch so verstehen, um allzu naheliegenden Missverständnissen vorzubeugen: als Hinweis auf das völlige Aussetzen der moralischen Persönlichkeit.
Keine schaurige Faszination
Arendt setzt sich mit dem Vorschlag, das Böse als im Grunde banal aufzufassen, bewusst von solchen philosophischen Theorien des Bösen ab, die dem Bösen eine schaurige Faszination zusprechen oder es um des philosophischen Verständnisses willen relativieren; dazu brauche man, so mahnt sie, nur „an Spinoza zu denken, für den das, was wir das Böse nennen, nichts anderes ist als ein Aspekt, unter dem die fraglose Güte von allem, was ist, dem menschlichen Auge erscheint, oder an Hegel, für den das Negative die mächtige Kraft ist, die die Dialektik des Werdens antreibt, und in dessen Philosophie die Übeltäter – weit entfernt davon, das Unkraut im Weizenfeld zu sein – sogar als dessen Dünger erscheinen.“ Arendts Interpretation macht dem Bösen keine derartigen Komplimente, und man muss ja tatsächlich achtgeben, dass Theorien über das Böse nicht selbst zu etwas Bösem werden. Das Böse ist banal, weil es den Menschen nicht nur aus der Gemeinschaft mit anderen, sondern auch mit sich selbst löst. Es zeigt den Menschen als Fehlstelle an. Es ist im Grunde eine Defizienz, wie das die alten Privationstheorien des Bösen ganz ähnlich besagten, und es wäre ein Fehler, dem Bösen die Ehre einer tiefgründigeren metaphysischen oder gehaltvolleren psychologischen Theorie zu erweisen. Die Schrecken und Gefahren des Bösen zeigen sich dann gerade in seiner Banalität: Im Potenzial des Mediokren, Geistlosen und Tagtäglichen, Furchtbares zu zeitigen. Das, was jedem von uns zuzutrauen wäre: Unverstand, Mangel an menschlichem Umgangsvermögen mit sich selbst und anderen, Unbedachtheit und ein Fehlen an Mut oder Sorgfalt, sich prüfend auf sich selbst einzulassen, reichen zur Erklärung des moralisch Unfassbaren aus. So jedenfalls Arendt.
Christian Schäfer
Dr. Christian Schäfer ist Professor für Philosophie an der Universität Bamberg.