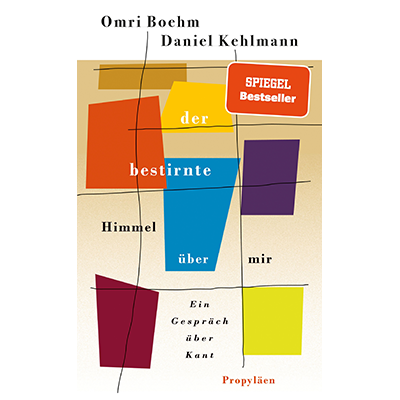Die Phänomene, an denen Ingolf Dalferth die Gefährdung des demokratischen Zusammenlebens festmacht, sind weithin zu beobachten und vielfach beschrieben: Vertrauensverluste in die politischen Institutionen unserer Gesellschaft; Abschottung sozialer Milieus, die nur noch in ihrer eigenen Blase kommunizieren; der dialektische Umschlag einmal emanzipatorisch gemeinter Prozesse in ihr Gegenteil.
Darin zeichnet sich eine Gesellschaft ab, deren gemeinsames Dach zerbrochen ist: „Wo alle nur noch um ihre jeweiligen Identitäten besorgt sind und diese in Dauerdifferenzierung durch Abgrenzung zur Geltung zu bringen suchen, atomisiert sich eine Gesellschaft und zerfällt in Singularitäten.“
Dalferth macht den lohnenden Versuch, diese Krisenphänomene einer theologischen Deutung zuzuführen, somit den roten Faden aufzuspüren, der sie miteinander verbindet.
Den findet er in der Frage nach einem verbindenden „Dritten“, das die gesellschaftliche Segregation überwinden könnte. Denn: „Gelingt es nicht, in den verschiedenen Konfliktfeldern jeweils ein konkretes Drittes zu entwickeln, das über die bloße Entgegensetzung der gesellschaftlich konkurrierenden Denkweisen hinausführt, weil es für beide Seiten unverzichtbare Relevanz besitzt, werden sich die gegenwärtigen Krisen der Gesellschaft nicht überwinden lassen.“
Aber was könnte dieses verbindende Dritte sein? Das Gesetz, vor dem alle Menschen gleich sind? Die öffentliche Vernunft, die von einem vernünftigen Verhalten aller am gesellschaftlichen Diskurs Beteiligten ausgeht? Der Rekurs auf Gott als den Schöpfer?
Es ist vor allem die Ausklammerung von Theologie und Glaube aus dem öffentlichen Diskurs, ihre Privatisierung, woran sich Dalferths Kritik festmacht. Dadurch aber wird die handlungsleitende und motivationale Energie von Religion und Glauben von vorneherein aus der demokratischen Meinungsbildung ausgeschlossen. Entsprechend breiten Raum nimmt darum auch Dalferths Kritik am Kommunikationsmodell von Jürgen Habermas ein.
Es erweise sich als „soziale Fiktion“, weil es von idealisierenden, die reale Lebenswelt von Menschen übersehenden Voraussetzungen ausgeht. „Man muss die von Habermas als Grundzug der Spätmoderne hervorgehobene postmetaphysische Grundsituation der Gesellschaft in Frage stellen“, schreibt Dalferth. Denn „wo religiöse Überzeugungen als private Schrullen abgetan werden“, kommt es zu keiner ernsthaften Auseinandersetzung über die weltanschaulichen Hintergründe, die für das praktische Verhalten meist einflussreicher seien als rationale Gründe.
Gerade im Gottesbezug aber liegt für Dalferth das gesuchte „ultimative Dritte“, das „epistemisch nicht erweisbar, aber existenziell unvermeidlich“ ist. Denn „die Transzendenzformel Gott“ macht aufmerksam „auf die Fragilität, Endlichkeit und Schadensanfälligkeit menschlichen Lebens, die in keiner demokratischen Ordnung vergessen werden sollte.“
Auch wenn Religion in westlichen Demokratien schon lange nicht mehr als Drittes fungieren kann, gilt: „Gott aber kann es, denn die Einsicht in die eigene Endlichkeit, Kontingenz, Immanenz und Verantwortlichkeit anderen gegenüber ist keineswegs nur religiösen Menschen zugänglich.“
Liegt in diesem Hinweis so etwas wie ein versteckter existenzieller Gottesbeweis? Für den Theologen Dalferth ist damit eher die Aufgabe beschrieben, im öffentlichen Gespräch auf der unerledigten Bedeutung der Gottesfrage zu bestehen.
Und Theologie hat entsprechend die Aufgabe, „die Kontingenz des Daseins, die Endlichkeit des Lebens, die Unmenschlichkeit der Menschen und den strittigen Modus eines wirklich mitmenschlichen Lebens“ zu bedenken, also existenzielle Fragen aufzugreifen, für die es im politischen Diskurs sonst keinen Anwalt gibt.
In Zeiten abnehmender Kirchenmitgliederzahlen und landeskirchlichen Rückbaus lese ich dieses Buch als ein Plädoyer für die Unverzichtbarkeit von Theologie und Kirche in einer Gesellschaft, die in Gefahr steht, ihren Kompass zu verlieren.