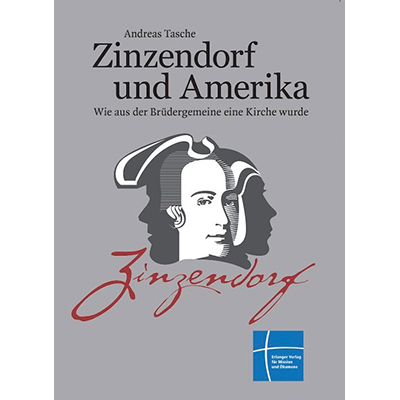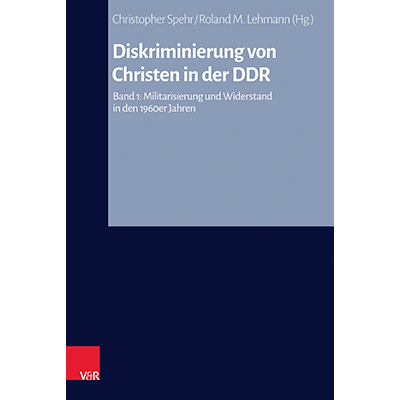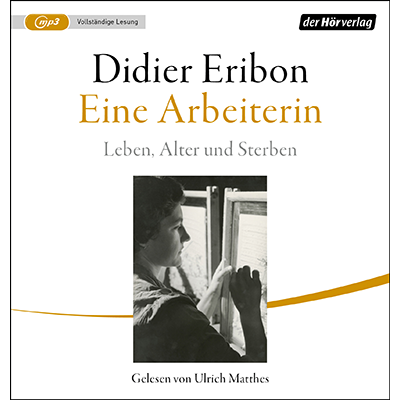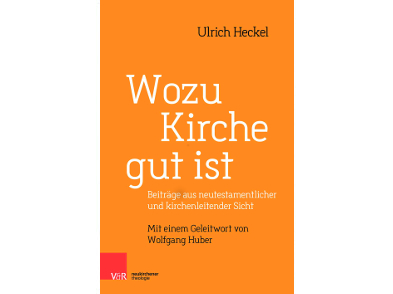
"Wozu Kirche gut ist?" – Ulrich Heckel, seit 2006 außerplanmäßiger Professor für Neues Testament an der Universität Tübingen und seit 2008 Oberkirchenrat und theologischer Dezernent der Evangelischen Landeskirche in Württemberg, antwortet darauf neutestamentlich und reformatorisch: Die Kirche ist Geschöpf, Empfängerin und Trägerin des Heil bringenden Wortes Gottes. Sie ist also zur Weitergabe des heilsamen Evangeliums gut. Kirche, das ist die örtliche Versammlung und die weltweite „Gemeinschaft aller Getauften“. Sie stellt sich in verschiedenen Sozialformen dar. Ihre Einheit besteht in „versöhnter Verschiedenheit“.
In dem Band sind Aufsätze, Vorträge, Gutachten, Grußworte, eine Rezension und eine Predigt versammelt, alle 2008 bis 2017 verfasst. Schwerpunkte sind Themen rund um Paulus (Theodizee, Frieden, Missionsstrategie, alter und neuer Mensch), Taufe, Kirche, Segen (darüber hat Ulrich Heckel andernorts intensiv gearbeitet), kirchliche Erwachsenenbildung, Kirchenmusik, dazu ein besonders eindrücklicher Aufsatz zu Luthers Zwei-Reiche-Lehre. Alle theologischen Probleme, auch heute diskutierte Fragen, werden vom neutestamentlichen Befund her bedacht. Heckel ist ein Meister der bibelkundlichen Darstellung. Er zeigt innerbiblische Entwicklungen, historisch-kritisch geläutert, und gibt eine Gesamtschau, wobei er weniger darauf bedacht ist, scharfe Akzente zu setzen. Der Schüler des Tübinger Neutestamentlers Martin Hengel (1926–2009) vertritt eine reformatorisch akzentuierte biblische Theologie. Sie ist weitgehend Schriftauslegung und versteht sich als „kirchliche Wissenschaft“.
Die Kirchlichkeit Heckels zeigt sich etwa darin, dass das Wirken des göttlichen Geistes im Alltag im Wesentlichen im Rahmen der Kirche gesehen wird. Die Hochschätzung der Taufe durchzieht das ganze Buch. Der Heilige Geist wird durch die Taufe verliehen, ja, ohne die Taufe gibt es keinen Zugang zum Reich Gottes. Die Taufe sei das „Grunddatum christlicher Existenz, die ein für alle Mal vollzogen wird, aber das ganze Leben bestimmt. Sie ist der „Ur-Segen“, und so sind alle kirchlichen Amtshandlungen „Taufgedächtnis“. „Die Taufe verleiht meinem Glauben das Fundament.“
Aber müsste es nicht heißen: „Das Wort Gottes verleiht meinem Glauben das Fundament“? Immerhin hält Heckel die Rede von der „Heilsnotwendigkeit“ der Taufe für „irreführend“, denn „das Heil wird nicht an die Taufe gebunden, sondern an den Glauben an das Evangelium“. Hätte Heckel dies insgesamt beherzigt, dann hätte er deutlich gemacht, dass es eben auch gläubige Christen gibt, die nicht oder noch nicht getauft sind, und dass es mit dem „Herrschaftswechsel in der Taufe“, bei dem „die Macht der Sünde ein für alle Mal gebrochen ist“, auch nicht immer so weit her ist, denken wir nur an Getaufte wie Josef Stalin und Adolf Hitler.
Die „kirchenleitende Sicht“ spielt, glücklicherweise, bei Heckel weniger eine Rolle. Schließlich geschieht nach den Reformatoren Gemeinde- und Kirchenleitung primär durch Schriftauslegung und Verkündigung. An dieser „Leitung durch Lehre“ sind Viele beteiligt, und da hat die „Amtskirche“ keinen Bonus.
In seinen Ausführungen zum Dialog der Religionen ringt sich Heckel schließlich zur „Hoffnung“ durch, „dass es letztlich derselbe Gott ist, der in allen Religionen verehrt wird“. Hätte er über CA 5 hinausgegriffen, wonach der Heilige Geist in der Verkündigung den Glauben wirkt, „wo und wann er will“, und mit dem Schweizer Systematischen Theologen Martin Werner (1887–1964) auch gedacht an „das Geheimnis der göttlichen Schöpfermacht als des Geistes, der weht, wann und wo und wie er will“, könnte er den Geist Jesu zuversichtlicher auch über Christentum und Kirche hinaus am Werke sehen. Schon altchristliche Kirchenväter wie Justin fanden anderswo Bruchstücke jener Wahrheit, die sich freilich in ihrer ganzen Fülle in Jesus Christus ausgedrückt hat.
Andreas Rössler
Andreas Rössler
Dr. Andreas Rössler ist Pfarrer i. R. Er lebt in Stuttgart.