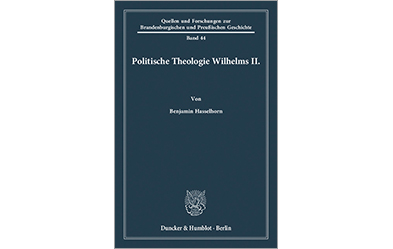
Der letzte deutsche Kaiser weckt seit einiger Zeit verstärkt das Interesse der Geschichtswissenschaft. Angesichts der Tatsache, dass Wilhelm II. sein politisches Handeln immer wieder religiös begründet und sich zu religiösen und theologischen Fragen seiner Zeit immer wieder zu Wort gemeldet hat, muss es erstaunen, dass er dabei nur ansatzweise als Person der theologischen und religiösen Zeitgeschichte in das Blickfeld genommen wurde.
Mit der Studie von Benjamin Hasselhorn, einer Berliner theologischen Dissertation, liegt jetzt eine umfassende Analyse und Rekonstruktion des Verhältnisses zwischen Religion und Politik im Denken und Handeln Wilhelms II. vor. Hier können nur einige der inhaltlichen Schwerpunkte der Studie angerissen werden. In seiner Kindheit und Jugend erfuhr Wilhelm unterschiedliche, ja disparate religiöse Prägungen, die es schwer machten, den späteren Herrscher in die politischen und religiösen Kategorien seiner Zeit einzuordnen. Schon bevor er Kaiser wurde, bildete sich Wilhelms Auffassung heraus, dass das Herrscheramt nicht nur am Amt hänge, sondern auch mit einem religiösen Auftrag verbunden sei. Die eher theologische Seite seiner Auffassung vom Herrscheramt fand ihre Ausprägung in der Inanspruchnahme des Gottesgnadentums, verstanden als persönliche Verantwortlichkeit allein vor Gott. Im Politischen führte sie zu der Überzeugung, als Kaiser mit dem Auftrag zur nationalen Integration aller Volksteile "Herr der Mitte" zu sein. Diese wird beispielhaft am kaiserlichen Konzept der sozialen Monarchie dargestellt, das heißt, der Integration der Arbeiter in das Reich bei gleichzeitiger Bekämpfung der Sozialdemokratie und – nach demselben Muster – der Integration der Katholiken bei gleichzeitiger Bekämpfung des politischen Katholizismus in Gestalt des Zentrums.
Auch im Verhältnis zu den Juden fühlte sich Wilhelm II. seinem Anspruch verpflichtet, Herr der Mitte auch der jüdischen Deutschen zu sein. Festzuhalten ist, dass keine öffentlichen judenfeindlichen Äußerungen des Kaisers nachzuweisen sind und sich seine teilweise rabiaten privat geäußerten antijüdischen Ressentiments nicht in seiner Politik niedergeschlagen haben. Dieses Verhalten, auch seine Freundschaft mit jüdischen Repräsentanten des Besitz- und Bildungsbürgertums, trugen ihm von alldeutscher Seite die Bezeichnung "Judenkaiser" ein.
In seiner Funktion als preußischer König war Wilhelm II. zugleich Summus Episcopus der altpreußischen Landeskirche. Seine Befugnisse aus dem landesherrlichen Kirchenregiment nahm er ernst, nutzte sie zur Vermittlung und Ausgleich zwischen den Parteigegensätzen und zur Wahrung der Kirchenunion zwischen Lutheranern und Reformierten und verzichtete dabei weitgehend auf direkte Eingriffe in kirchliche Angelegenheiten. Allerdings setzte der Kaiser gegen die theologisch mehrheitlich orthodox ausgerichtete evangelische Kirchenbehörde die Berufung Adolf Harnacks, eines Vertreters des theologischen Liberalismus, an die Berliner theologische Fakultät durch.
Auch der Nichttheologe und Nichthistoriker liest diese interdisziplinär angelegte, verständlich gegliederte Untersuchung mit Gewinn, vielleicht gerade auch deshalb, weil sie in die Grenzbereiche zwischen Theologie, Kirchen- und Theologiegeschichte sowie säkularer Geschichtswissenschaft führt. Hinzu kommt, dass der Autor auf politisch-moralische Bewertungen verzichtet, freilich nicht ohne den Hinweis auf das "totale Scheitern" des Kaisers am Ende seiner politischen Laufbahn.
Benjamin Hasselhorn: Politische Theologie Wilhelms II. Duncker & Humblot, Berlin 2012, 343 Seiten, Euro 68,–.
Joachim Rott

