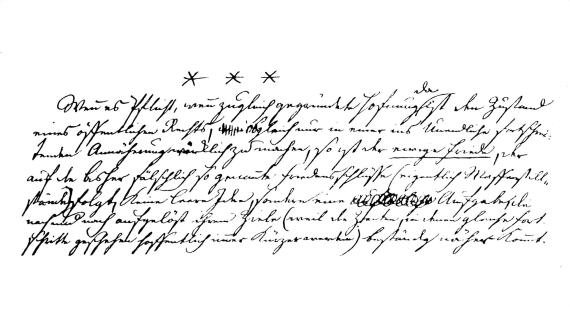Gewaltfrei in einer Welt voller Gewalt
Was die Synodalen der EKD in Dresden zum Thema Frieden beschlossen haben, rede die Welt schön und sei Ausdruck einer theologischen Verirrung, kritisierte Johannes Fischer kürzlich an dieser Stelle. Auf ihn reagiert nun Christine Busch, Vorsitzende der Aktionsgemeinschaft Dienst für den Frieden, die zur Vorbereitungsgruppe der Friedenskundgebung gehörte.
Gott schafft Frieden, indem er die Logik der Gewalt überwindet - dieser theologische Gedanke trägt die Kundgebung „Kirche auf dem Weg der Gerechtigkeit und des Friedens“ der EKD-Synode 2019. Unter Berufung auf den Frieden Gottes, der Grenzen, Mächte und Gewalten überwindet, und auf das Versprechen eines neuen Himmels und einer neuen Erde entfaltet sie die Aufgabe, Frieden zu gestalten in der unerlösten Welt.
Der Konziliare Prozess für Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung ist der ökumenische Referenzrahmen der Kundgebung. Er konkretisiert sich im Pilgerweg der Gerechtigkeit und des Friedens, zu dem der ÖRK 2013 eingeladen und der sich für die EKD, viele Landeskirchen und Partnerkirchen als Inspiration erwiesen hat. Sein Motiv ist die Suche nach der Einheit des Lebens, die alles Geschaffene, alles Lebendige mit allen Veränderungen umfasst, auch die gewaltige Erschöpfung unserer Erde. Der Pilgerweg ist ein frommer Weg, der tief in die Auseinandersetzung mit der eigenen Haltung und mit dem Glauben führt. Er schärft das geistliche Profil von Kirche, fordert ihre Sprache und ihre Demut heraus, weil er Leiden, Unfrieden, Gewalt, Erfahrungen des Schmerzes und des Versagens nicht tabuisiert. Als Lernweg und Bußweg zielt er auf die „Entwicklung einer Haltung des gerechten Friedens – so dass wir tatsächlich Christus immer ähnlicher werden könnten“ (F. Enns). Die Perspektive einer transformierenden Spiritualität, die sich im Beten und Handeln ausdrückt, ist der Anspruch, an dem die Kundgebung „Kirche auf dem Weg der Gerechtigkeit und des Friedens“ bzw. die EKD selbst zu messen ist. Schon die mit Dank erinnerte Ökumenische Versammlung „Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung“ 1989 in Dresden, die unter der Leitvorstellung „Gerechter Friede“ die klare Absage an „Geist, Logik und Praxis der Abschreckung“ beschloss, stellte die Frage, wie sich die Kirche selbst zu verändern habe, um für einen gerechten Frieden glaubwürdig eintreten zu können.
Aktive Gewaltfreiheit
Sie setzt auf das Prinzip der Gewaltfreiheit in einer Welt voller Gewalt, weil wir als Christinnen und Christen an der Friedensbewegung Gottes Anteil haben: dieser Gedanke profiliert die Kundgebung gegenüber der Friedensdenkschrift von 2007, die den klaren Vorrang der gewaltfreien Konfliktbearbeitung feststellt, doch in dem Verzicht auf Gewalt lediglich eine Option unter anderen sieht. Unter dem Leitbild des Gerechten Friedens bindet sie den Einsatz militärischer Maßnahmen als ultima ratio an enge Auflagen und an das Kriterium der rechtserhaltenden Gewalt. Die Kundgebung jedoch setzt anders an, indem sie die Aufgabe des Friedens im Gottesdienst und im Gebet annimmt. Sie versteht Gottes Ruf in die Gewaltfreiheit als Einladung, in der Nachfolge Jesu, inspiriert durch seinen aktiven Gewaltverzicht, für einen gerechten Frieden einzustehen. Deshalb gibt sie gerade nicht, wie Johannes Fischer suggeriert, eine Art technische Garantieerklärung ab: „Alle Probleme und Konflikte lassen sich konstruktiv und gewaltfrei lösen“, sondern beruft sich auf die Fähigkeiten von Menschen, Gemeinschaften und Staaten, Konflikte konstruktiv und gewaltfrei in allen gesellschaftlichen und politischen Lebensbereichen zu bearbeiten. Es geht um Kompetenz, die man lernen kann. Die Kundgebung fordert zu Recht, Friedensbildung zu verstärken.
Die Selbstverpflichtungen der Kundgebung stehen unter dem synodalen Versprechen, Gewaltfreiheit „im Gebet, im eigenen Friedenshandeln und im gesellschaftlichen Dialog immer weiter einüben“ zu wollen. Dies ist keine Hybris, sondern signalisiert die spirituelle und die politische Einstellung, die aus dem Geist des göttlichen Friedens erwächst. Sie wird nicht entkräftet durch den Hinweis auf Bonhoeffers Gedanken, wonach zum verantwortlichen Leben die Bereitschaft zur Schuldübernahme gehört, im Gegenteil. Bonhoeffer spricht auf Fanö davon, dass Kämpfe nicht mit Waffen, sondern mit Gott gewonnen werden, und spitzt christologisch zu: „Friede soll sein, weil Christus in der Welt ist“. Für Bonhoeffer sind Kirche und Welt keine getrennten Bereiche; die von Jesus aufgezeigten Lebensmöglichkeiten und Handlungsweisen sind konkrete, zumutbare Herausforderungen an eine Welt, die im Licht der Versöhnung mit Gott steht, aber deren Erlösung noch offen ist, und zugleich spirituelle Orientierung für den Glauben und die Kirche.
Die Friedensbewegung Gottes in diese Welt hinein ist größer als die Bedingungen unseres Lebens, stärker als unsere Verstrickung in Schuld und Sünde; sie ist nachhaltiger als Gewalt, die unter dem Anschein der Unausweichlichkeit oft den Charakter einer „erlösenden Gewalt“ (Walter Wink) trägt. Der aktive Verzicht auf Gewalt, ob er nun eine individuelle Konsequenz des Glaubens ist oder auf einem kollektiven ethischen Verständnis beruht, erfordert professionelle Anstrengungen, große Wachsamkeit und entschiedene Prävention, um die Eskalation von Konflikten zu verhindern und um nicht in eine Ausweglosigkeit zu geraten, die schließlich nur noch die ultima ratio der Gewalt kennt. Mosambik ist ein Beispiel für eine friedliche Konflikttransformation; zwischen 1989 und 1992 hat Sant´Egidio eine Friedensvereinbarung zwischen den RENAMO- und den FRELIMO-Streitkräften vermittelt, die einen zehn Jahre dauernden Krieg beendete und die bis heute hält.
Im Vorfeld entscheidet sich, welche Chancen dem Frieden gegeben werden. „Der Einsatz von Gewalt ist immer eine Niederlage und stellt uns vor die Frage, ob wir im Vorfeld alles zur Prävention und gewaltfreien Konfliktlösung getan haben“, heißt es in der Kundgebung. Die Chancen des Friedens wachsen, wenn die Sicherheit anderer berücksichtigt wird und wenn die Kriterien von Gerechtigkeit und Recht, von Ausgleich und Gemeinwohl zu verbindlichen Prioritäten und zu Selbstverpflichtungen führen. Dezidiert verspricht die Kundgebung, die Ausbildung und den Einsatz von Friedensfachkräften zu stärken „aufgrund positiver Erfahrungen mit Prävention und ziviler Konfliktbearbeitung“. Friedensfachdienste und Friedensorganisationen im Raum der Kirche dürfen ihre Arbeit bestätigt sehen; sie qualifizieren mit ihren breit gefächerten Angeboten auch Menschen, die nicht in klassischen kirchlichen Milieus beheimatet sind. Es ist nötig, den Ausbau der Friedens- und Demokratiebildung in Schulen und Bildungseinrichtungen zu fordern und hoffentlich als Kirche selbst zu fördern; man denke nur an die bundesweit etwa 1.100 Schulen in evangelischer Trägerschaft, an die pädagogischen Institute in den Gliedkirchen, an das Comenius-Institut und viele andere, auf Friedens- und Demokratiefragen spezialisierte Fachorganisationen im kirchlichen Raum.
Johannes Fischer spricht der Kundgebung beziehungsweise einem christlichen Pazifismus jegliche geistliche Qualität ab. Das ist falsch. Die Zugänge liegen bei Gottesdienst und Gebet, bei Gewaltfreiheit in der Nachfolge Jesu, bei den ökumenischen Bezügen. Dies alles ist lebendig in der evangelischen Friedensarbeit.
Glauben und Handeln
Wer in der Nachfolge Jesu Christi Gewaltfreiheit einübt, muss sich die Welt nicht schönreden. Johannes Fischer hat unrecht, wenn er der Kundgebung dies unterstellt. Realistisch ist ihr Blick auf die ökologische Situation, vor allem auf die Auswirkungen des Klimawandels, und konsequent sind die Forderungen nach nachhaltiger Entwicklung, nach Klimagerechtigkeit und globalem Klimaschutz als Beitrag zur Krisenprävention. Nüchtern ist der Blick auf die Gefährdungen des innergesellschaftlichen Friedens und auf die notwendige Auseinandersetzung mit Rechtspopulismus, Rechtsextremismus, Antisemitismus und Islamophobie. Bedrohlich ist die Zerrissenheit Europas; wegweisend bleiben die Leitlinien der Charta Oecumenica (2001) für die Friedensverantwortung der Kirchen in Europa. Brandaktuell und hoch gefährlich sind der Kontrolle entzogene autonomisierte Waffen, die Militarisierung des Cyberraums und die nuklearen Waffenarsenale. Diese Wahrnehmung der Welt geschieht in dem Wissen um die „grundlegende Differenz zwischen dem, was wir für den Frieden tun, und dem Frieden Gottes“; sie steht in der Bewegung zwischen Klage und Gotteslob, zwischen dem Hier und Jetzt, das unseren Glauben und unser Handeln herausfordert, und dem neuen Himmel und der neuen Erde, die wir erwarten. Im Gottesdienst und im Gebet stellen sich Christinnen und Christen in den Frieden Gottes. Sie lassen sich einladen in die Geschichte Jesu Christi: was heißt das anderes, als dass sie gesegnet und gesendet, in Wort und Tat, als Gottes Hände und Füße die Botschaft der Versöhnung und des Friedens weitergeben?
Die geistliche Dimension christlichen Lebens geht nicht verloren, wenn Menschen ihren Glauben im Alltag leben oder wenn eine Kirche daran erinnert, welche Grundlagen für das Leben gelten. Wo sie Fehlentwicklungen sieht, muss sie öffentlich und eindeutig reden, in ihrem eigenen Bereich wie in die Gesellschaft hinein. Suchet der Stadt Bestes und betet für sie: das ist die Aufforderung, die Welt zu gestalten und sich dabei zurückzubinden an Gott. Diese Haltung schützt vor gesellschaftlichem und politischem Aktionismus; sie setzt Energie frei, indem sie die Welt als Gottes Welt bejaht, so zerrissen sie auch ist und so sehr sie Raum gibt für Böses und für Gewalt. Es ist eine ehrliche Option, den Glauben in der Übernahme persönlicher Verantwortung politisch zu leben und das persönliche Christsein nicht unpolitisch oder privat verstehen. Ich denke an Martin Luther King, der, als er den gewaltfreien Widerstand aus tiefem Glauben begann und durchhielt, den Rassismus in den USA entlarven und beenden wollte. Gewaltloser Widerstand war für ihn „keine Widerstandslosigkeit gegenüber dem Bösen, sondern aktiver gewaltloser Widerstand gegen das Böse“. Dass er den Gegner nicht vernichten oder demütigen, sondern seine Freundschaft und sein Verständnis gewinnen will, speist sich aus dem Gebot Jesu zur Feindesliebe. Das Böse soll nicht hingenommen, sondern unterlaufen werden durch kreative oder verblüffende Interventionen – dazu inspiriert die Bergpredigt.
Ein christlicher Pazifismus, der den ethischen Dimensionen der Bergpredigt folgt, geht weder auf in „einem konsequentialistischen Kalkül, wonach Gewaltlosigkeit unterm Strich gerechnet letztlich gute Folgen hat und sich somit auszahlt“ (Fischer), noch in einer rein religiösen, geistlichen Gestalt, die auf eine Verantwortung für die Welt verzichtet. Wohl aber nimmt er – Jesus folgend - eine aktive Haltung des Verzichts auf Gewalt ein und sucht nach Feindschaft überwindenden, Versöhnung schaffenden, auf Verständigung setzenden, phantasievollen Lösungen von Konflikten. Carl-Friedrich von Weizsäcker spricht in diesem Kontext von „intelligenter Feindesliebe“. Sie trägt dazu bei, der Gewalt nicht das letzte Wort zu überlassen. In diesem Sinne weckt die Bergpredigt die Hoffnung auf Gottes Reich des Friedens und der Gerechtigkeit: sie verkündet den Frieden, den die Welt nicht geben kann, und ruft dazu auf, aktiv Verantwortung zu gestalten.
Politischer Kleinmut bei Atomwaffen
Die großen planetarischen Bedrohungen unserer Zeit sind Menschenwerk - der Klimawandel und die Nuklearwaffen. Beide Themen nimmt die Kundgebung auf. Die Frage atomarer Bewaffnung beschäftigt die EKD seit über 60 Jahren; die Denkschrift von 2007 hatte die Erwartung geweckt, von der Ablehnung der Drohung mit Atomwaffen nun zu einer klaren Forderung nach nuklearer Abrüstung bzw. nach dem Verbot und der Ächtung nuklearer Waffen zu kommen. Die Synode 2019 hält die Einsicht für unausweichlich, „dass nur die völkerrechtliche Ächtung und das Verbot von Atomwaffen den notwendigen Druck aufbaut, diese Waffen gänzlich aus der Welt zu verbannen“. Sie nennt ausdrücklich den Bruch des Budapester Memorandums, die Kündigung des INF-Vertrages, die steigende Gefahr eines Einsatzes oder Unfalls, die Wirkungslosigkeit atomarer Abschreckung gegen konventionelle Angriffe, die real existierende Bedrohung durch in Büchel lagernde Atomsprengköpfe, und sie hält den Atomwaffenverbotsvertrag von 2017 für überfällig: das Ziel einer Welt ohne Atomwaffen sei breiter Konsens, doch der Weg dorthin umstritten.
Trotz aller Einsichten vermeidet die Synode jedoch die unumwundene Forderung an die Bundesregierung, den Verbotsvertrag umgehend zu unterzeichnen und zu ratifizieren. Stattdessen fordert sie – ohne Fristen zu nennen –, konkrete Schritte einzuleiten „mit dem Ziel, den Atomwaffenverbotsvertrag zu unterzeichnen“ auf der Basis noch zu führender Verhandlungen in NATO, EU und OSZE. Dass die angemahnten Themen hoch komplex sind und langwierige Prozesse erfordern, spricht nicht gegen sie, doch als gradualistisches Verhandlungskonzept kommt der Vorschlag der Synode faktisch der herrschenden politischen Linie entgegen, die den Verbotsvertrag in Konkurrenz zum geltenden Nichtverbreitungsvertrag sieht und daher nicht verfolgt. Deutschland, das sich an den Beratungen zum Atomwaffenverbotsvertrag nicht beteiligte, vermeidet also die Auseinandersetzung, die die bisherigen 122 Unterzeichnerstaaten eröffnen. Eine völkerrechtliche Ächtung atomarer Massenvernichtungswaffen zielt auf ihre Delegitimierung, wie sie z.B. mit der Ächtung von chemischen Waffen und Landminen durchgesetzt wurde. Politisch ist es dringend erforderlich, die unterschiedlichen Verträge aufeinander zu beziehen, also die Nichtverbreitung und das Verbot von Atomwaffen als notwendige und gleichberechtigte Strategien zu verfolgen. Global Zero als realpolitischer und moralischer Imperativ (Niels Annen) erfordert die Ächtung aller Nuklearwaffen und den Abbau aller nuklearen Arsenale ohne Verzögerung.
Faktisch belässt es die EKD-Kundgebung jedoch noch und weiterhin bei der atomaren Teilhabe, die Deutschland einen nicht-ständigen Platz im UN-Sicherheitsrat ermöglicht. Die Feststellung, „dass auch vom deutschen Boden (Büchel) atomare Bedrohung ausgeht, kann uns nicht ruhig lassen“ ist vor diesem Hintergrund folgenlose Lyrik. Die synodale Unruhe reicht noch nicht für die politisch eindeutige Forderung, den Verbotsvertrag umgehend zu zeichnen und zu ratifizieren. Das noch der Heidelberger Thesen von 1959 klingt wieder an. In der Denkschrift 2007 schien das noch überwunden zu sein: „Aus der Sicht evangelischer Friedensethik kann die Drohung mit Nuklearwaffen heute nicht mehr als Mittel legitimer Selbstverteidigung betrachtet werden“ (Zf.162), ebenso mit dem Beschluss der Synode 2010 zur Ächtung von Atomwaffen. Doch das ist die Crux: nicht drohen, nur haben – und stecken bleiben in der Logik der Gewalt.
Christine Busch
Christine Busch ist Landeskirchenrätin i.R. und Vorsitzende der Aktionsgemeinschaft Dienst für den Frieden, Düsseldorf