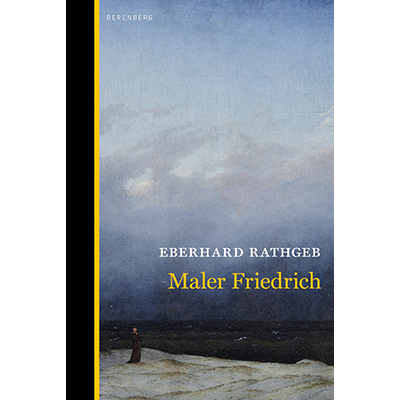Tradition in Gegenwart gestalten

Eher zufällig geriet Elisa Klapheck an die Hebräische Bibel, dann wurde sie Rabbinerin. Heute wirkt sie als solche seit vielen Jahren in der liberalen jüdischen Gemeinde in Frankfurt/Main und möchte die Tradition der Thora modernen Menschen vermitteln. Die Journalistin Hedwig Gafga hat sie besucht.
„Es geht nach oben“, ruft eine Stimme in den Treppenflur herunter. Vor der geöffneten Tür steht Elisa Klapheck, Rabbinerin in Frankfurt und Professorin für Komparative Theologie in Paderborn, früher Journalistin, unter anderem beim Berliner Tagesspiegel und bei der taz. Langes weißes Haar, leuchtend blauer Pullover, ein wacher Blick. Auf Bildern ist sie oft mit Kipa zu sehen. „Hebräisch heißt es Kipá“, sagt sie, Betonung auf der zweiten Silbe. Und im Plural? „Kipot“. Die 56-Jährige wirkt durch ihre direkte Art und ihre schnellen Bewegungen jung. Sie stellt zwei Becher Kaffee auf den Tisch.
In heutigen Gemeinden sind Rabbiner Religionslehrer, Seelsorger und Gutachter in religionsgesetzlichen Fragen. Die Frankfurter Rabbinerin hat eine Sehnsucht, die weit darüber hinausgeht: Sie möchte erreichen, dass die jüdische Perspektive wieder in die Gesellschaft hineinwirkt, sichtbar und hörbar wird, zuerst unter den Juden selbst, von denen viele den Bezug zu ihren Quellen verloren hätten. Sie legt die Thora, die Hebräische Bibel, „in aufgeklärter Weise“ aus, so dass sie den Besuchern heute etwas sagen könne, sagt sie selbstbewusst. Aber das allein genügt der politisch wachen Publizistin, die sie auch ist, nicht. Über die Gemeinde hinaus will sie das Potenzial, das sie im Judentum erkennt, einer interessierten Öffentlichkeit zugänglich machen.
Lange verstand sie sich selbst als nicht religiös. Erst im Laufe ihres Studiums in Hamburg änderte sich etwas. In einer privat organisierten jüdischen Frauengruppe wandte sie sich der Thora zu. Erst hatten zwei sich gegenseitig Deutsch und Hebräisch beigebracht, dann beschlossen: „Let’s read the bible in Hebrew!“ Eine Initialzündung. „Es hatte etwas Verwegenes, als würden wir was Verbotenes machen.“ Zwischendurch habe sie sich gefragt, was das Bibellesen bringe, wenn man gar nicht religiös sei. „Da dachte ich noch, ich muss an Gott glauben.“ Wie sie es vom Christentum her gekannt habe. Der Zugang der Juden sei ein anderer: Man erfahre Gott in der Geschichte, sei für oder gegen ihn, die Rabbinen hatten Gott beim Auslegen der Thora erfahren, und in deren Tradition steht sie.
Thora als Rahmen
In ihrem Buch Wie ich Rabbinerin wurde beschreibt sie sich als Studienanfängerin ohne Plan, die sich auf die Suche nach der Richtung macht, in die sie gehen will. Sie belegt Politik, Jura, Judaistik und weitere Fächer, lebt in WGs. Die Studien intellektuell zu bewältigen, ist für sie kein Problem. Doch erst als das Fundament geklärt ist, geht es richtig los. Sie sagt: „Auf dem Boden der Thora bekam meine jüdische Identität ihren Rahmen“. Aufgewachsen ist sie mit ihrem Vater, einem bekannten Künstler, und mit ihrer jüdischen Mutter, die die Endphase der NS-Zeit in einem Versteck überlebte, der Großvater wird in Auschwitz ermordet. Sie erlebt Situationen, in denen die Mutter sie massiv überfordert. So schildert sie eine Szene, in der sie ihrem Bruder in einem Kinderstreit eine Ohrfeige gibt, woraufhin die Mutter ihrer Tochter Nazimethoden vorwirft und sie mit Bildern von NS-Verbrechen konfrontiert. Sie streitet sich oft mit ihr und ergreift vor andern für die Mutter Partei.
Die Überlebenden der Shoa vergleicht sie heute mit „dem Rest der Versprengten“, eine aus dem Hebräischen stammende Bezeichnung für die Zurückgekehrten aus dem babylonischen Exil. Menschen, die „das Schlimmste erlebten, aber die noch immer eine größere Vergangenheit bezeugen können und mit der Erinnerung daran eine jüdische Zukunft aufbauen“. In den von ihnen hinterlassenen Werken findet Klapheck für die Gegenwart wichtige Impulse für die Erneuerung. Dem Einwand, dass die Überlebenden auch Verletzte sind, ein „traumatisierter Rest“, der Heilung sucht, begegnet die Rabbinerin, indem sie die Stärke der jüdischen Überlieferung dagegenhält: „Na klar. Man kann sagen, mein ganzes Engagement ist irgendwie auch Traumabewältigung. Es ist die Wiederherstellung einer großen Tradition. Wie genau, kann ich nicht sagen. Ich habe früher mal Therapie gemacht. Was ich jetzt tue, hilft mir mehr. Es ist nicht ein Aufarbeiten von Problemen meiner Kindheit, sondern ein Gestalten von Wegen, das Gestalten einer Tradition in der Gegenwart.“
Am Ritual des Segens über die Kerzen will sie zeigen, wie die spirituelle Praxis eine aktive Einstellung fördert: „Wenn wir Juden die Kerzen am Freitagabend segnen, sagen wir: ,Ich mache Schabbat.‘ Das heißt, wir Menschen machen das selber. Es gibt eine Zeitstruktur und eine Idee von Heiligkeit. Aber damit Schabbat Wirklichkeit wird, macht man es erst mal. Nachdem die Kerzen gesegnet sind, ist die Stimmung eine andere als vorher.“
Vom „Egalitären Minjan“, der liberalen Gemeinde, weiß man, dass Frauen den Männern hier gleichgestellt sind. In Frankfurt ist es den Beteiligten gelungen, dass liberale und orthodoxe Juden unter dem Dach der Einheitsgemeinde Tür an Tür ihre Religion praktizieren. Die Rabbinerin skizziert ein Bild ihrer Gemeinde: Eine Gemeinschaft von Überlebenden, unter ihnen nur wenige Frankfurter Juden, die vor der Shoa hier gelebt haben. Einige Leute aus Polen und Litauen, die als displaced persons nach dem Krieg in Hessen geblieben sind, Deutsche, Einwanderer aus Rumänien, Lateinamerika, Israel, der ehemaligen Sowjetunion, Japan und China. „Allen, die dazugehören, möchte ich Zugänge eröffnen, dass sie die Tradition miterleben können.“ Auch denjenigen, „die die Thora nicht glauben. Auch bei ihnen gibt es Momente, die ihnen heilig sind. Sie erleben die Gemeinschaft, erleben die Bar Mitzwa ihres Kindes, die Feier seiner religiösen Mündigkeit. Leute aus der ehemaligen Sowjetunion haben die Demokratisierung erlebt und dass sie auswandern konnten.“
Urgeschichte am Berg
Dass Diktaturen fallen, dass Menschen das Potenzial in sich tragen, eine Diktatur aufzulösen und eine Demokratie aufzubauen, das predigt sie ihrer Gemeinde. Demokratie und Rechtsstaat haben für Klapheck ihre Ursprünge auch in der Thora. Sie führt das „Königsgesetz“ im Fünften Buch Mose an. Danach brauchten Menschen keinen Herrscher über sich, außer Gott. Von Königen werde verlangt, das Gesetz immer bei sich zu tragen, auch der König stehe unter dem Gesetz: „Das ist der Rechtsstaat.“ Ihre klare Sprache, bei der jeder Buchstabe artikuliert ist, geht kurz in ein Murmeln über, von Gesetzestreue war in Königshäusern oft keine Spur. Sie erinnert weiter an die Urgeschichte am Berg Sinai, als das Volk sich per Abstimmung für die von Mose überbrachten Gesetze entschied. Die Pointe für Klapheck: „Das ist der Anfang aller Demokratie, dass die Bevölkerung das Gesetz will, und nicht, dass Gott es will.“ Gesetzgebung findet sie spannender als die Geschichten von den Erzvätern und -müttern, „die sich christliche Theologen gern herauspicken“. Denn in der Gesetzgebung bildeten sich gesellschaftliche Umbrüche ab. „Die Welt ändert sich erst, wenn die Gesetze sich ändern“, ist sie überzeugt.
Unser Gespräch findet nicht in der Frankfurter Westendsynagoge statt, sondern in einem Raum ihrer Privatwohnung auf der anderen Mainseite. Darin steht ein ovaler Tisch, drum herum mehrere Sitzgelegenheiten. Die Atmosphäre bestimmt ein Gemälde, „Hotel Stories“ von Dikla Stern. Im Zentrum: zwei freie Sessel, in Blautöne getaucht. „Man weiß nicht genau, stehen die Sessel oder schweben sie“, meint Elisa Klapheck. Sie und ihr Mann haben sich das Bild zur Hochzeit gekauft. Es passt in diesen Raum, der zum Reden einlädt.
Dialog ist ihre Lebensform, in der Gemeinde, im akademischen Kontext oder einfach mit interessierten Leuten. Zeit ihres Lebens hat sie sich dabei auf verschiedenen Feldern gleichzeitig bewegt. Mit dem „Politisch-Jüdischen Lehrhaus“ begründete sie eine Veranstaltungsreihe, die sich dem Wirken jüdischer Persönlichkeiten widmet und es auf mögliche Impulse für die Gegenwart hin befragt. Beispiele: Bertha Pappenheim, Begründerin des jüdischen Frauenbundes, oder Hugo Sinzheimer, Rechtswissenschaftler, auf den der Satz „Eigentum verpflichtet“ im Grundgesetz zurückgeht. Im Verein Thorat HaKalkala (Wirtschaftsethik) beackert sie Themen wie Zinsgeschäft, Handel mit Derivaten, gerechte Teilhabe von Armen, immer mit Bezug auf die Thora.
Beim Anschauen ihres Lebenslaufs stellt man sich die Frage, wann die nächste Station kommt. Die Rabbinerin, die viel von Politik und Recht versteht, würde auch in die Rolle einer Bürgermeisterin oder Stadtverordneten passen, Angehörige religiöser Minderheiten sind in der deutschen Politik unterrepräsentiert. Von der Religion her könne sie auch in die Gesellschaft hineinwirken, meint sie. Andererseits, der Frankfurter Bürgermeister habe ihr diese Frage auch schon gestellt. Ausschließen will sie das nicht.
Hedwig Gafga
Hedwig Gafga ist freie Journalistin und lebt in Hamburg.