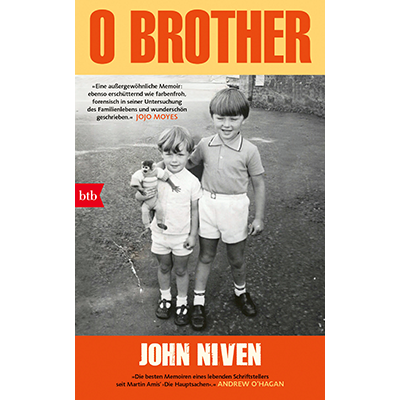Der doppelte Blick

Vor sieben Wochen erregte eine kurze Sequenz der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele in Paris international die Gemüter. Für den emeritierten Basler Professor für Praktische Theologie, Albrecht Grözinger, ist der Konflikt um die Feier auf der Seine ein Zeichen dafür, dass noch nicht alle gelernt haben, mit dem in der toleranten Neuzeit notwendigen doppelten Blick zu leben.
Nachdem nun die Olympischen Spiele ihr Ende gefunden haben und Frankreich und Paris für die gelungenen Spiele (zu Recht!) mit Lob überhäuft wurden, mag ein Rückblick auf den „Skandal“, der am Anfang der Spiele stand, beinahe schon anachronistisch erscheinen. Ich denke jedoch, dass sich darin etwas angemeldet hat, das uns die nächste Jahre, vielleicht Jahrzehnte begleiten wird. Ich sehe in den Vorgängen eine exemplarische Konstellation, die ein wichtiges Element der sich zweifellos anbahnenden neuen Weltordnung darstellt.
Zunächst ein kurzer Rückblick. Was ist eigentlich geschehen? Frankreich hat das getan, was von Eröffnungsfeiern der Olympischen Spiele erwartet wird, und wie das etwas auch in Sotschi 2014 und in Beijing 2022 der Fall war, und wie es auch die Olympische Charta vorsieht: Ein Land stellt sich mit seiner Kultur im weitesten Sinne vor. Zugleich soll diese Vorstellung eine Einladungsgeste an andere Nationen mit ihren Kulturen sein. Und wenn Frankreich Eines kann, dann ist es seine Selbst-Inszenierung als Grande Nation. Das ist auch am 26. Juli diesen Jahres in Paris geschehen – und zwar in einer ästhetisch bemerkenswerten Weise: nämlich als das Ineinander von Ernst und Heiterkeit, was durchaus eine explosive Mischung ist, wie sich zeigte. Von der grandios und durchaus pathetisch gesungenen Marseillaise bis hin zu Édith Piafs «Hymne à l'amour» gesungen von Céline Dion bei gleichzeitig falsch herum gehisster olympischer Flagge. Doch nicht die falsch gehisste Flagge sollte zum „Skandal“ werden, sondern eine eher beiläufige Szene auf der Seine: Menschen lagern sich um einen länglichen Tisch, und diese Menschen sind eindeutig als queere Menschen erkennbar. Was ist hier dargestellt? Nach Aussage des Regisseurs der Eröffnungsfeier Thomas Jolly ging es um die Nachempfindung des Bildes „Das Festmahl der Götter“ des niederländischen Malers Jan van Bijlert. „Gelesen“ wurde das Bild, das ursprünglich ein Bacchanal darstellt, aber auch als Nachempfindung des berühmten Abendmahlbildes des Leonardo da Vinci (siehe auch die damals veröffentlichten zz.net-Texte zum Thema vom 6. August von Bernd Kehren und vom 7. August. von Uwe Gräbe).
Gastmahl oder Bacchanale?
Nun erhob sich ein bitterer Streit, was denn nun wirklich dargestellt wurde: War der Verweis auf das Bild Jan van Bijlerts nur eine nachträgliche Schutzbehauptung? Und war das „Lesen“ einer Abendmahlsszene nur eine Falsch-Lektüre?
Das Brisante für mich besteht darin, dass beide Lesarten recht haben. Das konkrete Sujet der Präsentation auf der Seine erinnert in der Tat eher an das Bild van Bijlerts. Zugleich ist das Abendmahlsbilds Leonardos in der abendländischen Bildgeschichte derart ikonisch geworden (in vielfältiger Abwandlung), dass wir andere Bilder gleichsam durch dieses Bild hindurch sehen. Im Grunde sind in der rezeptiven Wahrnehmung vieler Menschen die beiden Bilder ineinander verschmolzen.
Wenn dem so ist, dann ist in der Rezeption der Szene auf der Seine das geschehen, was die abendländische Kultur- und Geistesgeschichte insgesamt auszeichnet: die antike griechische und römische Tradition sind mit der christlichen Tradition verschmolzen – und geworden ist das Europa, wie wir es heute kennen. Und wenn diese Analyse stimmt, dann kann man pointiert sagen: Die Szene auf der Seine ist ein ikonisches Symbol für die europäische –wer‘s emphatisch möchte: für die abendländische – Kultur.
Religion im öffentlichen Raum
Dass sich nun an dieser Ikone der europäischen Kultur ein solcher Streit entfalten konnte oder musste, zeigt die Brisanz des Geschehens. Offensichtlich hat Religion auch in einem teilweise säkularisierten Europa das Potenzial dazu, höchst emotionale Kontroversen auszulösen. Die Kritiker der Seine-Szene sprachen von „Angriff auf das Christentum“, von „Verachtung abendländischer Kultur“ oder von „westlichem Selbsthass“. Ein Dokument, indem diese Polemik exemplarisch kulminiert, ist die Stellungnahme des ehemaligen Präfekten der römischen Kongregation für Glaubenslehre Gerhard Ludwig Kardinal Müller.
Aber auch die Gegenseite ist nicht zimperlich. Religions- und Kirchenkritiker sahen bereits eine Inquisition am Werk, die die Freiheiten der bürgerlichen Revolutionen in Europa rückgängig machen wolle. Und emphatisch wurde wieder einmal die Parole von der „Religion als Privatsache“ ins Feld geführt. Ursprünglich diente in der frühen deutschen Arbeiterbewegung die Formel dazu, schlicht die Trennung von Staat und Kirche zu fordern. Eine Forderung, die heute in den meisten Staaten Europas erfüllt ist. Bei Lenin und in der nachfolgenden Propaganda der neu entstandenen Sowjetunion und ihrem Imperium diente die Formel dazu, Religion und Kirche fundamental zu bekämpfen. Nach 1945 war die Formel in den demokratischen Staaten der schlichte Ausdruck einer (vermeintlich!) gefundenen Balance zwischen religiösen Ansprüchen und einer weltanschaulich neutralen pluralistischen Gesellschaft: Die Religion gehörte dazu, solange sie sich im Raum der Öffentlichkeit einigermassen „dezent“ verhielt.
Dieses – oft gar nicht explizit bewusste – Konzept wurde allerdings in den letzten beiden Jahrzehnten durch verschiedene Entwicklungen in Frage gestellt: Fundamentalistische Bewegungen im Islam und Christentum meldeten erneut lautstarke Ansprüche an. Gewaltförmige Durchsetzung religiöser Ansprüche mehrten sich weltweit. Die zunehmende Migration stellte die Dominanz des Christentums, vor dessen Hintergrund die Formel von der Religion als Privatsache entstand, in Frage. Man merkte plötzlich: Religion lässt sich nicht im Raum des Privaten halten. Davon zeugt nicht zuletzt der ironische Tatbestand, dass es ausgerechnet Frankreich mit seinem hoch entwickelten und nicht selten durchaus ideologieförmigen Laizismus war, das als eines der ersten Länder in Europa mit seinem Kopftuchverbot ein Gesetz verabschiedete, das massiv in die Gestaltung der Ausübung von Religion eingriff. Religion wurde wieder zum Gegenstand der staatlichen Rechtsprechung.
Religion als «zivilgesellschaftliche Assoziation»
Deshalb wurde im öffentlichen Diskurs die Formel von der „Religion als Privatsache“ zunehmend ersetzt durch die Perspektive auf Religion und ihre Institutionalisierung als „zivilgesellschaftlicher Assoziation“. Im (Ideal-)Modell der Zivilgesellschaft zeichnen sich zivilgesellschaftliche Assoziationen dadurch aus, dass sie partikulare Perspektiven und Interessen in die Gesellschaft einbringen, ohne den Anspruch zu erheben, damit das Ganze zu vertreten und für das Ganze sprechen zu können (wie etwa Amnesty International, Arbeitgeberverbände oder Gewerkschaften).
Nun ergibt sich daraus nicht selten ein Konflikt, der darin besteht, dass zivilgesellschaftliche Assoziationen den Anspruch erheben, durchaus ein Interesse mit universeller Geltung zu vertreten. Man kann das sehr schön an „Fridays for Future“ sehen – eine zivilgesellschaftliche Assoziation im geradezu klassischen Sinne aber mit einem generellen Anspruch, der auch immer wieder in öffentlichen Aktionen zum Ausdruck gebracht werden.
In noch höherem Maße gilt das für Religionen (mit wohl wenigen Ausnahmen wie etwa die jüdische Religion). Religionen erheben einen universellen Geltungsanspruch. In ihren institutionellen Konkretionen, und wenn sie sich als zivilgesellschaftliche Assoziationen verstehen, repräsentieren sie jedoch nur eine partikulare Perspektive. Das heißt: Die Menschen müssen lernen mit einem – wie ich es nennen würde – „doppelten Blick“ zu leben. Intern vertreten sie eine Sichtweise auf die Welt, die einen universellen Anspruch erhebt, der aber zugleich extern nur als partikulare Perspektive wahrgenommen wird und in einer pluralistischen Gesellschaft auch nur so realisiert werden kann. Dies ist weder für die Einzelnen emotional-kognitiv einfach, noch ist es auf der institutionellen Ebene einfach, dies in konkreten Organisations- und Praxisformen zu realisieren. Gleiches gilt im Übrigen auch für Gruppen und Verbände, die sich der Religions- und Kirchenkritik verschrieben haben.
Szene auf der Seine
In diesem komplexen Lern- und Organisationsprozess stehen wir mitten drin. Und Vieles ist ungeklärt und auf der persönlichen individuellen Ebene emotional hoch ambivalent. Wir haben ja in den letzten Jahren häufig darüber geredet, wie schwer uns der Abschied von den volkskirchlichen Verhältnissen fällt. Meine These ist nun, dass in der Auseinandersetzung um die Szene auf der Seine all diese intellektuellen und emotionalen Ungesichertheiten aufgebrochen sind und mit im Spiel waren. Wobei ein Unterschied bemerkenswert ist: In Gesellschaften und Gruppen mit einer zivilgesellschaftlichen Offenheit konnte frei und durchaus kontrovers diskutiert werden, während in Staaten mit einer anderen Gesellschaftsformation und bei Gruppen, die mit einem weltanschaulichen Pluralismus eher auf Kriegsfuss stehen, mit heftiger Ablehnung und Diffamierungen gearbeitet wurde. Es ist kein Zufall, dass die Islamische Republik Iran und Donald Trump als Fundamentalkritiker mit den entsprechenden Verdikten auftraten.
Mit dem ikonischen Bild auf der Seine und der Kritik daran musste „Toleranz“ thematisch werden. Wobei in der kontroversen Diskussion Begriff und Sache von Toleranz durchaus gegensätzlich ins Feld geführt wurde. Bemängelten die Befürworter bei den Kritikern ein Zuwenig an Toleranz, so sahen die Kritiker entweder eine alles nivellierende Toleranz am Werk, wie sie der Postmoderne gerne unterstellt wird, oder sie sahen die Grenzen der Toleranz weit überschritten.
Und hier sind wir wieder beim Thema „Europa“. Der Gedanke der Toleranz ist ja in gewisser Weise eine „Erfindung“ Europas und zwar durchaus nicht aus freien Stücken. Der Philosoph Odo Marquard hat die Ideengeschichte von Toleranz in der ihm heiter-ironischen Form rekonstruiert. Als man im Gefolge der diversen Konfessionskriege und vor allem des blutigen Dreißigjährigen Krieges sah, dass der Preis für konfessionelle Streitigkeiten zu hoch war, erfand man – so seine pointierte These – die Hermeneutik. Anstatt sich im Krieg die Köpfe einzuschlagen wurde nun der Streit auf das unblutige Feld divergierender Interpretationen verlagert. Und daraus musste dann auch der Gedanke der Toleranz entstehen. Wenn divergierende Interpretationen zugelassen sind, müssen sich die Träger dieser divergierenden Interpretationen irgendwie am Leben lassen, ertragen – eben tolerieren.
Explosives Konflikt- und Gewaltpotenzial
Diese Rekonstruktion zeigt, dass „Toleranz“ eben nicht ein gemächliches „anything goes“ meint. Vielmehr entstand der europäische Gedanke der Toleranz, weil plötzlich konkurrierende, zunächst einmal religiös-konfessionelle Lebensentwürfe aufeinander trafen. In der Idee einer pluralistischen Gesellschaft sind dann damit alle lebensgeschichtlichen Entwürfe und Orientierungen gemeint. Toleranz – so könnte man sagen – entwertet nicht lebensgeschichtliche Entwürfe, sie ebnet sie gerade nicht in Gleichgültigkeit ein. Im Gegenteil: Toleranz würdigt lebensgeschichtliche Orientierungen, weil sie das Konflikt- und Gewaltpotenzial ernst nimmt, das immer dort gleichsam explodieren kann, wo solche konkurrierende Lebensentwürfe auf engstem Raum neben oder auch mit einander zu stehen kommen.
Allerdings hat der Streit um die ikonische Seine-Szene den alt-europäischen Begriff und Sache der Toleranz um einen wesentlichen Aspekt erweitert. Die Kritiker haben mangelnden Respekt und fehlende kulturelle Sensibilität eingeklagt. Zielt Toleranz eher auf die kognitive Dimension, so erinnert der Begriff des Respekts mehr an die emotionale Seite. Und man kann zwar sagen, dass der Gedanke der Toleranz eine europäische Erfindung ist, wenn es aber um Respekt-Kultur geht, werden wir vielleicht in anderen Kulturen sehr viel fündiger.
Wurden religiöse Gefühle verletzt? Das will ich nicht ausschließen. Allerdings stellte sich mir dieser Eindruck weniger bei den lauten Kritikern ein. Da hatte ich eher den Eindruck, dass dort die alten Kulturkampf-Mühlen der vertrauten Frontlinien anliefen. Aber dass der Streit so hoch emotional ablief, zeigt, dass dort, wo weltanschauliche Kontroversen ausgetragen werden, immer auch Emotionen im Spiel sind. Toleranz beginnt wahrscheinlich immer erst dort, wo es richtig anfängt weh zu tun. Jedenfalls habe ich aus dem Streit gelernt, dass „wir in Europa“ gut daran tun, neben der Pflege des uns vertrauten Gedankens der Toleranz, über die Entwicklung einer Respekt-Kultur nachzudenken, die Kontroversen nicht ausschließt, sondern humanen Streit erst ermöglicht.
Cancel Culture und Emotionen
Woran entzündete sich die Aufregung an der Szene auf der Seine wirklich? Wohl weniger daran, dass eine Abendmahlsszene re-inszeniert wurde, sondern vielmehr daran, wie dies geschah. Das ikonische Bild von Leonardo da Vinci wurde bis in unsere unmittelbare Gegenwart hinein auf vielfältige Weise re-inszeniert – von Andy Warhol über szenisch-fotografische Darstellungen bis hinein in die vielfältige Comic-World und Werbung für Mexican Street Kitchen. Zwar erhob sich immer mal wieder ein leicht zorniges Geraune, aber ein solcher Sturm der Entrüstung wie über die Seine-Szene gab es vorher nie. Es lag eindeutig daran, dass die Abendmahlsszene als Szene einer queeren Community dargestellt wurde.
Im Grunde wiederholte sich das, was sich bereits in der Reaktion auf die Nürnberger Kirchentagspredigt von Quinton Ceasar ankündigte, nun jedoch als sehr viel gewaltigerer Sturm. Es wird ein neues Kapitel aufgeschlagen im Kampf gegen «Wokeness» und Cancel Culture. Dabei waren allerdings die Fronten plötzlich verschränkt. Viele, die zuvor noch gegen Cancel Culture polemisierten, forderten nun ihrerseits plötzlich „Zensur“. Und viele, die zuvor sehr heftig mit der Berufung auf „kulturelle Sensibilität“ durchaus auch zu Zensurmaßnahmen bereit waren, pochten nun auf Kunstfreiheit.
Wie dem auch sei, die Diskussion um «Wokeness» (ich lasse den nicht unproblematischen Begriff jetzt mal so stehen) und Cancel Culture hat mit dem Streit um die olympische Eröffnungsfeier eine neue Stufe erreicht. Und es ist wiederum kein Zufall, dass sich das Ganze an einem religiösen Sujet entzündete. Hier sind die Emotionen und Empfindlichkeiten wohl immer noch verdichtet am Werk. Ein wenig hat mich der aktuelle Streit an die Auseinandersetzung um die Verleihung des Hessischen Kulturpreises an Navid Kermani im Jahre 2009 erinnert. Ich habe mich schon damals gefragt, warum zwei so kluge Köpfe wie der damaliges Kirchenpräsident der EKHN Peter Steinacker und Karl Kardinal Lehmann sich zu so vordergründiger Polemik gegen Kermani hinreissen lassen konnten. Nun der Streit konnte damals – nicht zuletzt durch Einsicht auf Seiten von Steinacker und Lehmann – einigermaßen gütlich beigelegt werden. Aber es zeigte sich bereits damals, welch vermintes Gelände wir betreten, wenn es um kulturelle und religiöse Fragen geht.
Nicht selten ambivalent
Der ganze Streit um «Wokeness» und Cancel Culture leidet meines Erachtens darunter, dass sich beide Seiten ihre grundsätzliche Legitimität absprechen. Ich würde geradezu die Gegenthese aufstellen: Dieser Streit ist in einer pluralistischen Gesellschaft unabdingbar. Und zwar deshalb, weil kulturelle Phänomene und Artefakte nicht selten ambivalent sind.
Ich nenne einige Beispiele: Gottfried Benn hat sich im Jahre 1933 recht schäbig gegenüber den Menschen verhalten, die ins Exil mussten. Sind deshalb seine Gedichte entwertet? Dietrich Bonhoeffer hat sich in seinem Artikel „Die Kirche vor der Judenfrage“ (allein der Titel ist aus heutiger Sicht hochproblematisch) sehr mutig für Juden und Jüdinnen eingesetzt, und zugleich enthält derselbe Artikel Sätze, die von antijudaistischer Theologie geradezu durchtränkt sind. Harriet Beecher Stowe hat mit „Onkel Toms Hütte“ einen Roman geschrieben, der Generationen gegen die Unterdrückung schwarzer Menschen sensibilisierte, und der zugleich von James Baldwin als rassistisch-paternalistisch empfunden wurde.
Nein – der Streit um kulturelle Empfindsamkeiten und Cancel Culture ist nicht nur legitim, sondern schlicht notwendig. Und deshalb sollten wir diesen Streit nicht immer nur von den höchsten Zinnen der Barrikaden aus führen, sondern ihn gleichsam normalisieren. Und vielleicht lernen wir sogar mit einem gewissen Entscheidungspluralismus zu leben. Warum soll das Gemeindeparlament in einer Stadt nicht entscheiden, dass es weiterhin eine Hindenburgstraße gibt, und ein anderes Stadtparlament entscheidet, „ihre“ Hindenburgstraße umzubenennen?
Europa? Europa!
An der Pariser Eröffnungsfeier 2024 hat sich – wie das die olympische Charta vorsieht – das gastgebende Land mit seinen kulturellen Traditionen vorgestellt. Dass dieses Land in diesem Jahr Frankreich war, hat für Europa seine besondere Bedeutung. Frankreich steht im Kontext der europäischen Geschichte in besonderem Maße für die Tradition der europäischen Aufklärung und der bürgerlichen Revolutionen, aber auch für die Erinnerung an die Genese des heutigen Europa aus dem Verschmelzen der vorchristlichen Antike mit dem frühen Christentum. Dass diese Geschichte eine Geschichte voller Ambivalenzen ist, führte die Eröffnungsfeier eindrücklich vor Augen: Mit der gesungenen Marseillaise über die enthauptete Marie-Antoinette bis hin zum rätselhaften Ineinander von Bacchanal, Abendmahl und aktueller LSBT*Q-Kultur. Europa auf dem Prüfstand vor den Augen der Welt und vor sich selbst.
Was wird von diesem Europa bleiben? Was soll von diesem Europa bleiben? Das sind die Fragen, die nicht zuletzt aus der Kontroverse um die Seine-Szene resultieren. Wenn wir diese Fragen ernsthaft aufnehmen und diskutieren, dann hat sich auch dieser aktuelle Streit in all seiner Verschrobenheit und Uninformiertheit, in all seinem Ernst und mit all seinen Emotionen gelohnt.
Dass sich gegenwärtig die Welt politisch und kulturell neu aufstellt, ist eine banale Feststellung. Und Europa steht in dieser Phase der Weltgeschichte in besonderer Weise auf dem Prüfstand. Seine Traditionen, die noch bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts bestimmend waren, sind heute als partielle Sonderkultur in Frage gestellt. Noch bei der Gründung der Vereinten Nationen im Jahre 1945 war ein selbstverständlicher Bestandteil des Gründungsaktes die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte, die ihrerseits auf der Proklamation der Menschenrechte der Französischen Revolution basieren. Ich kann mir inzwischen durchaus eine UNO vorstellen, die sich von dieser Norm ihres Gründungsaktes verabschiedet. De facto hat sie das in vielen ihrer Beschlüsse und Personalentscheidungen bereits getan.
In dieser Situation wird es weder möglich noch sinnvoll sein, dass Europa auf seinen alten Rechten und Privilegien beharrt. Zu ambivalent ist diese Geschichte des alten Europa. Zu oft hat es seine eigenen Ideale geschändet und verraten. Aber dieses Europa war auch immer zu Selbstkritik und Erneuerung fähig. Noch die postkoloniale Kritik klagt letztlich nichts anderes ein als diese Ideale und diese Kritikfähigkeit. Vielleicht bleibt uns in dieser neuen Phase der Weltgeschichte als Beitrag zur neuen Weltordnung nur die Erinnerung an unsere ambivalente Geschichte. Aber das wäre ja nicht wenig. Wie fragil und zugleich notwendig, diese europäische Erinnerung ist, hat der Streit um die olympische Eröffnungsfeier in diesem Jahr eindrücklich gezeigt.
Albrecht Grözinger
Dr. Albrecht Grözinger ist Professor em. für Praktische Theologie an der Universität Basel.