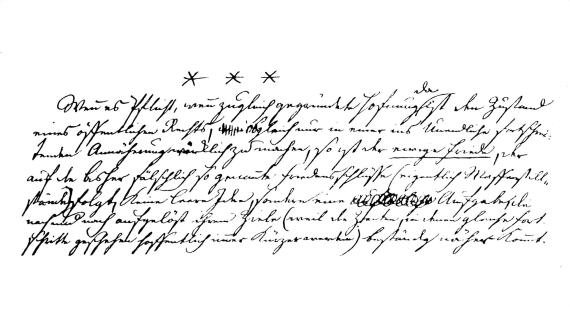Die Weltenwechsler

Pfarrerinnen und Pfarrer stammen oft aus Akademikerfamilien, viele sind selbst in Pfarrhäusern aufgewachsen. Das ist sicher ein Grund für die Milieuverengung in der evangelischen Kirche. Die Lösung: mehr Kinder aus Nicht-Akademikerfamilien ins Theologiestudium. Zwei, die diesen Schritt gegangen sind, berichten über ihre Erfahrungen: der frühere EKD-Ratsvorsitzende und rheinische Präses Nikolaus Schneider und Jaana Espenlaub von „ArbeiterKind.de“.
Die Menschen, um die es in diesem Text geht, kommen aus „einfachen Verhältnissen“. Sagen die, die vielleicht nicht wissen, wovon sie reden. Denn „einfach“ ist es in der Regel nicht, mit wenig Geld zu leben ist sehr anstrengend und oft kompliziert. Beim Einkaufen ständig mitzuzählen, um gleich an der Kasse nicht zu wenig Geld im Portemonnaie zu haben, ist nicht nur Denksport. Den Kindern in solchen Situationen Kleidung zu kaufen, mit denen sie in der Schule von den eigentlichen Asozialen nicht als „Asi“ bezeichnet werden, ist immer wieder neu eine Herausforderung. Und, um das gleich mal klarzustellen: Sozial schwach können diese Menschen auch nicht sein, denn ohne eine hohe Sozialkompetenz misslingen die ständig nötigen Balanceakte. Finanziell schwach ausgestattet trifft es schon eher.
Aber die Rede von den „einfachen“ Verhältnissen bezieht sich ja in der Regel auf die Berufs- und Bildungsbiografie der Eltern. Kein Abitur, kein Studium, stattdessen mittlere Reife, Lehre, dann Arbeiterin oder Angestellter. Zwei aus verschiedenen Generationen, die diese Welt kennen, sollen in diesem Text zu Wort kommen. Nikolaus Schneider, Arbeiterkind aus Duisburg, später ein Pfarrer, der gemeinsam mit Arbeitern gegen die Schließung des Stahlwerkes Rheinhausen demonstrierte und noch später rheinischer Präses und EKD-Ratsvorsitzender wurde. Und Jaana Espenlaub, wie Nikolaus Schneider „Erste an der Uni“ in ihrer Familie. Sie arbeitet jetzt bei „ArbeiterKind.de“ daran mit, dass solche Karrieren wie die von Nikolaus Schneider eben nicht die Ausnahme für diejenigen bleiben, deren Eltern nicht studiert haben. Denn das sind sie, gerade auch in der Kirche.
„Klassismus ist der Regelfall“, sagt Espenlaub im Interview mit zeitzeichen. „Und solange wir in der Kirche nicht darüber nachdenken, werden wir permanent klassistische Strukturen reproduzieren.“ Sie sagt „wir“, denn sie ist auf mehrfache Weise kirchlich geprägt. Sie verbrachte ihre Jugend in landeskirchlichen Gemeinden und Veranstaltungen der pietistischen Hahnschen Gemeinschaft, zu der ihre Familie gehörte. Sie besuchte eine katholische Privatschule, war aktiv bei der SMD. Und sie hat neben einem ersten Staatsexamen in Germanistik auch das Theologiestudium mit einem Diplom abgeschlossen. Pfarrerin wollte sie nicht werden, aber sie ist engagiert bei den Quäkern und beim Netzwerk Emergent Deutschland e. V., in dem es um die Zukunft der Kirche in einer fluiden Gesellschaft geht.
Zwei-Klassen-Gesellschaft
Vor diesem großen Erfahrungsschatz aus der kirchlichen Welt fällt sie ihr Urteil: „Die Sprache in den Predigten ist oft akademisch, passend für die aus dem bürgerlichen Milieu, die im Gottesdienst sitzen. Aber wer nicht aus diesem Milieu kommt, wird sich nicht eingeladen und dazugehörig fühlen.“ Doch ihre Kritik geht noch weiter: „Der Beamtenstatus der Pfarrer*innen reproduziert eine Zwei-Klassen-Gesellschaft, in der Pfarrer und Pfarrerinnen Privilegien genießen, die viele in der Gemeinde Lebende nicht haben. Wird das der Botschaft gerecht?“, fragt sie und betont sofort danach, dass viele Pfarrer und Pfarrerinnen einen tollen Job machten. „Aber wie viel haben die meisten von ihnen von anderen Lebenswelten außerhalb der akademisch-bürgerlichen Welt gesehen?“
Denn in den Seminaren und Vorlesungen der Theologie saß sie mit vielen Studierenden zusammen, die aus Pfarrerdynastien kamen. Die Herkunft hilft, etwa wenn in Gesprächen Namen fallen, mit denen man in evangelischen Pfarrhäusern aufwächst, die Jaana Espenlaub aber erst zu Hause nachlesen musste. Zudem habe sie mal beim Besuch einer Kommilitonin festgestellt, dass deren Vater, ebenfalls Theologe, sehr genau nach ihren Themen fragte und so zum hilfreichen „Sparringspartner“ werden konnte. „Ich war von meiner Familie daran gewohnt, dass es zwar grundsätzliches Interesse an Studieninhalten gibt, aber man doch lieber nicht so viel davon erzählen will oder höchstens so, dass man das Thema schnell wieder wechseln kann.“ Schließlich will man sich ja nicht herausheben oder den Gesprächspartner bloßstellen. Diese Sprachfähigkeit für zwei Welten zu erwerben, die Fähigkeit, zwischen den Welten zu leben, sei übrigens eine „unglaubliche Stärke“ von Arbeiterkindern.
Und noch eine andere Fähigkeit bringen sie mit: Den schlechteren Startplatz machen sie oft wett durch überdurchschnittliche Leistungen. So auch Jaana Espenlaub, was ihr half, auch in der akademischen Welt selbstbewusst aufzutreten. Und es brachte ihr Promotionsangebote. „Aber die habe ich nicht angenommen, unter anderem, weil mir die Finanzierung zu unsicher war.“ Andere hätten diese Möglichkeiten genutzt und so andere Karrieremöglichkeiten gehabt.
Nikolaus Schneider hat es auch ohne Promotion an die Spitze der evangelischen Kirche geschafft. Dabei kam der Arbeitersohn wahrlich nicht aus einer protestantischen Dynastie, hatte kein familiäres Netzwerk, das ihm bei der kirchlichen Karriere half. „In meiner Kindheit gab es für mich keinen Bezug zur Kirche. Religion und Kirche gehörten für meine Eltern eher ins ‚andere Lager‘. Die Grundfragen des Lebens wurden in meiner Familie naturalistisch beantwortet.“ Aber Bildung sei den Eltern wichtig gewesen, weshalb sie ihren Sohn auch auf Anraten des Klassenlehrers auf dem Gymnasium nicht vom Religionsunterricht abgemeldet haben, weil er ihnen vermittelte, dass religiöse Grundkenntnisse zur Allgemeinbildung gehörten. „Wichtig wurde mir dann aber auch, in der Zeit der Pubertät einen Raum zu finden, in dem ich existentielle Identitätsfragen klären konnte. Der Naturalismus reichte mir dabei nicht.“
Der Bezug zur Gemeinde kam durch Konfirmandenzeit, gemeindliche Jugendarbeit vom CVJM, irgendwann war Nikolaus Schneider Helfer im Kindergottesdienst. „Die Vorbereitungsstunden hatten hohe theologische Qualität und weckten neben dem schulischen Religionsunterricht mein Interesse an theologischen Fragen.“ Das Theologiestudium, zu dem ihm dann auch in der Gemeinde geraten wurde, war dann eigentlich eine logische Konsequenz, wenn auch ein Schock für die Eltern, die ihren Sohn lieber als zukünftigen Mediziner gesehen hätten. Aber Steine legten sie ihm nie in den Weg.
Für die Arbeit als Gemeinde- und Diakoniepfarrer in Duisburg-Rheinhausen brachte er also den nötigen „Stallgeruch“ mit, aber auch für das Theologiestudium und die Arbeit in den kirchlichen Gremien? Er habe in seiner gesamten kirchlichen Karriere nie wahrgenommen, dass ihm seine Herkunft zum Vorwurf gemacht worden wäre, meint Schneider. Und selbst die Situation bei der Examensprüfung, als seine Kommilitonen mit ihrer ganzen theologischen Ahnenreihe vorgestellt wurden und er eben „Herr Schneider aus Duisburg“ war, habe ihn eher belustigt. „Vielleicht war es für mich ein Vorteil, dass ich in der gesellschaftspolitischen Aufbruchsstimmung der 1968er-Jahre Theologie studierte. Darüber hinaus habe ich schon 1970 eine Theologiestudentin geheiratet, die zwar auch aus einer Arbeiterfamilie kam, aber aus einer Familie mit einem ganz intensiven kirchlichen ‚Stallgeruch‘.“
Doch natürlich weiß er um die Milieuverengung in der evangelischen Kirche, in der sich nach Selbstauskunft in der letzten Kirchenmitgliedschaftsuntersuchung nur 18 Prozent zur „Arbeiterschicht“ zählten und zwei Prozent zur „Unterschicht“, was immer damit auch gemeint ist. „Das ist kein neues Phänomen“, sagt Schneider. „Die Gründe dafür sind weitgehend bekannt: Die Sprache der Predigt und der Liturgie, viele Formen des Gottesdienstes, die klassische Kirchenmusik repräsentieren und ziehen ein anderes Milieu an.“
Das bedeute aber nicht, dass es unmöglich wäre, den Gottesdienst so zu gestalten, dass auch arme Menschen und prekär Beschäftigte sich dort wohlfühlen. Es habe mit dem Charisma von Pfarrerinnen und Pfarrern zu tun, ob es gelinge, für eine diese Menschen anziehende Atmosphäre zu sorgen, eine sie ansprechende Musik im Gottesdienst zu bieten „und eine Sprache zu sprechen, die elementarisiert, ohne zu verflachen oder sich populistisch anzubiedern.“
Mentor:innen gesucht
Doch die Form, mit der Kirche in Erscheinung tritt, sei nur eine Facette des Problems, meint Jaana Espenlaub. Das Thema liege auch auf der Haltungsebene, es gehe um Wohltätigkeit oder Solidarität. Kirche agiere oft nach dem Prinzip „Wir tun was für die anderen“, sagt sie. „Da gibt es ein ‚Wir‘ der Kirche und die anderen, die Hilfe brauchen.“ Ihr Wunsch wäre es, dass „wir alle Kirche sind“. Miteinander statt Othering also.
Nikolaus Schneider hält diesen Ansatz für „sehr ideal“ gedacht. „Bei großen Krisen, etwa der Schließung des Kruppschen Hüttenwerkes in Duisburg-Rheinhausen, gab es mit den Vertretern der Belegschaften und der Gewerkschaften ein solches ‚Wir gemeinsam‘. Aber institutionalisieren ließ sich das nach meiner Erfahrung auf Dauer nicht.“ Er sieht es auch weniger als parentifizierend, sondern positiv wenn die Gemeinden die Hilfen für diesen Personenkreis nicht an die Diakonie delegieren und selbst aktive Hilfe leisten. „Dann wäre das doch ein Schritt, um die gegenseitige Abschottung unterschiedlicher Milieus aufzubrechen. Dann können unterschiedliche Menschen aus der Gemeinde miteinander bekannt werden, dann kann Vertrauen entstehen über Milieugrenzen hinaus.“
An einem solchen unterstützenden Netzwerk gerade auch für diejenigen, die nicht die nötigen Kontakte von zu Hause mitbringen, knüpft „ArbeiterKind.de“ mit Mentor:innen. Sei es durch höhere Semester, die den Neuen an der Uni zur Seite stehen, aber auch die, die schon im Beruf sind, unterstützen diejenigen, die vor dem Berufseinstieg stehen und ihre Karriere starten wollen. Solche Mentoringprozesse koordiniert Jaana Espenlaub in Baden-Württemberg, bei Juristen oder Betriebswirten und in vielen anderen Fachrichtungen. Es gebe sie aber nicht bei angehenden Pfarrerinnen und Pfarrern. „Ich bin bei ArbeiterKind.de noch nicht auf hauptamtliche Theolog:innen gestoßen, die sich bei uns engagieren. Es gibt Theologiestudierende, die Schülerinnen und Studienanfänger begleiten. Aber keine Pfarrer*innen. Sie wären uns herzlich willkommen.“
Stephan Kosch
Stephan Kosch ist Redakteur der "zeitzeichen" und beobachtet intensiv alle Themen des nachhaltigen Wirtschaftens. Zudem ist er zuständig für den Online-Auftritt und die Social-Media-Angebote von "zeitzeichen".