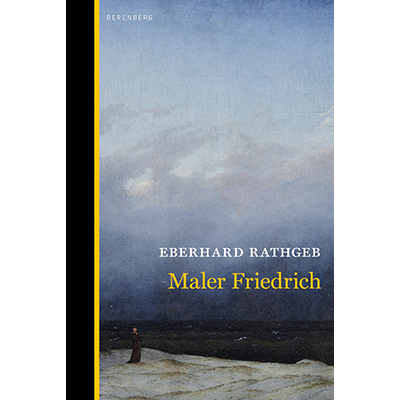Die Predigthilfe dieses Monats kommt von Kathrin Oxen, Pfarrerin in Berlin.
Hoher Preis
Sonntag Okuli, 12. März
Als aber, die um ihn waren, sahen, was geschehen würde, sprachen sie: Herr, sollen wir mit dem Schwert dreinschlagen? Und einer von ihnen schlug nach dem Knecht des Hohenpriesters und hieb ihm sein rechtes Ohr ab. Da sprach Jesus: Lasst ab! Nicht weiter! Und er rührte sein Ohr an und heilte ihn. (Lukas 22, 49–51)
Die christliche Friedensethik war bis zum 24. Februar 2022 ein Thema, das mit dem Ende des Kalten Krieges und mit seinen Protagonisten in Würde gealtert war. Immerhin taugte es noch dazu, auf Kirchentagen und in Evangelischen Akademien ventiliert zu werden.
„Krieg soll nach Gottes Willen nicht sein!“ Der Frieden war zuletzt, 2019, noch der Themenschwerpunkt einer EKD-Synode. Dahinter stand die Überzeugung, es sei zur Debatte doch viel Abschließendes schon gesagt: „Gewaltfreiheit“ als Überschrift über alles, als Auftrag Jesu und einzig gangbarer Weg zum Frieden. Daran hat sich nichts geändert. Aber sonst hat sich so ziemlich alles geändert.
Wann darf das Schwert eingesetzt werden? Die Geschichte von der Gefangennahme Jesu ist auch eine friedensethische Lektion. Eine etwas angespannte, aber eigentlich noch harmlose Situation zwischen Jesus und seinen Gegnern spitzt sich zu, als „eine Schar“ erscheint. Das sind Leute, die mit Schwertern und Stangen versehen sich für einen nächtlichen Überfall Jesu entschieden haben, statt für eine Diskussion der unterschiedlichen Positionen bei Tageslicht im Tempel.
„Dies ist eure Stunde und die Macht der Finsternis“ (Lukas 22,53), sagt Jesus. Dass man von dieser tiefen Finsternis einfach überfallen werden kann, ist die bittere Einsicht aus der Geschichte. Und bevor jemand nachdenken kann, schlägt der Erste zu und haut einer Nebenfigur, dem Knecht des Hohenpriesters, ein Ohr ab. Auch das hat sich seit Gethsemane nicht geändert: Verletzt oder gar getötet werden nie diejenigen, die den Überfall befohlen haben, sondern ihre Untergebenen.
In Gethsemane gelingt es Jesus noch, diese erste Wunde zu heilen. „Nicht weiter!“ Mit diesen Worten bewirkt Jesus die Deeskalation. Ihm selbst wird es – wie wir wissen – aber nichts nützen. Aus der Stunde, in der die Finsternis übermächtig ist, kommt er nicht lebend heraus. Den Weg der Gewaltfreiheit zu gehen, verlangt eben einen hohen Preis.
Wie ein Alptraum
Lätare, 19. März
Ich habe dich einen kleinen Augenblick verlassen, aber mit großer Barmherzigkeit will ich dich sammeln. Ich habe mein Angesicht im Augenblick des Zorns ein wenig vor dir verborgen, aber mit ewiger Gnade will ich mich deiner erbarmen, spricht der HERR, dein Erlöser. (Jesaja 54,7–8)
Gott ist immer da.“ Dieser Satz hängt gelegentlich über Kinderbetten, umrahmt von lieblichen Illustrationen. Ein Bild von Gott als Immer-Da: oft gehört, gesehen und gesagt bekommen. Und manchmal erfuhr man trotzdem, wie sich eine kindliche Angst anfühlt: Du wachst in einer Nacht auf aus einem Alptraum, und es ist niemand da. Die Eltern sind ausgegangen, alle Zimmer leer, und man bekommt keine Antwort. Urerfahrung und Urangst. Gleichermaßen unerträglich. Für das Kind die Erfahrung des Verlassenseins und für die Eltern die Erfahrung des Verlassenhabens, des nicht Dagewesenseins, als es nötig war.
Gottesbilder sind eine zweischneidige Sache. Sie geben Sicherheit und Trost. Doch wo man sie anhand von Erfahrungen in Frage stellen muss, stehen sie einem kindlich anmutenden Vertrauen im Weg. Und manchmal dem Glauben insgesamt. „Wo warst du, Gott?“, ist die Frage, an der sich Vertrauen und Glauben in den großen und den kleinen Schrecken des Lebens zu bewähren haben.
In den Worten aus dem Jesajabuch kommt mir Gott wie ein schuldbewusstes Elternteil vor. Ja, ich war nicht da. Ich hatte dich wirklich verlassen. Und du konntest mich nicht finden, weil ich mich vor dir verborgen hatte. Die Abwesenheit Gottes ist in der Erfahrung Israels eine Wirklichkeit, nicht bloß eine Möglichkeit. Es braucht keine dogmatischen Verrenkungen mit einem verborgenen und einem offenbarten Gott (deus absconditus und deus revelatus), um die ständige Anwesenheit Gottes weiter behaupten zu können. In der Bibel ist es viel einfacher und schrecklicher: Gott war nicht da, einen Moment lang. Es ist passiert, damals, als Gott von seinen Menschen genug hatte und alle – außer Noah und die Seinen – in der Sintflut ertränkte. Was für ein Schrecken, was für ein Gott.
Und wie groß dann auch noch Gottes Erschrecken über die eigene Abwesenheit ist, beschreibt Jesaja. Es soll nie wieder vorkommen, ganz bestimmt. Eher gerät die Welt aus den Fugen, eher weichen die Berge und fallen die Hügel. Aber Gott ist da.
Großer Bogen
Judika, 26. März
Und er hat in den Tagen seines irdischen Lebens Bitten und Flehen mit lautem Schreien und mit Tränen vor den gebracht, der ihn aus dem Tod erretten konnte; und er ist erhört worden, weil er Gott in Ehren hielt. So hat er, obwohl er der Sohn war, doch an dem, was er litt, Gehorsam gelernt. (Hebräer 5, 7–8)
Als Hohepriester nach der Ordnung Melchisedeks wird Jesus im Hebräerbrief beschrieben. Aber warum greift der Hebräerbrief ausgerechnet auf das Bild des Hohepriesters zurück, um die Besonderheit Jesu zu beschreiben?
Nicht unüblich, aber völlig gegen die Intention des Verfassers ist eine Auslegung im Sinne einer Überbietung. Melchisedek stünde dann für den Alten Bund und Jesus als der bessere Hohepriester für den Neuen Bund. Aber das Gegenteil ist der Fall: Im Hebräerbrief drückt sich aus, wie Jesus Christinnen und Christen in den Bund Gottes und seine Ordnungen hineinnimmt. So spannt der Hebräerbrief den großen Bogen von Abraham und Melchisedek bis zu Jesus, indem er die Erfahrungen der Väter und Mütter im Glauben aufruft.
Jesus ist kein besserer Hohepriester als Melchisedek. Vielmehr hat er wie alle Priester eine vermittelnde Funktion. In allem, was Jesus erlebt und wie er handelt, steht er mit Gott in Verbindung. Aber seine priesterliche Würde besteht darin, einfach ein Mensch zu sein und somit menschlichen Erfahrungen nicht enthoben. Es geht auch bei Jesus nicht ohne Bitten und Flehen ab, nicht ohne Schreien und Tränen. Und nicht ohne Gehorsam gegenüber Gott.
Alle klerikalen Vorstellungen von einem den irdischen Dingen enthobenen Priestertum werden so ad absurdum geführt. Nicht selten wird ja selbst in evangelischen Kirchen noch von „Laien“ gesprochen. Dabei sollten in der Nachfolge Jesu derlei Unterscheidungen aufgehoben sein. Denn nach der Ordnung Jesu sind wir alle Hohepriesterinnen und Hohepriester.
Hoffnung auf Neues
Palmsonntag, 2. April
Jesus aber fand einen jungen Esel und setzte sich darauf, wie geschrieben steht (Sacharja 9,9): „Fürchte dich nicht, du Tochter Zion! Siehe, dein König kommt und reitet auf einem Eselsfüllen.“ Das verstanden seine Jünger zuerst nicht; doch als Jesus verherrlicht war, da dachten sie daran, dass dies von ihm geschrieben stand und man so an ihm getan hatte. (Johannes 12, 14–16)
Ob das Fell des Esels grau oder schwarz war, wissen wir nicht. Aber sanft, genügsam und störrisch war das Tier, auf dem der König einzieht, bestimmt. Und jung waren sie beide. Da kommt ein Eselfohlen mit einem Kind auf seinem Rücken.
Dass Kinder mit Eseln aufwachsen, war damals üblich. Kein Wunder. Sanft, mit dem wolligen Fell und den weichen Ohren eignen sich Esel hervorragend als große, lebendige Kuscheltiere.
Ein Kind auf einem jungen Esel – das ist der König, den der Prophet Sacharja kommen sah. Barfuß wahrscheinlich, mit einem Grashalm im Mund. Für die Tochter Zion, die Menschen in Israel, war das ein Gegenbild zu den Pferden mit den stampfenden Hufen und schnaubenden Nüstern, die die Streitwagen zogen und auf deren Rücken gepanzerte Krieger saßen.
Unser König ist anders, sagt der Prophet. Er schert sich nicht um Reichtum, Stärke, Macht. Das alles besitzt er nicht. Woher auch. Er ist ja noch ein Kind. Und dieser Reiter soll unser König sein. Wir sind genügsam in dürftigen Zeiten. Und halten störrisch wie ein Esel an der Hoffnung fest, dass etwas Neues kommt.
Später, viel später hat sich Jesus einen Esel ausgesucht, um in die Stadt Jerusalem zu reiten. Und da fiel ihnen das alles wieder ein. Ein passenderes Reittier gibt es für ihn nicht. Sanft ist er, genügsam bis arm, ein Gerechter und ein Helfer. Und störrisch wie der Esel, auf dem er reitet. Wie passend in diesen Zeiten.
Anders als erwartet
Karfreitag, 9. April
Er ist der Anfang, der Erstgeborene von den Toten, auf dass er in allem der Erste sei. Denn es hat Gott gefallen, alle Fülle in ihm wohnen zu lassen. Und durch ihn alles zu versöhnen zu ihm hin. (Kolosser 1, 18–20)
Wer ist eigentlich Jesus? Um diese Frage kreisen in dieser Passionszeit alle Predigttexte. Und sie haben eine gemeinsame Antwort: Jesus ist immer anders. Er kämpft nicht und schlägt nicht zurück, wo wir sofort draufhauen würden. Er bittet und fleht, weint und schreit wie jeder Mensch, der leidet, anstatt dem Leiden in göttlicher Gelassenheit zu begegnen. Er lernt und zweifelt, fügt sich und widerspricht – vor allem den Vorstellungen und Bildern von dem, was einen Gott eigentlich ausmachen sollte. Jesus ist immer anders, von Anfang an. Sogar sein Ende ist ein Anfang. In allem ist der Erste, in allem der, der es anders macht als alle anderen.
Der Kolosserbrief entwirft in seinem Anfangskapitel, seinem Namen gemäß, ein Kolossalgemälde des Wesens Jesu. Andere werden erst geboren und wirken dann. Jesus ist dagegen schon vor allem da. „Es ist alles durch ihn und zu ihm geschaffen“ (Kolosser 1, 16). Aber diese hohe Christologie steht am Karfreitag in einem besonders spannungsvollen Gegensatz zum leidenden und sterbenden Jesus am Kreuz.
Jesus – und in ihm Gott – macht es anders, als alle erwarten. In seinen letzten Stunden am Kreuz haben die Umstehenden ihm zugerufen: Nun beweise uns, dass du Gott bist! Aber Jesus hilft sich nicht selbst. Und steigt nicht herab vom Kreuz, sondern leidet und stirbt.
Aber dann wird er es anders machen, als es alle erwarten, bleibt nicht tot, sondern wird auferweckt. Er ist der Anfang, wo wir immer nur ein Ende sehen können. Heute vor 78 Jahren starb Dietrich Bonhoeffer im KZ Flossenbürg. Seine letzte Botschaft vor der Ermordung am Galgen soll gewesen sein: „Für mich ist dies das Ende – und auch der Anfang.“