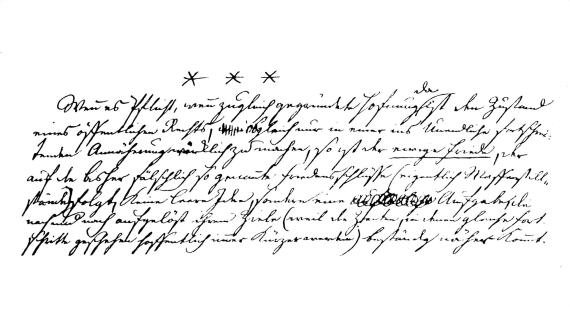Neue Horizonte – alte Probleme

Zehn Jahre nach der Wahl des Argentiniers Jorge Mario Bergoglio zum Papst stellt sich die Frage: Wie hält es Franziskus mit der Ökumene? Als Papst sind von ihm keine wegweisenden Impulse für die Vertiefung der Beziehungen zum Protestantismus und zur Orthodoxie im Gedächtnis geblieben. Was dennoch bleibt, analysiert der katholische Theologe Thomas Söding von der Ruhr-Universität Bochum.
Als Papst Franziskus am 13. März 2013 mit einem „Buona sera“ auf die Loggia des Petersdomes trat, erklärte er, dass die Kardinäle offenbar „bis ans Ende der Welt“ gegangen seien, um einen neuen Bischof von Rom zu finden. Meine erste Reaktion war: Vielleicht kommt nicht der Erzbischof von Buenos Aires „vom Ende der Welt“, sondern ein Theologe aus Deutschland. Die Weltkarte hat sich geändert. Nicht Latein, nicht Italienisch, nicht Englisch, schon gar nicht Deutsch, sondern Spanisch ist die katholische Sprache Nummer eins. Die meisten Kirchenmitglieder leben in Lateinamerika, im südlichen Afrika und in Asien. Das Verhältnis von Peripherie und Zentrum hätte nie so sein sollen, dass vom Vatikan aus die ganze Weltkirche beherrscht wird. Auch Rom ist Peripherie. Hat diese Sicht mit Papst Franziskus eine neue Chance? Das wäre für die Ökumene entscheidend.
Globale Perspektiven
Der ökumenische Blick, den Papst Franziskus entwickelt hat, ist von den Erfahrungen in Argentinien geprägt. Seine Sichtweise unterscheidet sich stark von der seiner Vorgänger. Der charismatische Philosoph und Politiker Johannes Paul II. hat die Einheit der Christenheit in seiner Enzyklika „Ut unum sint“ 1995 als Vision eines Glaubensfriedens entworfen, der in Ost und West auf die ganze Welt ausstrahlen sollte. Er hat auch die Ausübung des Papstamtes zur Diskussion gestellt – ist allerdings nie konkret geworden, welche Reformen nötig oder möglich sind.
Benedikt XVI., Joseph Ratzinger, war intellektuell und spirituell tief in der abendländischen Geistesgeschichte verwurzelt. Durch seine Interpretation der Tradition hat er die Tür zur Orthodoxie geöffnet. Durch seine Liebe zu Augustinus hat er ein Verhältnis zu den Glaubensanliegen Martin Luthers entwickelt. So hatte er seinen Anteil daran, dass am Reformationsfest 1999, gegen Widerstände aus der römischen Kurie, die „Gemeinsame Erklärung zur Rechtfertigungslehre“ unterzeichnet wurde; die aus einem konfessionellen Graben eine konfessionelle Brücke hat werden lassen.
Allerdings ging Joseph Ratzinger/Benedikt XVI. von einem Grunddissens im Kirchenverständnis aus; deshalb ist sein Name auch mit „Dominus Iesus“ (2000) verbunden, der Erklärung der Glaubenskongregation, dass die aus der Reformation hervorgegangenen „Gemeinschaften“ nicht „Kirchen im eigentlichen Sinn“ des Wortes seien. Bei seinem Besuch 2011 im Augustinerkloster Erfurt hat er es zwar abgelehnt, ökumenische „Gastgeschenke“ zu verteilen, aber keinen Impuls gesetzt, die Glaubensfrage, um die es ihm ging, nachhaltig in der Ökumene auch kirchlich zu verankern. In seinem postum veröffentlichten Buch „Was ist das Christentum?“ (2023) behauptet er, das evangelische Abendmahl und die katholische Eucharistie seien grundverschieden, was sich am Kriterium des Priestertums zeige.
Beweisen Johannes Paul II. und Benedikt XVI., dass die Ökumene, die von der europäischen Theologie geprägt ist, an einen toten Punkt gelangt ist? Oder gibt es die Möglichkeit, noch einmal back to the roots und hinaus ins Weite zu gehen, um den Stillstand zu überwinden?
Interreligiöse Lichtblicke
Jorge Mario Bergoglio hat nur kurze Zeit in Deutschland verbracht; es waren keine glücklichen Monate, die er an der Jesuitenhochschule St. Georgen in Frankfurt am Main verbracht hat. Papst Franziskus ist nicht von der klassischen Kontroverstheologie geprägt. Weder als Bischof noch als Kardinal hat er eine aktive Rolle in der Konsensökumene gespielt. Auch als Papst sind von ihm keine wegweisenden Impulse für die Vertiefung der Beziehungen zum Protestantismus und zur Orthodoxie im Gedächtnis geblieben.
Den argentinischen Jesuiten haben nicht Begegnungen mit Lutheranern und Reformierten oder Orthodoxen geprägt, sondern die Auseinandersetzungen mit den Neo-Pentekostalen, die ihre größten „Missionserfolge“ in katholischen Milieus feiern. Amtstheologisch sind sie denkbar weit von der römischen Kirche entfernt, so hart auch die charismatischen Autoritäten wirken, auf die sie setzen. Ethisch suchen sie den Schulterschluss mit der katholischen Moraltheologie, aber nur in der Individual-, nicht auch in der Sozialethik.
Hier liegt der Keim des Widerspruchs, den der frühere Erzbischof von Buenos Aires und heutige Bischof von Rom anmeldet. Hier liegt auch seine Bedeutung für die Ökumene. Für ihn ist die soziale und ökologische Frage von weltbewegender Bedeutung. An den nachsynodalen Schreiben „Evangelii Gaudium“ (2013) und „Querida Amazonia“ (2020), aber auch an der Enzyklika „Laudato si“ (2015) lassen sich diese Wegmarken klar erkennen. Der Papst nimmt die katholische Weltkirche in die Pflicht, alles zu tun, also auch möglichst breite Bündnisse zu schmieden, um zusammen mit der Klimakatastrophe auch die brutale Armut zu bekämpfen, für die der Begriff der Marginalisierung noch zu harmlos ist.
Teil dieses öko-sozialen Kirchenprojektes sind die starken Initiativen, eine interreligiöse Verständigung voranzutreiben, insbesondere mit der zweitgrößten Weltreligion, dem Islam. Am 4. Februar 2019 unterzeichnete Papst Franziskus zusammen mit dem Großimam der al-Azhar-Universität von Kairo, Ahmed al-Tayyeb, die Erklärung von Abu Dhabi, die mit Berufung auf Gott für die Religionsfreiheit und für die universale Geschwisterlichkeit eintritt. Diese Erklärung, die andere Religionen nicht aus-, sondern einlädt, ist in die Enzyklika „Fratelli tutti“ (2020) eingegangen „über die Geschwisterlichkeit und die soziale Freundschaft“.
Ist diese Blickveränderung die Zukunft der Ökumene? Oder ist sie Indikator einer fatalen Moralisierung des Glaubens, die sich in rhetorischen Anklagen und gutgemeinten Appellen verliert?
Politik und Spiritualität
Das Herzblut des Papstes, der es gewagt hat, sich den Namen des jungen Wilden aus Assisi zuzulegen, schlägt dort, wo global gedacht und lokal gehandelt wird. Franziskus ist weniger der Pfarrer, den manche in ihm nach dem „Professor Papst“ gesehen haben, als der Pater, der aufrüttelt und ins Gewissen redet. Er fordert die Unterscheidung der Geister; er gibt weniger auf Strukturen als auf Projekte, die von Engagierten mit Leidenschaft vorangetrieben werden. Sein Leitwort ist der sperrige Begriff der „Evangelisierung“. Aber während Benedikt XVI. darauf setzte, die Geheimnisse des Glaubens zu elementarisieren, um sie ohne Substanzverlust besser zu kommunizieren, polemisiert Franziskus gegen die klerikalen Eliten und appelliert an die Verkündigung, die in Taten überzeugender als in Worten geschehe. Sein Leitwort ist im Politischen Gerechtigkeit, im Kirchlichen aber Barmherzigkeit. 2015/2016 hat er ein ganzes „Jahr der Barmherzigkeit“ ausgerufen: gegen die dogmatische und moralische Härte, die dem modernen Katholizismus geschadet hat, gegen das Pochen auf geweihter Vollmacht, die Menschen be- und verurteilen dürfe, für eine Menschenfreundlichkeit, die immer schon das Anzeichen echter Frömmigkeit gewesen ist (Titus 3,4).
Wer die Agenda des römischen Papstes mit derjenigen des Ökumenischen Rates der Kirchen vergleicht, erkennt viele Gemeinsamkeiten. Auch der ÖRK wirkt in der Friedensethik hin- und hergerissen. Auch dort spielen sozialethische und ökologische Fragen seit langem eine sehr große Rolle. Themen des Kirchenverständnisses, der Sakramente, der Bildung im Glauben stehen hingegen weniger im Blick.
Was bedeutet diese politische Spiritualität für die Ökumene, also für die Beziehungen der orthodoxen, evangelischen und katholischen Kirche? Muss die klassische Ökumene aufgegeben werden, weil neue Prioritäten gesetzt werden müssen? Kann sie von der Globalisierung, der Universalisierung, der politischen Sensibilisierung der Theologie profitieren? Kann sie ihrerseits den Weltreligionen Impulse geben?
Neue Farben
Hans Joas warnt die katholische Kirche davor, sich als „Moralagentur“ zu inszenieren (2016). Die Warnung zu beherzigen, heißt nicht, die ethischen Dimensionen ökumenischer Verständigung zu missachten. 500 Jahre Reformation in Deutschland gemeinsam zu feiern, war auch ein Beitrag zur Stärkung des gesellschaftlichen Zusammenhalts: freilich als Konsequenz, nicht als Funktionalisierung einer Heilung der Erinnerung, die durch Gebet und Reflexion ihren Ausdruck findet. Was im kleinen nationalen Maßstab geschieht, bleibt eine Aufgabe von globalen Dimensionen. Kirchen, die sich ökumenisch im Wesentlichen mit sich selbst beschäftigen, haben ihre Aufgabe verfehlt. Eine Ökumene, die nur Lehre wäre, bliebe leer. Wenn Ökumene nicht dem Frieden dient, indem sie den Angriffskrieg ächtet, und zwar nicht nur den zwischen Nationen, sondern auch den gegen die Natur, ist sie überflüssig. Aber Zukunft gewinnt sie durch die Gottesperspektive.
Das europäische Erbe, das Jürgen Habermas mit seiner „Geschichte der Philosophie“ (2019) in Erinnerung gerufen hat, besteht im kritischen Wechselverhältnis von Glaube und Vernunft. Dieses Erbe zu erwerben, zwingt keineswegs dazu, die theologischen Gewissheiten zu repetieren, die konfessionelle Identitäten konstruieren. Es verbindet sich längst mit asiatischen, afrikanischen, indigenen Denkformen. Es bleibt die Herausforderung, Glaube mit Religions- und Kirchenkritik zu verbinden; es bleibt auch die Aufgabe, philosophisch nicht vor der Gottesfrage zu kapitulieren, sondern sie innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft, wie Immanuel Kant es getan hat, über den Rationalismus hinaus zu beantworten, so dass neue Fragen entstehen und auch neuer Glaube möglich wird. In der Ökumene muss beides geschehen – oder sie hat nichts zu vermelden. Wenn es aber geschieht, werden Glaube und Vernunft konkret: Sie bestimmen die religiöse Praxis.
Das Verhältnis zur Orthodoxie ist auf katholischer wie auf evangelischer Seite zwar durch anti-westliche Affekte, speziell in Russland, schwer belastet. Es kann aber vom langen Atem einer Theologie belebt werden, die nicht im Bann der Erbsünde steht, sondern die verheißene Vergöttlichung des Menschen (2. Petrus 1,3–4) zu hoffen wagt.
Die evangelisch-katholische Ökumene hat einen anderen Charakter. Sie ist immer auch ein Ernstfall intellektueller Kontroversen, der – bei allen Wunden, die durch die Kirchenspaltung geschlagen worden sind – ein Glücksfall der theologischen Reflexion ist: Es gibt keine konfessionellen Selbstverständlichkeiten; es gibt bei allen Gemeinsamkeiten im Glauben eine echte Alternative: in der Sprache, in der Liturgie, im Recht, in den liturgischen Formen, in der Sozialgestalt der Kirche, im Verhältnis der Geschlechter, in der Gewichtung von Themen und in der Fokussierung von Charismen.
Es gibt vor allem die Möglichkeit, Unterschiede in den Deutungstraditionen nicht gegeneinander auszuspielen, sondern darauf hin zu befragen, ob sie wechselseitig als legitime Ausdrucksformen des Christusglaubens verstanden werden können – mit Lerneffekten für die eigene Konfession. Wenn dies gelingt, lassen sich Prozesse der Anerkennung und Einigung verantwortungsvoll gestalten, selbst wenn es keine hundertprozentige Übereinstimmung in den Zielbestimmungen gibt.
Wenn Rom nicht nur Zentrum, sondern auch Peripherie ist, wäre es ein fataler Fehler, die stärksten Impulse der Ökumene ausgerechnet vom Vatikan zu erwarten. Katholiken kennen die Versuchung, nur dann richtig glücklich zu sein, wenn der Papst und die Bischöfe an der Spitze des Fortschritts marschieren. Tatsächlich ist Franziskus in seinen besten Momenten nicht nur der Sprecher der Christenheit, sondern auch der Menschheit mit Herz und Verstand – so wie immer wieder in der Migrationsthematik. Aber die Ökumene ist dezentral. Deshalb tut die Ökumene der katholischen Kirche gut. Sie darf sich nicht selbst sakralisieren. Gegen den Klerikalismus redet Papst Franziskus Klartext. Bei der Anerkennung verschiedener Kirchentypen ist noch sehr viel Luft nach oben.
Thomas Söding
Thomas Söding ist Professor für Neues Testament an der Ruhr-Universität in Bochum.